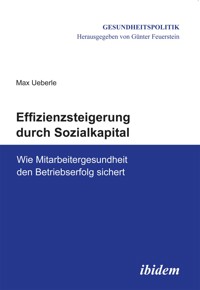
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesundheitspolitik
- Sprache: Deutsch
Menschen mit vielen Sozialbeziehungen sind gesünder und erfolgreicher als Menschen mit wenigen. Was heißt das aber für Arbeitnehmer? Sind Arbeitnehmer mit einen guten Verhältnis zu ihren Kollegen, Vorgesetzten und zu ihrem Betrieb auch gesünder und erfolgreicher als Arbeitnehmer mit weniger guten Sozialbeziehungen? Anhand empirischer Daten vornehmlich aus Industrieunternehmen untersucht Max Ueberle die Auswirkungen verschiedener Formen von Sozialkapital auf die Produktivität von Arbeitsgruppen – und kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Die Ausstattung mit Sozialkapital hat einen deutlich messbaren Einfluss auf die Leistung von Arbeitsgruppen, selbst bei weitgehend vorgegebenen Tätigkeitsinhalten in der industriellen Güterherstellung. Angesichts der in vielen Bereichen ausgereizten technischen Entwicklungsmöglichkeiten ist das Sozialkapital somit ein Produktivitätsfaktor, in dem eine deutlich hohe Innovationsrendite für Investitionen zu erwarten ist. Gerade angesichts drohender und eingetretener Qualifikationsengpässe auf dem Arbeitsmarkt wird die Ausstattung mit Sozialkapital so zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a Signifikanzniveau al. Cronbachs alpha
BAB Betriebsabrechnungsbogen
BGF Betriebliche Gesundheitsförderung
BGM Betriebliches Gesundheitsmanagement
BSC Balanced Scorecard
b Regressionskoeffizient
CIR Cost-Income-Ratio
MTM Methods Time Measurement (Arbeitsablauf-Zeitanalyse)
m Mittelwert
PPS Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (Software)
r Korrelationskoeffizient
R2 Determinationskoeffizient al. Bestimmtheitsmaß
RL Rücklaufquote
s Standardabweichung
v Schiefe
w-3 Exzess
1Einleitung
1.1Problemhintergrund
Einer langfristig zu beobachtenden Unterbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt steht auf der Seite des beschäftigten Arbeitspotenzialseine zunehmend intensive Auslastunggegenüber. Zeitdruck wird etwa im gewerblichen Bereichimmer mehrals eine starke Belastung wahrgenommen.[1]Durch eine höhere Kapitalausstattung der Arbeitsplätze und denwirtschaftlichenWandel hin zueinerDienstleistungsgesellschaft steht jedoch nicht mehr die körperliche Belastung im Mittelpunktdieser Betrachtung,denndieseistden herkömmlichen Methoden des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes zugänglich. In den gewandelten Aufgabenfeldernbesonders des Dienstleistungsbereichsnehmen die psychischen Belastungender Erwerbstätigeneinen relativ höheren Anteil ein. So ist zu beobachten,dassder Anteil an Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund psychischer Störungen inDienstleistungstätigkeitenein VielfachesderFehltage ähnlicherDiagnosegruppeningewerblichen Tätigkeitsfeldern ausmacht. Diese Tendenz ist seit Jahren steigend.[2]Maßnahmen,die zum Ziel haben, Erwerbstätige vorsolch negativen gesundheitlichen Folgen zu schützen, können entweder eine De-Intensivierung der Tätigkeitenanstreben, die Kompensationskompetenz der Erwerbstätigen steigern oder aber die Arbeitsverhältnisse so umgestalten,dasseine gleichbleibende Arbeitslast mit einem geringeren Arbeitsleid einhergeht.[3]Langfristige Belastungen führen zu einer Verringerung der Leistungsfähigkeit und gefährden damit auch die Produktionsfähigkeit von Betrieben. Es istzwarnicht so,dassdie Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern mit Überschreiten einer wie auch immer konventionell festgelegten Krankheitsschwelle auf null sinkt.Aber esist davon auszugehen,dasssich bereits vor dem Überschreiten dieser Schwelle negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern ergeben.Eine solche kontinuierliche Abnahme istallerdings nur schwermessbar.[4]
Bei einer solchen Betrachtunglässtsich feststellen,dass die Gesundheit der Mitarbeiter durchaus im Interesse der Kapitaleigentümer von Betrieben liegt.Für die Durchsetzung von Anliegen der betrieblichen Gesundheitsprävention erscheint es angesichts eines oft intensiven wirtschaftlichen Wettbewerbs argumentativwederzielführend noch notwendig, primär auf eine humanitäre Verantwortung der Betriebe hinzuweisen. Vielsinnvoller ist eineumfassendere Kosten- und Nutzenrechnungals sie bisher häufig durchgeführt wird, um das ökonomische Potenzial einer verbesserten Mitarbeitergesundheit besser einschätzen zu können.Diesebewegt sich im vertrauten Denkmuster von Wirtschaftsunternehmen, nämlich im Bereich derwirtschaftlichenRentabilität.
Trotz der weitgehenden Sozialisierung von Krankheitskosten wird der Erhalt der Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter künftig für die Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Gemäß gegenwärtigem Erkenntnistand wirdzum Beispielder demografische Wandel in absehbarer Zeit zu einer veränderten Altersverteilung in der Bevölkerung führen. Neben Finanzierungsproblemen in der Sozialversicherung bringt dies absehbar Engpässe bei dem Arbeitsangebot mit sich. Notwendig wird dann die langfristige Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter.DiemenschlicheArbeitskraft wird zum Engpassfaktorbei der Leistungserstellung. Zur SicherstellungihrerVerfügbarkeitsind Maßnahmen auf vielen Gebieten zu treffen.
Aus gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen ist bekannt, dass die Einbindung von Menschen in gesellschaftliche Netzwerke einen wichtigen Einfluss auf ihre Gesundheit hat. Berufstätige Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Daher erscheint es angemessen, der sozialen Einbindung von Mitarbeitern in dieser Lebenswelt besonders nachzugehen.
1.2Ziele und wissenschaftliche Fragestellung
In dervorliegenden Forschungsarbeitsoll der Frage nachgegangen werden, wie sich Investitionen in die Gesunderhaltung von Mitarbeitern im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Betrieben auswirken. Für die Analyse wird ein ökonomisches Vorgehen gewählt, dasauf der Annahme beruht,dassBetriebe einwirtschaftlichesGewinnstrebenundArbeitnehmer ein Interesse am Erhalt der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeitzur Sicherstellung ihrespersönlichen Lebensunterhaltshaben. Diese Prämissen werden im aktuellen Kontext reflektiert.
Beispielhaft werden die InteressenkonstellationenamFaktorSozialkapitaluntersucht. Es wird überprüft, ob und inwiefern es sich bei diesemEinflussfaktorauf die wirtschaftliche Produktivität um einen Produktionsfaktor handelt und – bei positivem Ergebnis – welcher Art die Produktionist.Im Mittelpunkt der Analyse steht die Auswirkung auf die Erstellung von Gütern und Dienstleistungen undaufder Erhaltung des Produktionsfaktors Arbeit.
Die Analyse geschieht aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht.Das Vorliegen von Sozialkapital hat erhebliche Auswirkungen auf den Produktionsfaktor Arbeit. Standen bisher im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Fragestellungen aus dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit im Mittelpunkt, bei denen es primär um die Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit von Menschenging– erst neuerdingswirdeine Integration psychischer Belastungsfaktorenzum Beispielin die Gefährdungsbeurteilungen gefordert[5]– so müssen die Schwerpunkte künftig anders gesetzt werden.Zum einen zeigen die bisher erfolgreichen Bemühungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz einen sinkenden Grenznutzen,zum anderen haben sich die Belastungsprofile von Arbeitnehmern im Zuge des Wandels in eine Dienstleistungsgesellschaftaufpsychische Belastungen verschoben. Einige Kontextfaktoren[6]für solche Belastungen können durch denEinflussbeziehungsweise die Abwesenheit von Sozialkapital erklärt werden.
Die Auswirkungen einer Ausstattung mit Sozialkapital auf die Gesundheit vonMenschenistin vielen Zusammenhängen und Lebenswelten belegt. Anhand von Daten aus dem Sozioökonomischen Panel weistz.B.Kroll[7]einen Zusammenhang zwischen dem Netzwerkkapital von Menschen und ihrer Gesundheit nach.[8]Für die berufliche Lebenswelt liegen noch wenige Untersuchungen vor. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Erkenntnisse aus anderen Lebensweltenhierübertragbar sind.Die betriebswirtschaftliche Rentabilitäteiner Ausstattung mit Sozialkapitalistebenfallswenig untersucht. Analogschlüsse zu dergesamtwirtschaftlichenAnalyse legeneine solcheabernahe.[9]
Aus dem verbesserten Gesundheitsniveau der Mitarbeiter aufgrund der Ausstattung mit Sozialkapital ergäbe sichdemnachein regelmäßiger wirtschaftlicher Nutzen für das Unternehmen.
Dieser resultiert etwa aus verringerten Fehlzeiten der Mitarbeiter, deren Auswirkungen verhältnismäßig leicht in monetären Größen ausgedrückt werden können.
Im Ergebnis erhält das Unternehmen einen Anreiz zur Ausweitung des Sozialkapitals.Durch Investitionenin diesem Bereichprofitierendie Mitarbeiterin FormeinerVerbesserung ihres Gesundheitspotenzials. Somit entstehtunter Einbeziehung des Sozialkapitalsein gesundheitsförderlicher Zyklus (Abb.1).Dies ist eine Grundannahme der vorliegenden Untersuchung.
Abb.1:Gesundheitsfördernder Zyklus mit Sozialkapital
Win-win-Situation von Mitarbeitern und Betrieb.
Die Ausstattung eines Unternehmens mit Sozialkapital wirkt sich über den Mediator Mitarbeitergesundheit auf den Betriebserfolg aus,aberauch auf direktem Weg. Aus diesen Beziehungen entsteht für den Betrieb der Anreiz zur Ausweitung des Sozialkapitals, von der die Mitarbeiter durch gesundheitsfördernde Effekte des Sozialkapitals unmittelbar profitieren.
Hinsichtlich der Auswirkungen der Ausstattung der Mitglieder von Organisationen mit Sozialkapital auf deren Gesundheit sind zwei Wirkungsweisen zu unterscheiden:Eine direkte und eine indirekte. Auf indirektem Wege führt eine höhere individuelle Ausstattung mit Sozialkapital zu einer höheren materiellen Ausstattung, die sich – über verschiedene Zwischenstufen – in einem besseren Gesundheitsstatus niederschlägt. Die direkte Wirkung geht nicht über den Mediator materielles Kapital, sondern basiert auf einer Unterstützungsthese. Diese bezieht sich besonders auf das Netzwerkkapital. DerEinflusspositiv erlebter Beziehung auf das menschliche Gefühlsleben kann als ein gesicherter epidemiologischer Zusammenhang gesehen werden,[10]der nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in der Familieund der Freizeit auftritt. Einfrüher Ansatz zum Nachweis dieses Zusammenhangs ist die Hervorhebung der Bedeutung des Kohärenzgefühls von Individuen durch Antonovsky[11]. Zusammenhänge zwischen der individuellen Ausstattung mit Sozialkapital und dem Gesundheitsstand werdenauch aktuellempirisch berichtet.[12]Die Ausstattung mit Sozialkapital hat demnachper seeine Auswirkung auf denmenschlichenGesundheitszustand.
1.3Gang der Untersuchung
Im Rahmen der empirisch orientierten Untersuchung werden anhand von speziell erhobenen Daten in fünf Betrieben Zusammenhänge zwischen der Ausstattung mit Sozialkapital und dem Betriebserfolg ermittelt.
Imfolgenden Abschnitt(1.4) wird dargelegt, dass die Untersuchung einen Beitrag zur gesundheitswissenschaftlichen Forschung leistet. Dazu werden verschiedene Konzeptionen der Gesundheitswissenschaft referiert und die Inhalte und Methoden der Arbeitdarinverortet. Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Untersuchung von der Anlage her gesundheitswissenschaftlich ist, sich methodischallerdingszu einem großen Teil an der Schnittstelle zur Betriebswirtschaftslehre bewegt.
In Kapitel 2 wird der Begriff des Sozialkapitals beleuchtet. Exemplarisch werden die unterschiedlichen Verständnisse und Forschungsansätze sowie Paradigmata einiger wichtiger Vertreter der Sozialkapitalforschung und Sozialkapitalliteratur synoptisch widergegeben. Dabei zeigt sich, dass der Kernbegriff „Sozialkapital“ in der Forschungsliteratur sehr unterschiedlich gebraucht wird. Der Versuch einer Synthese mit den Mitteln der pointierend-hervorhebenden Abstraktion[13]mündet in einer Arbeitsdefinition für das Phänomen Sozialkapital die für die vorliegende Arbeit Gültigkeit beansprucht (Kapitel1).
Zur Konkretisierung der Fragestellung werden in Kapitel 5 ausgewählte empirische Ergebnisse aus der Literatur zusammengefasst, die sich mit der Bedeutung von Sozialkapital für die Gesundheit von Menschen befassen.Im Kapitel4.1werden dazu zunächst die nachgewiesenen Zusammenhänge in der allgemeinen Lebenswelt betrachtet.ImKapitel4.2werdenwerden Untersuchungen herangezogen, die sich auf den Arbeitskontext beziehenund aufgezeigt, dass die Auswirkungen der Ausstattung von Sozialkapital auch in der Lebenswelt Arbeitsplatz beobachtet werden können.
Im Kapitel 5 wird die Fragestellung vor dem theoretischen und empirischen Hintergrund nochmals reflektiert und konkretisiert. Es wird dargelegt, dass das Konzeptdes Sozialkapitals einen Erklärungsbeitrag für eine ganze Reihe drängender Probleme vornehmlich des Wirtschaftslebens leisten kann. Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt allerdings darin Anhaltspunkte dafür zu finden, ob sich Sozialkapital auf den Betriebserfolg auswirkt und somit ein eng gefasstes betriebswirtschaftliches Interesse an einer Ausstattung mit Sozialkapital besteht.
Demgemäß wird im Kapitel1das Konzept Sozialkapital auf seine Anschlussfähigkeit zu konventionellen betriebsökonomischen Denkmustern untersucht.
Im empirischen Teil der Arbeit (abKapitel1)werden die Hypothesen abgeleitet unddie verwendete Methodik der Zusammenhangsmessung erläutert.AnschließendwirddieStichprobeder Analysedargestellt. Dabei handelt es sich zum einen um die untersuchten Betriebe mit ihren Abteilungen, zum anderen um die Mitarbeiter der Betriebe. Für beide Bereiche werden statistische Basisdaten dargestellt.
Zur Ermittlung der Ausstattung der Betriebewirdeine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Dazu wird ein spezifisches Erhebungsinstrument als Fragebogen erstellt. In Kapitel1werden zunächst etablierte Instrumente von dritter Seite dargestellt, die für die Erstellung des Fragebogens herangezogen werden. Besonderer Wert wird dabei darauf gelegt, die paradigmatische Anschlussfähigkeit der verschiedenen Instrumente aufzuzeigen. Im weiteren Gangwerdeneigene Ergänzungen zu der Kompilation von Befragungsinstrumenten dargestellt sowie die Umsetzung der Mitarbeiterbefragung inden untersuchten Betriebenbeschrieben.
Dieweitere Datenerhebungbezieht sich auf Informationenzumwirtschaftlichen Erfolgder untersuchtenBetriebe(Kapitel 9). Zunächst werden im Abschnitt9.1unterschiedliche Zielstrukturen von Unternehmen diskutiert.In Abschnitt9.2wirdein begrifflichesVerständnisvonBetriebserfolgerarbeitet undes werdenImplikationen für die empirische Erhebung abgeleitet(Abschnitt9.3).
In Abschnitt9.4wird zunächst das InstrumentderKennzahlen zur Darstellung von Unternehmenszielen präsentiert und anschließend die Umsetzung in der Praxis der betrachteten Betriebe dargestellt. Als ein Mittel zur Gliederung der komplexen Datenlage wird die Balanced Scorecard verwendet. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Erfahrungen bei der Datenexploration inden untersuchtenBetrieben, die für die Anschlussforschung wichtig sein können.
Der Darstellung der beiden Formen der Datenexploration – Mitarbeiterbefragung und Ermittlung von Kennzahlen – schließt sich in Kapitel1die Datenanalyse an.
Analog zum Aufbau der gesamten Arbeit wird zunächst die befragungsimmanente Analyse von gesundheitlichen Auswirkungen der Ausstattung mit Sozialkapital durchgeführt. Dazu wird ein strukturbildendes Verfahren dargestellt und angewandt. Kern derDatenanalyse ist die Zusammenführung von Daten aus der Mitarbeiterbefragung, die Aufschluss über die Ausstattung mit Sozialkapital gibt, und der Kennzahlenermittlung, vonAussagenüber den Betriebserfolgermöglicht. Dazu wird in Abschnitt10.2das methodische Vorgehen imLinkage Researchdargestellt und die Analyse durchgeführt.
Ein mögliches Vorgehen zur genaueren Abschätzung wirtschaftlicher Effekte wird in Kapitel1dargestellt. Einige weitere Forschungsdesiderate, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht bearbeitet werdenkönnen, sind in Kapitel1zusammengetragen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung (Kapitel1).
1.4Gesundheitswissenschaftlicher Bezugder Arbeit
Der Charakter der Gesundheitswissenschaft als interdisziplinäre Wissenschaft bringt es stets mit sich, dass zugleich ein enger Bezug zu anderen, nicht primär gesundheitswissenschaftlichen Disziplinen besteht.Insofern ist die Frage nach dem gesundheitswissenschaftlichen Bezug einer Forschungsarbeit niemals eindeutig zu beantworten. Stets kann das Für und Wider eine Zuordnung zur einen oder anderen Disziplin diskutiert werden: Passt das Forschungsvorhaben nicht besser zur Medizin, passt es nicht besser zur Psychologie, Pädagogik oder Betriebswirtschaft?
1.4.1Was heißt Gesundheitswissenschaft?
Die Etablierung der Gesundheitswissenschaften als Fachdisziplin kann als eine Weiterentwicklung von Forschungsparadigmata im Sinne von Lakatos[14]betrachtet werden. GemäßdieserSichtweiseistfestzustellen, dass einehistorische,ausschließlichmedizinische Betrachtungsweise nur bedingt die gesundheitlichen Probleme der Gegenwartzu lösen vermag.Ähnliche Entwicklungen sind in der Vergangenheitbei der Entstehung der DisziplinenHygiene und Sozialmedizin zu beobachten gewesen,durch diejeweils eine Antwort auf drängende gesundheitliche Fragen gesucht wurde.
Ähnlich verhält es sich bei der Entwicklung einerGesundheitswissenschaft, die sich aktuellen Problemen stellen will.Ein zentraler Aspekt ist dieVerlagerung des Krankheitsspektrums,an demdie Erfolge der MedizinihrenAnteil haben.Viele Infektionskrankheiten sindheuteheilbar.Deshalbverlagert sich der Fokus aufKrankheiten, diemedizinisch– mit einerrein somatischenVorgehensweise–auch heute noch nur schwer zutherapieren sind. Hinzu kommt eine Alterung der Gesellschaft, die zu veränderten Beschwerdemustern führt, die tendenziell weniger von einzelnen abgegrenzten Störungen charakterisiert sind, sondern von multiplen Beeinträchtigungen in Verbindung mit altersbedingt sinkender Leistungsfähigkeit. Solche Beschwerdemuster sind einer vollständigen Heilung oft nicht zugänglich. Durch Veränderungen in den Kontextfaktoren[15]können Betroffene dennoch wesentliche Hilfe erhalten.
Spätestens seit der Einigung über die Inhalte des Gesundheitsbegriffs in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1946bestehtein allgemeines Verständnis über den Begriff Gesundheit alsein„Zustand des vollständigen körperlichen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen“[16]. Ein solches Gesundheitsverständnis impliziert jedoch die Notwendigkeit ständiger Bemühungen um den Erhalt von Gesundheit, denn Gesundheit ist in diesem Sinne ein Prozess, der nicht über fließende Grenzen zwischenkrankund damit interventionsbedürftig undgesundund somit nicht interventionsbedürftig unterscheidet. Auch gesundheitlichenBeeinträchtigungen unterhalb der Schwelle einer therapeutisch-medizinischen Intervention ist demnach entgegenzutreten. An diesem Verständnis hält die Weltgesundheitsorganisation in ihren offiziellen Erklärungen weiterhin fest, nach der Ottawa-Charta aus dem Jahre 1986[17]zuletztin der Jakarta Deklaration von 1997[18]. Hier wird festgehalten, dass Einkommen und Soziale Beziehungen zu den Grundvoraussetzungen für Gesundheit gehören.[19]Zugleich wird die Bedeutung desSetting-Ansatzeshervorgehoben,[20]bei demauchdie Lebenswelt Betrieb eine wichtige Rolle spielt.
Bei einem umfassenden Verständnis des Gesundheitsbegriffs erscheinen Interventionen innerhalb der Lebenswelt Betriebaus der Sichtder Weltgesundheitsorganisation gebotenum Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Angemessene soziale Beziehungen sindaußerdemeine Grundvoraussetzungzum Erhalt von Gesundheit.Dies sind beides Aspekte, denen in dem vorliegenden Forschungsvorhaben nachgegangen wird.
Ein Forschungsvorhabengilt alsgesundheitswissenschaftlich, wenn es sich inhaltlich mit einer Fragestellung der Gesundheitswissenschaften befasst und zu deren Bearbeitung interdisziplinär vorgeht. Das heißt,dassfür jede Fragestellung und Teilfragestellung dieihrangemessene Methodik verwendetwerden soll.
Somit ist jedes gesundheitswissenschaftliche Forschungsvorhaben notwendigerweise interdisziplinär, wenngleich sich aus der Person und den spezifischen Kenntnissen des Forschers heraus Schwerpunktsetzungen ergeben. Ein einzelner Forscher oder ein Gruppe von Forschern kann selbstverständlich nicht alle Disziplinen der Gesundheitswissenschaften gleichermaßen überschauen. Allerdings sollten die für die spezifische Fragestellung relevanten Methoden berücksichtigt werden.
Die Gesundheitswissenschaft verfügt also gegenwärtigwenigerüber eigene methodische Verfahren, sondern hebt sich unter den Wissenschaftenvielmehrdurch eine systematische Interdisziplinarität heraus. Die Einzeldisziplinen haben nicht den Charakter einer Hilfswissenschaft für die Gesundheitswissenschaften, denn dafür wäre eine spezifische Gesundheitswissenschaft notwendig. Hilfswissenschaftenwärenin diesem Zusammenhang solche Wissenschaften, die für eine der beteiligten Einzeldisziplinen eine Hilfswissenschaft sind.
Hurrelmann, Lazer undRazum[21]unterteilen die für die Gesundheitswissenschaft maßgeblichen Einzeldisziplinennachihrer Nähe zuzwei grundsätzlichen Paradigmata, die außerhalb der Gesundheitswissenschaften bisher in eher geringen Austausch getreten sind, dem „medizinisch-naturwissenschaftlichen Paradigma“ und dem „sozial-verhaltenswissenschaftlichen Paradigma“. Eine grafische Darstellung der Disziplinen findet sich inAbb.2.Im Zentrum derDarstellungstehen zwei methodische Disziplinen: die Epidemiologie und die Empirie.Die Aufgabe der Epidemiologie ist diedie Untersuchung der Verteilung von Morbidität in der Bevölkerungundderihrzugrundeliegenden Bedingungen sowie die Messung von Interventionseinflüssen auf die Verbreitung und Entwicklung von Krankheiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Unterdem Begriff„Empirie“wirdin der Grafik dieempirische Sozialforschungverstanden, mit der Kausalitätsbeziehungen untersucht werden. Für diese ist zum Beispiel die StatistikeineHilfswissenschaft: Für die Arbeit der empirischen Sozialforschungist dieseheute unverzichtbar,doch eshandelt sich nicht um eine Einzeldisziplin der Gesundheitswissenschaften, da sie keinen eigeneninhaltlichenBeitragdazuleistet.
Um diese methodischen Disziplinen herum gruppieren Hurrelmann et al.die einzelnen Fachdisziplinen, die sie nach den genannten Paradigmata in zwei Hauptgruppen gliedern. Diese Gliederungerfolgt weniger aufgrund inhaltlicher Kriterien, sondern vielmehr aufgrundhistorisch bedingterAnimositäten, die im Rahmen der Gesundheitswissenschaften überwunden werden sollen. Es handelt sich dabei zum einen um Wissenschaften mit medizinisch-naturwissenschaftlichem, zum anderen um solche mit sozial- und verhaltenswissenschaftlichemSchwerpunkt.
Gemäß dieser Einteilung ist dasvorliegendeForschungsvorhaben ein gesundheitswissenschaftliches, das sich vorwiegend im Rahmen des sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Paradigmas bewegt. Schwerpunkte liegen gemäß dieser Gliederung in den EinzeldisziplinenderGesundheitsökonomie,derOrganisations- und Managementwissenschaften,derSozialmedizin sowiederArbeits- und Umweltmedizin.
Abb.2:Die zentralen fachlichen Einzeldisziplinen der Gesundheitswissenschaften[22]
Vehrs und Schnabel[23]beurteilen die Relevanz derverschiedenen Teildisziplinen der Gesundheitswissenschaftenim Hinblick auf dieGesundheitswissenschaften als Gesamtdisziplinunterschiedlich. Hier stehen Sozialepidemiologie und Soziologie im Zentrum der wissenschaftlichen Disziplinen, die einen Beitrag zu den Gesundheitswissenschaften liefern. Medizin, Psychologie und Ökonomie gehören auch hier zum inneren Zirkel der Wissenschaften, die einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtwissenschaft leisten, von ihnen wird jedoch ein tendenziell geringerer Beitrag für die Kernfragestellungen des Fachs erwartet. Dennochwerden sie als Grundlagenwissenschaften verstanden.
Anderen Wissenschaften kommtnach Vehrs undSchnabelin Bezug auf die Gesundheitswissenschafteneine untergeordnete Funktion zu. So auch der Betriebswirtschaft, die im hier diskutierten Forschungsvorhaben eine wichtige Rolle spielt. Sie wird neben anderen Wissenschaften zwar zu den relevanten Wissenschaften gerechnet, steht jedoch mit am Rande und wird als „Ergänzungswissenschaft“ bezeichnet(s.Abb.3).
Abb.3:Die Gliederung dergesundheitswissenschaftlichenDisziplinen[24]
1.4.2Ist die bearbeitete Fragestellung eine gesundheitswissenschaftliche?
Die Untersuchung gliedert sich in eine Reihe von Komponenten, von denen einige einen klassischen Bezug zur Gesundheit von Menschen haben; bei anderen Komponenten liegt das gesundheitswissenschaftliche Interesse darin, dass eine Vereinbarkeit gesundheitlicher Präventionsziele mit nicht-gesundheitswissenschaftlichen Rationalitäten dargestelltwird.
Im Rahmen des gesundheitsförderlichen Zyklus im Unternehmen (s.Abb.1, S.17)wird auf der Grundlage gesundheitswissenschaftlicher Rationalitäten von einer Auswirkung des Sozialkapitals auf die Gesundheit von Mitarbeitern ausgegangen. Darüber hinaus werden betriebswirtschaftliche Auswirkungen des Gesundheitszustandes von Mitarbeitern auf den Betriebserfolg postuliert.Außerdem betrachtet werdendie unmittelbaren Auswirkungen des Sozialkapitals auf den Betriebserfolg ohne Beteiligung des Mediators Mitarbeitergesundheit. Diesefolgen einer nicht primär gesundheitswissenschaftlichen Rationalität. Die hier verfolgte Rationalität ist betriebswirtschaftlich, folgt einem angenommenen ökonomischen Paradigma und ist einzelwirtschaftlich ausgerichtet. Dieser Teil der Untersuchung ist ökonomisch, weil von rational handelnden und nutzenmaximierenden Entscheidern in der Unternehmensleitung ausgegangen wird. Dabei werden einige Verhaltensannahmen getroffen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um methodologischen Individualismus,systematische Reaktionenauf Anreize, Trennung zwischen Präferenzen und Einschränkungen sowie Eigennutzorientierung.[25]Sogarder postulierte Zusammenhang zwischen der Ausstattung eines Betriebes mit Sozialkapital undderMitarbeitergesundheit unterstellt letztlich ökonomische Rationalität seitens der Mitarbeiter,dadieseein Interesse am Erhalt ihrer Gesundheit haben.
Die Gesundheitswissenschaft zeichnet sich als interdisziplinäre Wissenschaft nicht durch eine spezielle Methodik, sondern durchihrenErkenntnisgegenstand aus. Somit ist die Frage nach dem gesundheitswissenschaftlichen Bezug der Forschungsarbeit aufihreInhalte zu beschränken. Die wichtige Beurteilung, ob die gewählte Forschungsmethode letztlich zielführend und angemessen ist,erfährt ihre Bewertung durch die Wahl der angemessenen gesundheitswissenschaftlichen Disziplin.
Dievorliegende Untersuchungsetzt sich unter Forschungsgesichtspunkten aus mehreren Komponenten zusammen,für dieder gesundheitswissenschaftliche Bezugeinzelnuntersucht werden kann. DiefünfHauptkomponenten sind
Messung der Ausstattungvon Betriebenmit Sozialkapital.Nachweis eines Zusammenhangs zwischendemSozialkapitalvon BetriebenundderGesundheit von Mitarbeitern.Messung der Abteilungsergebnisse in Betrieben.Zusammenführung der Messungen.Betriebswirtschaftliche Bewertung der identifizierten Zusammenhänge.Aus den verschiedenen Komponenten der Untersuchung ergibt sich ein Methodenmix, bei dem für jede Komponente die angemessene Methode zur Anwendung kommt. Gemäß der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen Komponenten für die Gesamtuntersuchung werden dabei Schwerpunkte gesetzt,wasdem interdisziplinären Ansatz jedoch nicht zuwiderläuft
Im Folgenden werden die Inhalte der jeweiligen Komponenten rekapituliert und diegewählteMethode dargestellt.
ad 1: Messung der Ausstattung mit Sozialkapital
Ziel ist die Ermittlung der abteilungsbezogenen Ausstattung mit Sozialkapital in Betrieben. Diese wird fragebogengestützt erhoben. Das Fragebogeninstrument ist eineZusammensetzung aus verschiedenen validierten Erhebungsinstrumenten, die übernommen werden.
DieseUntersuchung ist eindeutig empirisch. Die zugrundeliegendeAnnahme– nämlich die Existenz eines KonstruktsSozialkapital–ist psychologisch. Um die Arbeit nicht ausufern zu lassen wird die psychologische Wirkungsweise von Sozialkapital allerdings nicht weiter verfolgt. Für die Fragestellung ist es ausreichend, die Tatsache eines Zusammenhangs festzustellen.
Die einschlägige Teildisziplin istdiePsychologie, insbesonderedieArbeits- und Organisationspsychologie in der Lebenswelt Unternehmen. Nach Hurrelmann et al.[26]handelt es sich dabei um eine einschlägige Teildisziplin der Gesundheitswissenschaften.Der Betrachtungsgegenstand ist dabei abgeleiteter Natur. Die inhaltliche Relevanz hinsichtlich der Gesundheit im engeren Sinne erhält er im Rahmen der nachfolgenden Komponente.
ad 2: Nachweis eines Zusammenhangs zwischen der betrieblichen Ausstattung mit Sozialkapital und der Gesundheit von Mitarbeitern
Ziel dieser Komponente ist der Nachweis eines epidemiologischen Zusammenhangs zwischen der Ausstattung mit Sozialkapital im Unternehmen und der Gesundheit von Mitarbeitern.
DieserNachweiserfolgt auf zwei Ebenen. Einerseits durch die Übertragung epidemiologischer Erkenntnisse aus anderen Lebenswelten auf die Lebenswelt Arbeitsplatz. Im Rahmen der Vorarbeiten zu dieser Übertragungsleistung erfolgt auch die Hypothesenbildung. Die eigentliche Überprüfung dieser plausiblen Kausalitätsbeziehung erfolgt durch Analyse des im Rahmen der Fragebogenerhebung berichteten Gesundheitszustandesder Mitarbeiter, der zur Ausstattung mit Sozialkapital in Beziehung gesetzt wird. Erwartbar ist hier der Nachweis eines Zusammenhanges, weniger der Nachweis einer kausalen Beziehung. Die Kausalitätsbeziehung ist somit im Rahmen der Übertragungsleistung aus anderen Settings zu begründen.
EinschlägigeTeildisziplinen sind die Epidemiologie und die Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin. Diese medizinischen Teildisziplinen stehen von jeher mit im Mittelpunkt der Gesundheitswissenschaften. Daneben kommen im Rahmen der empirischen Sozialforschung uni- und multivariate statistische Verfahren als Hilfswissenschaft zur Anwendung.
ad 3: Messung der Abteilungsergebnisse in Betrieben
Ziel dieser Komponente ist die abteilungsbezogene Erfolgsmessung im Betrieb.
Dies erfolgt durch die Identifikation geeigneter Kennzahlen in denverschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen wie Controlling, Rechnungswesen, Personalwesen und Produktionssteuerung.
Einschlägige Teildisziplinen sind besonders die Betriebswirtschaft und daneben die Organisations- und Managementwissenschaft. Die Erfolgsmessung in Betriebengehört sicherlich nicht zu den gesundheitswissenschaftlichen Kerndisziplinen. Der gesundheitswissenschaftliche Bezug liegt hiereinzigin der Notwendigkeit der Datengenerierung,um gesundheitswissenschaftliche Schlüsse ziehen zu können. Das Vorgehen im Rahmen dieser Komponente ist insofernauch über den Rahmengesundheitswissenschaftlicher Interdisziplinaritäthinausinterdisziplinär.
ad 4: Zusammenführung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Das Zieldieser schlussfolgernden Komponente ist die Zusammenführung der gesundheitswissenschaftlichen mit den betriebswirtschaftlichenDaten.Dies erfolgt wiederum unter Verwendung der Hilfswissenschaft Statistik, aus der uni- und multivariate Verfahren zur Anwendung kommen.
Einschlägig in dieser Komponente sindwichtigeTeildisziplinen der Gesundheitswissenschaften, nämlichdiePsychologie, insbesonderedieArbeits- und Organisationspsychologie,dieEpidemiologie unddieArbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin. Darüber hinaus erfolgt eine interdisziplinäre Arbeit über die gesundheitswissenschaftlichen Teildisziplinen hinaus, die sich auf die Betriebswirtschaft erstreckt. Der Statistik kommt der Rang einer bedeutenden Hilfswissenschaft zu.
ad 5: Betriebswirtschaftliche Bewertung der identifizierten Zusammenhänge
Ziel dieserallerdings nurin Ansätzen behandeltenKomponente ist die Darlegung einer ökonomischen Quantifizierbarkeitder identifizierten Zusammenhänge. Da der Rentabilität innerhalb der betriebswirtschaftlichen Rationalität die entscheidende Rolle zukommt, wird hier dargelegt, ob und in welchem Umfang sich die Auswirkungen der Ausstattung mit Sozialkapital in finanzieller Größe darstellen lassen.
Im Rahmen dieser Komponente kommen vorwiegend betriebswirtschaftliche Methoden zur Anwendung. Der gesundheitswissenschaftliche Bezug liegt hier in der Überprüfung der Vereinbarkeit gesundheitswissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Rationalitäten. Letztlich handelt es sich bei der Durchführung dieser Komponente also um einen ergebnisbezogenen Methodenvergleich.
Aus den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Zusammenhängen des Themas wird die Lebenswelt Arbeitsplatz als Ausschnitt herausgegriffen.Es stellt sich die Frage, ob dieser Ausschnitt von gesundheitswissenschaftlicher Erheblichkeit ist. Diese Frage lässt sich letztlich erst im Nachhinein beantworten. Mit Max Weber kann argumentiert werden, dass sich die Gesichtspunkte, unter denen ein Gegenstand untersucht wird, nicht aus dem Stoff selbst ergeben, sondern den Gesichtspunkten des Interesses folgen. Der Untersuchungsgegenstand und die Verfolgung des Regress seien von den „Wertideen“ des Forschers bestimmt. Im Erfolgsfalle ist der Nachweis erbracht, dass die Gesichtspunktwahl offensichtlich nicht „willkürlich“ erfolgte.[27]Die Gesichtspunkte sind hier die Schwerpunktsetzung auf das Sozialkapital und die Lebenswelt Betrieb. Die Frage, ob die Gesichtspunktwahl im vorliegenden Fall letztlich ertragreich war, wird in den letzten Kapiteln der Untersuchung beantwortet werden können.
1.5Zusammenfassung
Die untersuchte Fragestellung ist eine gesundheitswissenschaftliche.Für das Verständnis von Gesundheitswissenschaften wurdedabeiauf die Definitionen von Hurrelmann et al., Vehrs und Schnabel sowie der Weltgesundheitsorganisation rekurriert, aus denen ein Gesamtrahmen gebildet wurde.
Der gesundheitswissenschaftliche Bezug des Forschungsvorhabens kennzeichnet sich besondersdadurch, dass eineganze Reihe gesundheitswissenschaftlicher Kerndisziplinenherangezogen werden, die um die Hilfswissenschaft Statistik ergänzt werden. Daneben ist ein starker betriebswirtschaftlicher Bezuggegeben, der den gesundheitswissenschaftlichen Rahmen im engeren Sinneteilweisesprengt. Der gesundheitswissenschaftliche Bezug liegt hier auf zwei Ebenen. Zum einen ist ein betriebswirtschaftliches Vorgehen notwendig, um die benötigten Daten zur Analyse zu generieren.Insofern findet dieses Vorgehen im Rahmen eines gesundheitswissenschaftlichen Interesses statt und gewinnt dadurch in dieser Studie den Charakter der Interdisziplinarität, die die den Gesundheitswissenschaften inhärente Interdisziplinarität erweitert.Zumanderenspielt die Betriebswirtschaft eine Rolle bei demVergleichder Ergebnissehinsichtlich desHandelnsnach gesundheitswissenschaftlichen beziehungsweise betriebswirtschaftlichen Rationalitäten. Hier wird im Ansatz ein Wissenschaftsvergleichverfolgt, allerdings mit einem strengen und anwendungsbezogenen Gesundheitsbezug.
2Sozialkapital
Soziale Beziehungen haben einen augenscheinlichen Einfluss auf die Werte unddasVertrauenvon Menschen, auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Ländern und Regionenundauf ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten in Unternehmen und Volkswirtschaften.Unter sozialpsychologischer Betrachtungsind siemaßgeblich für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen.Es istnicht erstaunlich, dassdasKonzeptdes Sozialkapitals,das all diese Aspekte umfasst,verhältnismäßig rasch Popularität in der Wissenschafterlangte.[28]Finestellt sogar fest, die Sozialtheorie sei unter dem erkenntnisleitenden Aspekt des Sozialkapitals neu gefasst worden.[29]In der Tat erscheint das Konzept für viele Untersuchungen erkenntnisfördernd. Der Wissenschaft und Gesellschaft stellen sich viele Fragen, die mit einer Vorstellung von Sozialkapital beantwortet werden könnten. Fast ebenso vielfältig wie die zu bearbeitenden Fragestellungen erweist sich dasVerständnisdarüber, was Sozialkapital denn sei. Die Weltbankgabein umfassendesKompendium zu der Thematik Sozialkapital heraus, das denTitel„A Multifaceted Perspective“[30]– eine vielseitige oder facettenreiche Perspektive– trägt.
DasKonzept vom Sozialkapitalhat aufgrund seiner hohen Plausibilitätrasch einegroßeVerbreitung erlangt. Häufig wird der Begriff dabei als eine mehr oder weniger unbestimmte Metapher verwendet, mit der die Bedeutung sozialer Beziehungen für die Handlungen von kollektiven und individuellen Akteuren hervorgehoben werden soll.[31]Unter dem Begriff firmiert eine ganze Reihe unterschiedlicher Vorstellungen und Herangehensweisen.[32]
2.1Begrifflichkeiten und Konzepte
Das teilweise unterschiedliche Verständnis der Autoren bringt es mit sich, dassdas jeweils verwendete Sozialkapitalkonstruktin jeder Studie explizit zu machen ist.[33]Häufig unterbleibt dies allerdingsund eswird eher implizit auf eines der etablierten Konzepte rekurriert, dasjedochungenannt bleibt und durch eigene Ergänzungen des jeweiligen Autors erweitert wird. Eine Folge ist, dass Studien und Essays zum Sozialkapital kaum vergleichbar sind. Besonders deutlich wirdder Definitionsbedarfwenn das Vorhandensein von Sozialkapital gemessen werden soll.Aus diesem Grund solldas Verständnis von Sozialkapital auch für die vorliegende Untersuchung näher erläutert werden.Das Verständnis von Sozialkapital fürdiedie vorliegende Untersuchung wird in Kapitel1expliziert.
In den folgenden Abschnitten wird das Verständnis einiger klassischer Autoren zum Sozialkapital dargestellt. Die Auswahl der Autoren erfolgte dabei zum einen nach ihrer Bedeutung und Bekanntheit für das Sozialkapitalkonzept,andererseits sollten Ansätze dargestellt werden.
Um in der verwirrenden Fülle der Konzepte eine gewisse Übersichtlichkeit zu ermöglichen, werden die verschiedenen Autoren nach einem standardisierten Raster behandelt. Überschrieben wird der Absatz mit dem Namen des Autors. Aus mnemotechnischen Gründen wird dieser um einige wenige Schlagworte ergänzt, diegegebenenfalls ausgeführtwerden. Es folgt(1)eine Definition des Sozialkapitalbegriffsim Wortlaut der jeweiligen Autoren, der zum besseren Verständnis ggf.miteinigenErläuterungenergänzt wird.Anschließendwerden(2) die betrachteten Konstrukte, auf die sich der Autor vornehmlich bezieht, dargestellt.Danach wird(3) die Stellung von Sozialkapital im Kausalzusammenhang des jeweiligen Theoriekonstruktserläutert. Dem schließt sich (4) die Nennung der jeweiligen bevorzugten Analyseebenen des Autors an. Anschließend wird (5) eine Bewertung des Ausmaßes der theoretischen Fundierung vorgenommen.Im Folgenden wird erläutert, was sich hinter den fünf Schritten verbirgt.
(1)Definition
Die Definition im Wortlaut gibt in der Regel zugleich Auskunft über die betrachteten Konstrukte und damit die verwendete Begrifflichkeit.
(2)Konstrukte und Operationalisierungen
Im Abschnitt Konstrukte wird die Definition ggf. um standardisierte Bezeichnungen für die betrachteten Konstrukte und Phänomene ergänzt. Hierzu gehören auch vorgeschlagene Operationalisierungen[34]zum Sozialkapital, sofern durch den jeweiligen Autor ein Ansatz zur Messung der qualitativen oder quantitativen Ausprägung von Sozialkapital geliefert wird.
(3)Stellung im Kausalzusammenhang
Über die Wirkungszusammenhänge von Sozialkapital, über Ursachen und Folgen besteht zwischen den Konzepten und teilweise auch innerhalb der Konzepte Uneinigkeit. Dies gilt sowohl in der theoretischen Betrachtung als auch in praktischen Wirkungszusammenhängen. So kann ein Aspekt des Sozialkapitals etwa eine Folge von Sozialstrukturen sein, die gegebenenfalls auch nur mittelbar beobachtet werden. Gelegentlich wird das Sozialkapital aber auch mit dem Netzwerk gleichgesetzt oder das Netzwerk an sich als das Sozialkapital der Akteure verstanden. Gelegentlich folgt aus dem Vorhandensein von Sozialkapital auch ein kollektiver Mehrwert, manchmal wird auchvondiesem auf das Vorliegen von Sozialkapital geschlossen.[35]Diese Zusammenhänge werden von den Autoren häufig nur angedeutet.
(4)Analyseebene
Gelegentlich werden die Sozialkapitalkonzepte aus empirischen Beobachtungen der Autoren abgeleitet. Diese können sich auf unterschiedliche Aggregate und Settingsbeziehen. Dies gilt selbstverständlich auch für rein theoriegeleitete Konzepte. So kann der Schwerpunkt etwa wie in der vorliegenden Untersuchung auf Wirtschaftsunternehmen gelegt werden, die wiederum in der Mikro-, Meso- und Makroebene betrachtet werden können. Weitere Beispiele sind die Betrachtung ganzer Volkswirtschaften oder einzelner gesellschaftlicher Gruppierungen.
(5)Ausmaß der theoretischen Fundierung
Den betrachteten Konzepten ist es gemeinsam, dass das Sozialkapital als ein wichtiges erkenntnisleitendes Paradigma verwendet wird. In diesem Abschnitt wird dargestellt, ob für das betrachtete Konzept eine theoretische Fundierung festgestellt werden kann.[36]Diese kann entweder explizit durch den Autor dargestellt worden sein oderaus denAusführungenistein impliziterRückgriff auf bekannte Theorieschulen ableitbar. Diesesindzum Beispielan der Verwendung spezifischer Begriffe erkennbar.[37]
2.1.1Bourdieu
Schlagworte
Ressourcencharakter von Sozialkapital, Netzwerke und soziale Ungleichheit.
Das Konzept hat umfassende Verbreitung erlangt und kann als das am weitesten verbreitete angesehen werden.
Definition
„Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisiertenBeziehungengegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.“[38]
„[...] der Begriff des Sozialkapitals ist nicht aus einer rein theoretischen Arbeit entstanden, noch weniger als eine analoge Ausweitung ökonomischer Begriffe. Vielmehr hat er sich angeboten zur Benennung desPrinzips sozialer Wirkungen,von Wirkungen also, die zwar auf der Ebene der individuell Handelnden – wo die statistischen Erhebungen sich zwangsläufig bewegen – klar erfassbar sind, ohne sich jedoch auf die Summe von individuellen Eigenschaften bestimmter Handelnder reduzieren zu lassen. Diese Wirkungen, die von der Spontansoziologie gerne als das Wirken von ‚Beziehungen‘ identifiziert werden, sind in all den Fällen besonders gut sichtbar, wo verschiedene Individuen aus einem etwa gleichwertigen (ökonomischen oder kulturellen) Kapital sehr ungleiche Erträge erzielen, und zwar je nachdem, inwieweit sie in der Lage sind, das Kapital einer mehr oder weniger institutionalisierten und kapitalkräftigen Gruppe (Familie, Ehemalige einer ‚Elite‘-Schule, vornehmer Club, Adel usw.) stellvertretend für sich zu mobilisieren.“[39]
Konstrukte und Operationalisierungen
Zur Erklärung der makrosoziologischen sozialen Ungleichheit legt Bourdieu eine streng makrosoziologisch orientierte Kapitaltheorie vor. Die Bildung von Sozialkapital setzt demnach ständige Tauschbeziehungen voraus,[40]die mit Investitionscharakter Ressourcen verbrauchen. Es kann akkumuliert werden, sein Wert steigt überproportional: Die Beziehungen, die das Sozialkapital ausmachen, steigen exponentiell. Sozialkapital kann in andere Kapitalarten transformiert werden. Operationalisieren lässt sich der Begriff in der Darstellung sozialer Netzwerke.
Stellung im Kausalzusammenhang
Sozialkapital ist im Kausalzusammenhang zugleich Explanans und Explanandum.Zentrales Element des Konzepts ist die Netzwerkbildung. Ein bestehendes Netzwerk ist leicht zu vergrößern, da der Wert hinzukommender Relationenexponentiellsteigt.
Analyseebene
Die Analyseebene ist makrosoziologisch. Bourdieu betrachtet vorzugsweise gesamte Gesellschaften.
Ausmaß der theoretischen Fundierung
Das Konzept ist theoretisch fundiert,aberempirisch nicht umfassend untersucht. Eswurdededuktiv aus qualitativer Sozialforschungsarbeit abgeleitet. Bourdieu geht stark reflexiv vor, das heißt die empirische Forschungsarbeit ist theorieleitend. Er warnt jedoch dezidiert vor Theoriehuberei,die er als Gefahr der „überall zu beobachtenden und immer schärfer werdenden Trennung von Theorie und empirischer Forschung, von der auch die Parallelentwicklung von methodologischerPerversionund theoretischer Spekulation lebt“[41]betrachtet.
SeinemKonzeptliegteine umfassende Kapitaltheorie zugrunde. Sozialkapital wird als Netzwerkkapital und somitalsdiequalitätsadjustierteAnzahl sozialer Beziehungen aufgefasst. Bourdieu verwendet das Konzept in etlichen qualitativen Untersuchungen.
2.1.2Coleman
Schlagworte
Freiwilliger Aufbau von Vertrauensbeziehungen, die zu ihrer Festigung sozialer Normen bedürfen.ZugrundeliegendeModellannahmen sindRational Choice und Tauschtheorie.
Definition
„Soziales Kapital wird durch seine Funktion definiert.Es ist kein Einzelgebilde, sondern ist aus einer Vielzahl verschiedener Gebilde zusammengesetzt, die zwei Merkmale gemeinsam haben. Sie alle bestehen nämlich aus irgendeinem Aspekt einer Sozialstruktur, und sie begünstigen bestimmteHandlungen von Individuen, die sich innerhalb der Struktur befinden. Wie andere Kapitalformen, ist soziales Kapital produktiv und ermöglicht die Erreichung von Zielen, die ohne es nicht erreichbar wären.[...]Anders als andere Kapitalformen wohnt soziales Kapital den Beziehungsstrukturen zwischen zwei und mehr Personen inne.“[42]
Konstrukte und Operationalisierungen
Coleman beginnt seine Analyse mit der Darstellung derBildungvon Herrschaftsprozessen, die ihren Anfang darin nehmen,dassein Akteur seine Handlungsmacht freiwillig an einen andern überträgt, da er seine Interessen so besser gewahrt sieht. Dabei sieht er eine Agency-Problematik, diedurch das Konstrukt einerreziprokenVertrauensbeziehung überwunden,[43]aberauch enttäuscht werden kann. Eine solche Enttäuschung kann durch längerfristige Austauschbeziehungen vermieden werden. Einmalige Vertrauensbrüche können diese Austauschbeziehungen nachhaltig schädigen. Daher entsteht ein Bedürfnis nach Kontrolle und Sanktion abweichenden Verhaltens. Dieses istnach Colemanein wesentliches Element des Sozialkapitals.
Stellung im Kausalzusammenhang
Sozialkapital ist im Kausalzusammenhang originär Explanandum. Durch Aggregation von Akteuren tritt es auch als Explanans auf. Zentrales Element ist dieBildungvon Vertrauen sowie nachfolgendvon sozialen Normenzur Reziprozitätssicherung.
Analyseebene
Im Ausgang ist die Analyse streng mikrosoziologisch. Im weiteren Verlauf werden jedoch auch Handlungskollektive betrachtet, die sich aus dem freiwilligen Zusammenschluss von Einzelsubjekten ergeben. Somit legt Coleman eine Grundlage für wechselnde Betrachtungen verschiedener Aggregationen. Sein Vorgehen wird daher häufig als eine „Mikro-Makro-Modellierung“[44]charakterisiert.
Ausmaß der theoretischen Fundierung
Colemans Theorie basiert auf einem Markttauschprozess rationaler Akteure.[45]Primär ist sie daher nur auf freiwillige Tauschprozesse anwendbar. Coleman liefert auch Vorschläge zur mathematischen Formalisierung dieser Austauschprozesse.[46]Sein Modellkann daher alstheoretischausgebaut betrachtet werden. Angreifbar istesvor allem hinsichtlich der restriktiven Annahme rationaler und nutzenmaximierender Akteure. Dieses Defizit kommt besonders in den mathematischen Modellen zum Tragen.
2.1.3Fukuyama
Schlagworte
Implizite Darstellung.
Definition
”Social capital can be defined simply as an instantiated set of informal values or normsshared among members of a group that permits them to cooperate with one another. If members of the group come to expect that others will behave reliably andhonestly, then they will cometotruston another. Trust acts like a lubricant that makes any group or organization run more efficiently.”[47]
Konstrukte und Operationalisierungen
Sozialkapital ermöglicht in diesem Sinne dieHerausbildung von Gruppen ohne formalisierte Vertragsbeziehungen und damit die Einsparung von Transaktionskosten.Fukuyama bleibt mit seiner stark auf Normen- und Wertebildung ausgerichteten Argumentation originär,weiler Netzwerke nicht als dem Sozialkapital per se zugehörig betrachtet,sondernnur die gemeinsamen Werte und Normendarunter fasst.
Stellung im Kausalzusammenhang
Die Stellung im Kausalzusammenhang bleibt bei Fukuyama inkonsistent. Zum einen ist Sozialkapital eine abhängige Variable, die durch das Vertrauen, das in einer Gesellschaft besteht, gebildet wird. An anderer Stelle ist es wiederum eine unabhängige oder intervenierende Variable, die – in seiner Ausprägung kulturell bedingt – den Zustand einer Volkswirtschaft maßgeblich gestaltet.[48]
Analyseebene
Dashauptsächliche Augenmerk Fukuyamasliegt auf der Makroebene: Primär verwendet er das Konstrukt zur Erklärung von wirtschaftlicher Prosperität. Die Mikro- und Mesoebene kommen nur im Verlauf der Argumentation zum Tragen.
Ausmaß der theoretischen Fundierung
Fukuyama vermeidet eine explizite theoretische Festlegung und sein Sozialkapitalkonzept bleibt somit selbst in seinem Hauptwerk[49]vage.Sein Ziel war es, denjenigen Teildes wirtschaftlichen Handelnszu erklären, den die neoklassische Ökonomie nicht zu erklären vermag.[50]
2.1.4Putnam
Schlagworte
Reziprozität und Vertrauen in Netzwerken.
Definition
“By ‘social capital’ I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act more effectively to pursue shared objectives. [...] Social capital, in short, refers to social connections and the attendant norms and trust.”[51]
Konstrukte und Operationalisierungen
Die Analysekonstrukte Putnams sind Normen und Netzwerke. Das Vorhandensein von Normen an sich wird vorausgesetzt.Ein Kernpunkt in Putnams Betrachtungen sind Reziprozitätsnormen, die eine breite Vertrauensbasis bilden können. Es entstehen Netzwerke in sozial dichten Interaktionsräumen, die zum einen helfen, kollektive Handlungsdilemmata zu überwinden und zum anderen hochgradig integrativ wirken.[52]
Stellung im Kausalzusammenhang
Sozialkapital istin Putnams Sinneeine unabhängige Variable. Allerdings übergeht Putnamin seiner Modellbildungden ersten Schritt,indem er auf die Mikroebene nicht weiter eingeht,sondernohne weiteresdas Vorhandensein einer gewissen Sozialkapitalquantität unterstellt.
Analyseebene
Putnam bewegt sich durchweg auf der Makro- und Mesoebene. Vornehmlich betrachtet er Volkswirtschaften.
Ausmaß der theoretischen Fundierung
Auch bei Putnam sind die theoretischen Konstrukte nur implizit abzuleiten. Putnam greift auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Argumentationen zurück.Dazu gehörenzum Beispielwohlfahrtsökonomische Ansätze, Argumenteausder Transaktionskostentheorie oder auch spieltheoretische Erklärungsmodelle, die allerdings kaum explizit gemacht werden. Dieses Vorgehen ist nicht ganz unproblematisch, da der Zusammenhang der Erklärungsmodelle untereinander unklar bleibt. Jansbeispielsweisebezeichnet das Vorgehen Putnams daher als eklektizistisch.[53]
2.1.5Granovetter
Schlagworte
Bindungen und Durchlässigkeit zwischen Netzwerken–tiesundholes.
Definition
Granovetter liefert keine zusammenhängende Definition eines Sozialkapital





























