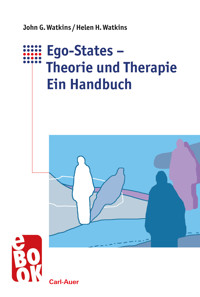
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Als kompakter, lebendiger psychodynamischer Ansatz hat die Ego-State-Therapie vielen Patienten geholfen, in kürzester Zeit wieder zu Wohlbefinden zu gelangen. Helen und John Watkins sind hervorragende Psychotherapeuten – ihr Buch wird ein Klassiker werden." Erika Fromm "Dieses Handbuch bietet Theorie und Kasuistik, Therapieeffizienzstunden und einen Ausblick in Paar-, Familientherapie und Politpsychologie. Das Buch ist ein breit angelegtes Vermächtnis des Hauptautors und seiner Frau, zwei Therapeuten mit in Jahrzehnten gewonnener Erfahrung, die durch Bedachtsamkeit, Empathie, Respekt vor ihren Patienten achtbar wirken. Es ist auch für Nicht-Hypnotherapeuten nützlich." Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie Persönlichkeitsstörungen erfolgreich behandeln Die Ego-State-Therapie, die John und Helen Watkins in diesem Buch vorstellen, ist bei einer Vielzahl von Störungen wirksam, darunter Angst- oder Stimmungsstörungen, Posttraumatischer Stress (PTSD), Stottern, Borderline- oder Sexualstörungen. Als Brückenschlag zwischen psychoanalytischen Theorien und hypnotherapeutischen Techniken bietet sie vor allem für die Behandlung dissoziativer Identitätsstörungen eine unentbehrliche Basis. Auch angesichts von Kostendruck und Zeitmangel im Gesundheitswesen erscheint die Ego-State-Therapie als zukunftsfähige psychotherapeutische Behandlungsmethode für das 21. Jahrhundert. Die Autor:innen: John G. Watkins, Prof. Dr. em., war von 1964 bis 1987 Professor für Psychologie und Direktor der klinischen Ausbildung an der Universität von Montana, USA. John Watkins ist Mitbegründer der International Society for Clinical and Experimental Hypnosis (SCEH) und zählt zu den Pionieren der Hypnotherapie. Helen H. Watkins, M.A., Klinische Psychologin, war 30 Jahre als Betriebspsychologin am Beratungszentrum der Universität von Montana tätig. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 führte sie eine Praxis für Ego-State-Therapie, vorrangig für die Beratung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carl-Auer
John G. Watkins / Helen H. Watkins
Ego-States –Theorie und Therapie
Ein Handbuch
Mit einem Vorwort von Luise Reddemann Aus dem Amerikanischen von Irmela Köstlin
Fünfte Auflage, 2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Berlin)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Schefer (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Redaktion: Uli Wetz
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Illustration: Carolina Bejenar
Umschlaggestaltung: WSP Design, Heidelberg
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Fünfte Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0322-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8548-2 (ePub)
© 2003, 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel
Ego States Theory and Therapy im Verlag W. W. Norton & Company, New York, London.
Copyright © 1997 by John G. Watkins and Helen H. Watkins
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +4962216438-0 • Fax +4962216438-22
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort zur Originalausgabe
Einführung
Anmerkungen
1 Die Persönlichkeit und ihre Entwicklung
Anmerkungen
2 Energien und das Funktionieren der Persönlichkeit
Bewusst – unbewusst
Subjekt – Objekt
Die Ich-Psychologie von Paul Federn
Anmerkungen
3 Wesen und Funktionieren der Ich-Zustände
Die Entdeckung der Ich-Zustände
Integration und Differenzierung
Merkmale von Ich-Zuständen
Die Entwicklung von Ich-Zuständen
Das Differenzierungs-Dissoziations-Kontinuum
Ich-Zustände und multiple Persönlichkeiten
Hypnose und Ich-Zustände
Ich-Zustände und der versteckte Beobachter
4 Dissoziation
Amnesie
Multiple Persönlichkeitsstörung (dissoziative Identitätsstörung)
Anmerkungen
5 Unbewusste Prozesse und psychodynamisches Verständnis
Verhalten und Erfahrung
Kognitives Verhalten und Bedeutungen
Die Deutung
Einsicht
Beispiele psychodynamischer Interaktionen
Die Psychodynamik verstehen lernen
Hypnose bei der Untersuchung psychodynamischer Prozesse
Psychodynamische Überlegungen bei der Behandlung der multiplen Persönlichkeitsstörung
Psychodynamische Interaktionen in der Psychose
Anmerkungen
6 Psychodynamische Bewegungen bei den Alter-Personen multipler Persönlichkeiten
Multiple Persönlichkeit
Beseitigung von nicht angepassten, bösartigen oder anachronistischen Ich-Zuständen
Die Psychodynamik in einem komplexen Fall einer echten multiplen Persönlichkeit
Anmerkungen
7 Ich-Zustände beim normalen Individuum
Der ausführende Ich-Zustand, Selbstkonzept und äußere Erscheinung
Weit verbreitete Ego-State-Probleme bei normalen Menschen
Lösung eines normalen Ego-State-Problems
Der versteckte Beobachter
Ein Fall von Ego-State-Therapie und die versteckten Beobachter
Anmerkungen
8 Prinzipien der Ego-State-Therapie
Übertragung
Resonanz
Die Verbindung zwischen Körper und Geist
Die Haltung des Therapeuten gegenüber Ich-Zuständen
Das Problem der Abhängigkeit
Vertrauen aufbauen
Integration versus Verschmelzung
Anmerkungen
9 Techniken und Strategien der Ego-State-Therapie
Mit Ich-Zuständen Kontakt aufnehmen
Diagnostische Erkundungen
Sich einen Überblick über die Interaktionen zwischen den einzelnen Ich-Zuständen verschaffen
Ein objektiver Beobachter
Innere Konflikte lösen
Übergangsobjekte
Techniken der Abreaktion
Die Affektbrücke
Die somatische Brücke
Die stille Abreaktion
Ego-State-Kurztherapie
Zusammenfassung
Anmerkungen
10 Spezialisierte Vorgehensweisen
Probleme kindlicher Ich-Zustände
Mit Angst umgehen
Tote als Zielscheibe der Gefühle
Erwachsene Ich-Zustände als Helfer
Der Einsatz von freiwilligen Ich-Zuständen
Der Ich-Zustand „Schmerz“
Kritische und tadelnde Ich-Zustände
Die Tür der Vergebung
Die nicht-hypnotische Technik mithilfe von Stühlen
Anmerkungen
11 Hypnoanalytische Ego-State-Kurztherapie
Die Häufigkeit der therapeutischen Sitzungen
Ein repräsentatives Beispiel einer Ego-State-Wochenend-Therapie
Anmerkungen
12 Ergebnisforschung in der Psychotherapie
Anmerkungen
13 Effizienz und Wirksamkeit der Ego-State-Therapie: Eine Validitätsstudie
Fragebogen zur Ego-State-Therapie
Ein Follow-up-Fragebogen hinsichtlich der Wirkungen der Ego-State-Therapie2
Das „Problem“ oder der Grund, eine Therapie zu beginnen
Frühere Psychotherapie
Vergleich der früheren Therapie mit der Ego-State-Therapie
Bewertungen von Teilnehmern, die zuvor eine Therapie psychoanalytischer Art gemacht hatten
Häufigkeit und letzter Zeitpunkt der Ego-State-Therapie
Warum Klienten eine Ego-State-Therapie machen
Entwurf eines Bewertungssystems (Einstufung)
Zusammenfassung
Anmerkungen
14 Der Beschützer verteidigt seine Festung: Ein schwieriger, komplexer Fall
Nachtrag
Einige theoretische Kommentare (von J. G. W.)
Anmerkungen
15 Behandlung eines frühen Traumas und Einsicht
Mögliche Beispiele für ein sehr frühes Trauma
Regression und Objektbeziehungstheorie
Echte Einsicht versus kognitive Einsicht
Anmerkungen
16 Dissoziation/Integration: Interpersonale, intrapersonale und Dis internationale Perspektiven
Interpersonale Perspektiven
Ego-State-Familientherapie
Ich-Zustände von Partnern
Ich-Zustände und das Gesetz
Physiologische Multiplizität
Mögliche Forschungen auf dem Gebiet der Ich-Zustände
Internationale Perspektiven
Anmerkungen
Literatur
Über die Autoren
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Die Kunst der Behandlung von Traumafolgestörungen ist in Deutschland relativ jung. Sieht man einmal von den Bemühungen um Verständnis und angemessene Behandlung von Holocaustopfern ab, worin sich einige PsychoanalytikerInnen, insbesondere Ilse Grubrich-Simitis (1979) engagiert haben, sowie einer schon 1987 erschienenen Arbeit von Mathias Hirsch zum Inzest, worin es aber weniger um Therapie ging, ist Traumatherapie in Deutschland erst seit Mitte bis Ende der 90er Jahre ein publikationswürdiges Thema geworden. Viel Wissen und Erfahrung aus Amerika und den Niederlanden wird nun erst nach und nach auch hierzulande bekannt und auf Deutsch zugänglich.
John G. Watkins und Helen H. Watkins gelten als Pioniere der Ego-State-Therapie, und die frühen Überlegungen dazu stammen bereits aus den 70er Jahren. Mit ihrer Methode haben die beiden neurotisch Kranke erfolgreich behandelt, aber auch die schweren Störungen, bis hin zu der damals noch so bezeichneten multiplen Persönlichkeitsstörung.
Ego-State-Therapie als ein Ansatz, der psychoanalytisches Wissen, Hypnose und die Theorien Janets zusammenbringt, eröffnet für die Behandlung von schwierigen Patientinnen und Patienten neue, kreative Möglichkeiten. Während die traditionelle Psychoanalyse sich mit nicht assimilierten Introjekten schwer tut, bietet hier das Ego-State-Konzept neue Zugangswege nicht nur des Verstehens, sondern vor allem auch in der Therapeutik. Federns Zwei-Energien-Theorie und deren Ausarbeitung durch Watkins & Watkins machen die Arbeit mit Menschen, deren ”Ich“ fragmentiert und dissoziiert erscheint, erheblich leichter. Wir haben dadurch die Möglichkeit, mit diesen verschiedenen Ich-Zuständen direkt zu arbeiten.
Damit wird das, was der Patient mitbringt, nicht bekämpft, analysierend in Frage gestellt und womöglich besserwisserisch korrigiert, sondern sorgsam genutzt. Die Zusammenarbeit von Patientin und Therapeutin kann damit auch partnerschaftlicher werden. Mich beeindruckt an der Arbeit von John und Helen Watkins sowie ihren Schülern, wie sehr sie immer wieder mit ihren Patienten gehen und deren innere Welten akzeptieren.
Beeindruckend ist auch die Schilderung des Falles ”Mary“ von Helen Watkins. Hier machen die Autoren deutlich, dass bei allen Chancen, durch Ego-State-Therapie die Behandlungszeiten zu verkürzen, die Therapie einer schwerstgestörten Patientin eben doch Jahre dauern kann.
Mich überzeugt an diesem Buch die Klarheit und Selbstkritik, mit der die Autoren ihre Theorien vortragen, das breite klinische Wissen, die klinische Erfahrung und Forschungsbereitschaft sowie der immer wieder aufschimmernde Pioniergeist und die therapeutische Kreativität.
Jede Psychotherapeutin und jeder Psychotherapeut, die mit traumatisierten Patientinnen und Patienten zu tun haben, werden hier Anregungen finden, die die Arbeit mit dieser Klientel nicht nur bereichern, sondern vor allem auch erleichtern.
Luise Reddemann
Literatur:
Grubrich-Simitis, I. (1979): Extremtraumatisierung als kumulatives Trauma. Psychoanalytische Studien über seelische Nachwirkungen der Konzentrationslagerhaft bei Überlebenden und ihren Kindern. Psyche 33: 991–1023
Hirsch, M. (1987): Realer Inzest. Psychodynamik des sexuellen Mißbrauchs in der Familie. (Springer) [Neuaufl. (1999), Gießen (Psychosozial).]
Vorwort zur Originalausgabe
Beim Internationalen Kongress für Psychoanalyse im Jahre 1918 in Budapest (dem ersten nach dem Ersten Weltkrieg) hielt Freud einen Vortrag über die Notwendigkeit, zusammen mit dem psychoanalytischen Verstehen auch die Suggestion und Techniken der Hypnose einzusetzen. Ihm erschien dies notwendig, weil die Gesellschaft zukünftig in der Lage sein sollte, eine Behandlung für die breiten Massen, die an psychischen Problemen leiden, zu finanzieren.
Dieses Buch, Ego-States – Theorie und Therapie, hat das Ziel, hypnotherapeutische Techniken mit den psychoanalytischen Konzepten zu verbinden und eine Kurzpsychotherapie auf der Grundlage von Paul Federns Ich-Psychologie, insbesondere seiner Entdeckung der Existenz von Ich-Zuständen, zu entwickeln.
Obgleich Freud mit seinem Buch Das Ich und das Es (1923) den Grund für eine psychoanalytische Ich-Psychologie gelegt hatte, ging er nicht weiter, als darzulegen, dass die Psyche des Menschen in ein Es, ein Ich und ein Über-Ich unterteilt ist, wobei überwiegend das Ich die Funktionen der Synthese und des Erkennens von Gefahren aufgrund von Angst übernimmt.
Während Anna Freud (1936) diese Funktionen auf die Abwehrmechanismen und Hartmann (1970) auf die Anpassungsfunktionen ausdehnte, entdeckte Paul Federn das Wesen des Ich aufgrund seiner Arbeit mit den geistig und seelisch Kranken. Diese Entdeckung wurde von den meisten Psychoanalytikern lange Zeit vernachlässigt; die Autoren dieses Buches indessen berücksichtigen die Existenz von Ich-Zuständen und setzen dieses Wissen in ihren Therapien erfolgreich ein.
Sie legen Federns Konzept der Ich-Zustände in großer Klarheit dar und zeigen, wie dieses Wissen bei der Behandlung multipler Persönlichkeiten und anderer Erkrankungen, die mit Ich-Störungen einhergehen, eingesetzt werden muss. Psychotherapeuten, die Federns Konzepte des Ich anwenden, haben eine sichere theoretische Basis für ihre Arbeit, und besonders Hypnotherapeuten können von dem so gewonnenen Verständnis profitieren.
Ernst Federn
Einführung
Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete ich als leitender Psychologe an einem großen Militärkrankenhaus, und ein junger Leutnant, der an Angst vor der Dunkelheit litt, wurde an mich überwiesen. Der Fall wurde mit Hypnose behandelt. Er wurde detailliert veröffentlicht (J. Watkins 1949) und ist vor einigen Jahren in gekürzter Form (J. Watkins 1992b) neu publiziert worden. Die erfolgreiche Lösung dieses Falles hing mit der Entdeckung zusammen, dass ich es mit mehr als einer ”Entität“ zu tun hatte. Damals hätte ich den Patienten als multiple Persönlichkeit betrachtet. Die beiden Subpersönlichkeiten traten nicht spontan in Erscheinung, sie konnten aber mithilfe von Hypnose aktiviert werden. Eine Vielzahl hypnotischer, analytischer und projektiver Techniken wurden eingesetzt, um sie, genau so wie die Interaktionen, die zu der Angst vor der Dunkelheit geführt hatten, zu verstehen. Die Phobie wurde aufgrund psychodynamischer Einsichten geheilt, zu denen der Patient mithilfe hypnotherapeutischer Verfahren geführt worden war; sie sind an anderer Stelle detailliert beschrieben worden (J. Watkins 1992b). So faszinierend diese komplexen Interaktionen auch waren – das Wichtigste für unsere heutige Arbeit ist, dass ich damals zum ersten Mal mit jenen segmentierten Persönlichkeitsstrukturen in Berührung gekommen bin, die wir heute ”Ich-Zustände“ nennen.
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg verbrachte ich viel Zeit damit, das Wesen und die verschiedenen Verfahren der Hypnose zu erforschen, sowohl als Forscher wie auch in der klinischen Praxis.1Eine persönliche Analyse bei dem Lehranalytiker Edoardo Weiss (1960), der seinerseits von Paul Federn analysiert und von Freud ausgebildet worden war, brachte mich in Berührung mit Federns Theorien von den Ich-Zuständen, die wir weiter unten beschreiben werden. Diese Erfahrung führte zu einem tiefer gegründeten Verständnis der menschlichen Persönlichkeit, die ich fortan als eine Vielheit und weniger als eine Einheit betrachtete.
Im Laufe der 50er- und der 60er-Jahre hatte ich Gelegenheit, eine Reihe von Menschen zu behandeln, bei denen es sich tatsächlich um multiple Persönlichkeiten handelte, darüber hinaus hatte ich Gelegenheit zu verfolgen, wie solche Fälle von Bernauer Newton und anderen Kollegen behandelt wurden, und bei der Abfassung von Berichten und der Bereitstellung von audiovisuellen Materialien, in denen solche Patienten beschrieben werden, mitzuarbeiten (siehe Bowers u. a. 1971). Diese Erfahrung war für mich sehr wertvoll und bereitete den Boden für das Verständnis verborgener Entitäten bzw. Anteile der Persönlichkeit im Vergleich zu den tatsächlich und offenkundig multiplen Persönlichkeiten. Die wirkliche Bedeutung der ”Abwehr durch Abspaltung“ jedoch, die viel stärker verbreitet ist und sich bei einem breiten Spektrum von Persönlichkeiten, angefangen bei der normalen Persönlichkeitsstruktur bis hin zu den schwer dissoziierten Persönlichkeiten, nachweisen lässt, trat erst dann klar in Erscheinung, als ich in den frühen 70er-Jahren mit meiner Frau und Kollegin, Helen H. Watkins, zusammenzuarbeiten begann.
Als Psychologin am Beratungszentrum der Universität von Montana hatte Helen viele College-Studenten mit normalen und neurotischen Problemen beraten und behandelt. Als geschulte Hypnotherapeutin nahm sie ständig diese verborgenen anderen in den Persönlichkeiten ihrer Klienten wahr, die intrapersonale Konflikte hervorriefen und die es zu verstehen galt, wenn Helen sie erfolgreich behandeln wollte. Auch ich begann, sowohl mit Blick auf verborgene Persönlichkeitssegmente als auch mit Blick auf das Individuum als Ganzes, hypnoanalytische Techniken anzuwenden, was nicht nur mein klinisches Verständnis, sondern auch den therapeutischen Erfolg verbesserte. Abgesehen davon, machte ich die Erfahrung, dass die Theorien von Paul Federn (1956) und Edoardo Weiss (1960), die ich bereits zwei Jahrzehnte früher kennen gelernt hatte, für die Fälle, mit denen ich es nun zu tun hatte, von Bedeutung waren.
Als Professor und Leiter des Ausbildungsprogramms im Bereich klinische Psychologie an der Universität von Montana verbrachte ich viel Zeit mit Unterrichten und Supervision und begleitete die Studenten auch bei der Ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zur Erlangung des Master’s Degree; einige dieser Arbeiten befassten sich mit der Erforschung von Ich-Zuständen (Douglass a. Watkins 1994; Eiblmayr 1987; W. Hartman 1995).
Während Helen in diesen Jahren in erster Linie mit der allgemeinen klinischen Praxis zu tun hatte, beschränkte ich meine Behandlungsfälle nach und nach immer mehr auf offenkundig multiple Persönlichkeiten. Da wir beide versuchen mussten, sowohl offen in Erscheinung tretende als auch verborgene Persönlichkeitssegmente zu verstehen, spürten wir die Notwendigkeit, uns häufig gemeinsam zu besprechen – was bedeutete, dass jeder von uns gelegentlich bei den Behandlungssitzungen des anderen anwesend war – und gemeinsam eine kohärente Theorie von den Ich-Zuständen und ein entsprechendes Therapiesystem zu entwickeln.
Helen besaß eine Sensibilität, die dem, was Reik (1948; dt. 1976) als ”Hören mit dem dritten Ohr“ bezeichnet hat, ähnlich zu sein schien. Sehr häufig stimmte sie sich intuitiv auf das Verhalten verborgener Persönlichkeitsteile ein und entwickelte im Umgang mit ihnen innovative therapeutische Strategien. Diese Strategien kombinierten wir mit den früher von mir entwickelten hypnoanalytischen Vorgehensweisen, wie zum Beispiel Abreaktion (J. Watkins 1949), projektiven Techniken (1952) und der ”Affektbrücke“ (1971).
Ich selbst hatte das Bedürfnis, das Wesen dieser ”Ich-Zustände“ zu erforschen und eine theoretische Grundlage zu erarbeiten, um sie verstehen zu können. Auf dieser Basis führten wir gemeinsame Untersuchungen durch (Watkins a. Watkins 1979/80, 1980) und blieben ständig im Gespräch über die sich langsam herausschälende Theorie, die wir nach allen Seiten prüften und diskutierten (H. Watkins 1993). Helen stellte immer mehr Daten und Fallmaterial aus ihrer Praxis zur Verfügung, und ich versuchte beharrlich, aus all diesem Datenmaterial eine theoretische Bedeutung herauszudestillieren. In einer Reihe von Workshops begannen wir, das gesammelte Material zu präsentieren (siehe Steckler 1989) und verschiedene Veröffentlichungen herauszugeben.2 Freunde und Kollegen, mit denen wir unsere Gedanken und Konzepte diskutierten, nahmen die Konzepte von den Ich-Zuständen auf und überprüften sie in der Praxis; und so verfolgte dann nach und nach jeder seine eigene Spur hinsichtlich der weiteren Forschung und Theoriebildung.3
Unabhängig davon stellte Hilgard (1977,1986) Untersuchungen über das Phänomen des ”versteckten Beobachters“ vor, das den Faktor des Ko-Bewusstseins (Beahrs 1983) mit Blick auf das Funktionieren der Persönlichkeit untermauerte. Der Begriff, den Hilgard gebrauchte, nämlich ”kognitive strukturelle Systeme“, enthielt offenbar dieselben Entitäten, die wir ”Ich-Zustände“ genannt und mit denen wir therapeutisch gearbeitet hatten (Watkins a. Watkins 1979/80, 1980). Auch die Untersuchungen von Bower (1981) und seiner Mitarbeiter (1978) über Stimmungen und Gedächtnis schienen das Konzept von den Ich-Zuständen zu bestätigen.
In den letzten zwei Jahrzehnten ist das Interesse an der multiplen Persönlichkeitsstörung sowie dem gesamten Gebiet der Dissoziation wieder neu aufgelebt, und das gesamte Krankheitsbild erfährt in der Forschung zunehmend an Bedeutung und Beachtung.4 Das DSM-IV (American Psychiatric Association 1994) räumt einer genauen Definition von Krankheitszuständen, die mit Dissoziation einhergehen, bzw. den Kriterien für eine solche Diagnose viel Platz ein. Die Bezeichnung ”multiple Persönlichkeitsstörung“ (MPS) wurde zugunsten des Terminus ”dissoziative Identitätsstörung“ (DIS) aufgegeben.
Mittlerweile ist eine neue wissenschaftliche Vereinigung, die International Society for the Study of Dissociation, gegründet worden. Sie hat gegenwärtig mehr als 3000 im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie tätige Mitglieder; das von der Organisation herausgegebene Fachblatt, Dissociation, publiziert regelmäßig eine Fülle einschlägiger neuer Untersuchungen. Abgesehen davon, betrachtet man die Hypnose selbst heutzutage in erster Linie als eine Form der Dissoziation und nicht lediglich als einen Zustand, der durch Suggestion hervorgerufen wird (Hilgard 1986).
In der Literatur über Diagnose und Behandlung der multiplen Persönlichkeitsstörung begegnet heute immer häufiger der Begriff ”Ich-Zustände“, und es wird zunehmend deutlich, dass die Existenz verborgener Persönlichkeitsteile genau so anerkannt wird wie die offener zutage tretenden Persönlichkeitssegmente bei Patienten mit einer echten MPS (Brown a. Fromm 1986; Gruenwald 1986; Ramonth 1985). Es erscheint uns daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt notwendig, eine Theorie auszuarbeiten, welche eine Brücke herstellen kann zwischen dem normalen Funktionieren der Persönlichkeit und den extremen Formen der Dissoziation, wie sie sich bei den multiplen Persönlichkeitsstörungen, den Amnesien und den Fugue-Zuständen finden. Ausgehend von einer solchen theoretischen Grundlage, ließen sich vielleicht nicht nur bessere Behandlungsmöglichkeiten für Personen mit einer echten MPS entwickeln, sondern auch bessere Methoden, mit den ”normaleren“ und neurotischen Störungen, die ihre Ursache in leichteren Formen der Abspaltung haben, umzugehen.
Wir könnten das Auftreten von Multiplizität, sofern es sich dabei um etwas Pathologisches handelt, einfach als das Ergebnis exzessiver Anpassungs- und Abwehrprozesse betrachten, wie sie alle Menschen einsetzen, um sich zu schützen und um überleben zu können – und nicht als irgendeine Form extremer und radikaler Aufspaltung im Funktionieren der menschlichen Persönlichkeit.
Wir hoffen, mit diesem Buch unsere Erfahrungen, unsere Forschungsarbeit und unsere klinische Praxis mit den Ergebnissen anderer zu verbinden und so zu einem kohärenten Ansatz zu gelangen, den wir ”Ego-State-Therapy“ genannt haben. Wir fühlen uns mit unserer Arbeit früheren Forschern wie Janet (1907), Federn (1956) und Weiss (1960) verpflichtet wie auch unzähligen anderen Psychoanalytikern, die ihren Beitrag in Theorie und Praxis geleistet haben. Wir sind uns bewusst, dass die Konzepte, die wir in diesem Buch darlegen, auch die Theorien der Objektbeziehungsanalytiker wie Fairbairn (1963), Guntrip (1968, 1971), Jacobson (1998), Kernberg (1997), Kohut (1993), Mahler (1998), Winnicott (1997b) und anderer berühren.
Psychotherapeuten sind heute mit einem schwerwiegenden Problem konfrontiert. Psychodynamische Therapien erforderten bislang für gewöhnlich viele Sitzungen, die sich im Allgemeinen über Monate und Jahre erstreckten. Heutzutage sind die Versicherungsgesellschaften und andere Organisationen, die Zuschüsse für derartige Behandlungen gewähren, nicht mehr bereit, solche langwierigen Behandlungen zu bezahlen. Sie fordern kurze und ”effiziente“ Therapien. Therapeuten, die mit einem Ansatz arbeiten, der mehrere Sitzungen pro Woche über einen Zeitraum von vielen Monaten oder gar Jahren erfordert (wie zum Beispiel die Psychoanalyse), sehen sich einer ernsten ökonomischen Krise gegenüber (Goldberg 1996). Die Hypnoanalyse (Fromm a. Nash 1997; J. Watkins 1992a, 1992b) hat gezeigt, dass sie die Zeitdauer einer ”analytischen“ Behandlung signifikant verringern kann. Eine intensive Therapie der Ich-Zustände – wobei es sich um eine Erweiterung der Hypnoanalyse handelt – bietet einen wirksamen Ansatz, der die Therapiedauer noch stärker verkürzt und der innerhalb von acht bis zwölf Stunden (wir beziehen uns dabei auf unsere Nachfolgestudien, siehe Kapitel 13) häufig dauerhafte strukturelle Persönlichkeitsveränderungen bewirkt und zur Lösung lebenslanger Störungen führt.
Die wissenschaftliche Psychologie und die therapeutische Behandlung von Persönlichkeitsstörungen sind Gebiete, die sich ständig weiterentwickeln. Ja, der wissenschaftliche Fortschritt auf diesen Gebieten vollzieht sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass es für einen einzigen Menschen eigentlich unmöglich ist, auch nur in einem schmalen Wissensgebiet mit den neuen Entwicklungen Schritt zu halten – wie zum Beispiel auf dem Gebiet der Dissoziation. Wir stellen unsere Arbeit daher in dem vollen Bewusstsein vor, dass wir zweifellos viele andere Wissenschaftler, Forscher und Therapeuten nicht kennen und deshalb auch nicht berücksichtigen konnten, die vielleicht schon früher, vielleicht auch zur gleichen Zeit wie wir und vielleicht in einer anderen Terminologie sich mit genau den gleichen Ideen und Konzepten getragen haben.
Der ausgeprägte Informationsüberschuss und die Kommunikationslücken, unter denen wir heutzutage leiden, führen dazu, dass manch einer, der glaubt, er habe eine innovative Idee, das Rad noch einmal erfindet. Wir sind uns auch dessen bewusst, dass, wer wirklich etwas Neues erfindet, sich zwangsläufig möglichst viele Quellen zunutze macht. Wir stellen das Ergebnis unserer gemeinsamen Forschungsarbeit, das Ergebnis unserer theoretischen Konzeptualisierungen und unserer klinischen Praxis sowie der Anregungen, die wir von anderen erhalten haben, daher mit einem echten Gefühl der Demut vor. Wir wissen, dass die Ego-State-Therapie die Aufmerksamkeit vieler Kollegen wie auch anderer Autoren, die nun auf diesem Gebiet weiterforschen, auf sich gezogen hat, und wir sehen den weiteren Entwicklungen und Fortschritten dieses Ansatzes mit Freude entgegen.
Da das gegenwärtige Stadium in der Entwicklung der Ego-State-Therapie das Ergebnis vieler früherer Forschungen ist, deren Resultate wir einzeln und gemeinsam veröffentlicht haben, werden wir uns häufig auf diese Publikationen beziehen, um denjenigen unserer Leser entgegenzukommen, denen an einer vollständigeren Darlegung eines bestimmten theoretischen Aspektes oder einer bestimmten klinischen Technik gelegen ist.
Es ist uns durchaus klar, dass unsere Auffassungen vielleicht schon nach kurzer Zeit überholt sein mögen. Aber wir sind schon zufrieden, wenn sie in irgendeiner Weise dazu beitragen, unser wachsendes Wissen in Bezug auf das Funktionieren der menschlichen Persönlichkeit, der gut wie der schlecht angepassten, zu erweitern.
John G. Watkins
Anmerkungen
1J. Watkins (1946,1947,1949,1951,1954,1963a, 1963b, 1967,1971,1972,1977,1978a, 1978b, 1984, 1987, 1989).
2Watkins und Watkins (1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990a, 1990b, 1991, 1992, 1993a, 1996a).
3Beahrs (1982, 1986), Edelstien (1982), Frederick (1993), Frederick und McNeal (1993), Frederick und Phillips (1995), Newey (1986), Phillips (1993), Phillips und Frederick (1995), Torem (1987, 1989, 1993).
4Forscher wie Bliss (1986), Boor und Coons (1983), Braun (1984), Caul (1988), Coons (1988, 1993), Fine (1989, 1993), Greaves (1988), Kluft (1987, 1988, 1993), Kluft und Fine (1993), Loewenstein (1991), Putnam (1985, 1989, 1991), Ross (1989, 1991) und andere sind hier vorangegangen.
1 Die Persönlichkeit und ihre Entwicklung
Der Begriff der Persönlichkeit ist nur schwer zu definieren. Dennoch wird er häufig verwendet und übermittelt im Gespräch zwischen Menschen eine Bedeutung. Wenn wir von jemandem sagen: ”Sie ist eine glänzende Persönlichkeit“, dann schildern wir sie als faszinierend in positivem Sinn. Es deutet auch an, dass sie in ihrem gesellschaftlichen Umfeld ziemlich populär und gefragt ist. Bezeichnen wir einen Menschen andererseits als ”korrupte Persönlichkeit“, dann deuten wir damit an, dass er dazu neigt, Zwietracht zu säen und Intrigen zu spinnen und dass er vermutlich auch in geschäftlichen Dingen nicht ehrlich ist. Das Wort ”Persönlichkeit“ hat in der Umgangssprache viele Bedeutungen, auch wenn es für Verhaltenswissenschaftler sehr schwierig ist, sich auf eine formale Definition festzulegen, die alle Aspekte der Persönlichkeit umfasst, aber andere psychische Manifestationen ausschließt. Entscheidend scheinen hier jene Merkmale einer Person zu sein, deren Verhaltensäußerungen von anderen beurteilt werden und auf die sie reagieren.
Zahlreiche Wissenschaftler haben den schwierigen Versuch unternommen zu beschreiben, was Persönlichkeit ist. Sie haben nach den wesentlichen Dimensionen dessen gesucht, was Persönlichkeit ausmacht, und eine theoretische Grundlage erarbeitet, von der aus Entwicklung und Funktion der Persönlichkeit erklärt werden können.1Die Zahl derer, die Innovatives zur Theorie der Persönlichkeit beigetragen haben, ist Legion, und wir wollen hier nicht den Versuch unternehmen, ihre Veröffentlichungen zu besprechen oder auch nur vollständig aufzuzählen.
Dieses Buch stellt einen weiteren Versuch dar zu verstehen, was ”Persönlichkeit“ ist. Wir werden deshalb versuchen, jene früheren Autoren zu nennen, deren Beiträge sich auf die Theorie der Ich-Zustände beziehen oder sie unmittelbar beeinflusst haben.
Was meinen wir mit dem Wort Theorie, wenn wir von der Theorie der Ich-Zustände sprechen? Eine Theorie ist zunächst einmal eine bestimmte Art, eine Reihe von Daten zu betrachten. Hall und Lindzey (1985) haben auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass eine Theorie nicht unbedingt richtig oder falsch sein muss. Vielmehr sollte gefragt werden, ob sie brauchbar ist oder nicht, was davon abhängt, ob ihre Voraussagen sich bestätigen und ob es möglich ist, Ergebnisse zu kontrollieren, wenn man die Theorie auf bestimmte Beobachtungen anwendet. Eine Theorie sollte auch zur Erstellung von Forschungshypothesen dienen, indem sie neue, bisher noch nicht beobachtete Bezüge herstellt. Es ist ihr Zweck, zuvor angestellte Vermutungen explizit zu machen.
Theorien wurden entwickelt, um dem unaufhörlichen Bemühen des Menschen zu entsprechen, sich selbst und seine Mitmenschen zu verstehen und ein vernünftiges Prinzip für den Umgang der Menschen miteinander bereitzustellen. Einige Theorien wurden aufgrund klinischer Studien menschlichen Verhaltens entwickelt, andere aufgrund von Laboruntersuchungen und wieder andere aufgrund von philosophischen Spekulationen über das Wesen des Menschen. Die unsere basiert auf allen drei Grundlagen.
Aber was muss eine gute Persönlichkeitstheorie leisten? R. Ewen (1980) hat erklärt, eine gute Persönlichkeitstheorie müsse geeignete Beschreibungen des relevanten Verhaltens liefern, einen Rahmen für die Organisation von Daten bieten und die Aufmerksamkeit auf wesentliche Aspekte richten. Er ist auch der Auffassung, sie müsse die untersuchten Phänomene erklären und Antworten auf Fragen nach den individuellen Unterschieden geben sowie sich mit dem Problem auseinander setzen, warum manche Personen beeinflussbarer sind als andere. Außerdem sollte eine gute Theorie Voraussagen ermöglichen, die in der Praxis angewendet werden können und die so die Veränderung und Kontrolle des Umfeldes erleichtern.
Sobald neue Daten über menschliches Verhalten zur Verfügung stehen, sowohl aufgrund experimenteller Forschung wie auch aufgrund klinischer Erfahrung, werden auch neue Theorien entwickelt, welche die beobachteten Phänomene besser erklären und, wie zu hoffen steht, eine präzisere Durchführung der therapeutischen Maßnahmen ermöglichen.
Die Schöpfer von Persönlichkeitstheorien beziehen sich häufig sowohl auf die Konzepte früherer Theoretiker wie auch auf neuere Beobachtungen und Forschungen. Angestrebt werden sowohl eine bedeutungsvollere theoretische Grundlage als auch wirksamere Interventionen. Man sollte keine ”neue“ Theorie vorbringen, die lediglich bereits publizierte Konzepte wieder aufwärmt, ohne denen, die sie zuerst vertreten haben, Dank und Anerkennung zu zollen. Das kann aber leicht passieren, da niemand in der Lage ist, alles zu lesen, was bisher auf dem Gebiet der Persönlichkeitsforschung publiziert worden ist, und es deshalb leicht passiert, dass in Unkenntnis früherer Konzepte dieselben kognitiven Prozesse noch einmal durchlaufen werden, aufgrund deren die Theorie zuerst erstellt wurde.
Aber alle Theorien sind notwendigerweise unzureichend. Die heutigen Wissenschaftler müssen deshalb von einer bekannten Theorie ausgehen, ihre Definitionen verändern, ihren Anwendungsbereich erweitern und sie auf diese Weise verbessern. Das mindert jedoch nicht ihre Verpflichtung, ihren Vorgängern Tribut zu zollen. Jede Generation macht Fortschritte, was das menschliche Wissen und Verstehen betrifft. Dieses Wissen wird immer komplexer und bedeutungsvoller, es bleibt aber stets der Sprache seiner Zeit verhaftet.
Auch die hier vorgelegte Theorie der Ich-Zustände reiht sich in diese Entwicklung ein. Sie hat ihre Quellen in vielen früheren Theorien, speist sich aber auch aus der Unzufriedenheit mit ebendiesen Konzepten. Die früheren Konzepte waren entweder nicht mächtig genug, oder sie waren unvollständig und nicht in der Lage, die Phänomene, die wir in der klinischen Praxis beobachten, in ausreichendem Maße zu beschreiben und zu erklären. Abgesehen davon gaben viele der früheren Konzepte – auch wenn es sich um wundervolle Gedankengebäude handelte – keinerlei Anhaltspunkte, wie ihre Schlussfolgerungen in die Praxis umgesetzt werden konnten. Häufig folgt eine Abstraktion aus der anderen, und daraus werden dann weitere Schlussfolgerungen gesponnen. Es gibt nur wenig spezifisches, objektives Fallmaterial, an dem sich eine bestimmte Auffassung illustrieren lässt; der Theoretiker nimmt einfach an, dass der Leser seine Begrifflichkeit versteht. Wir haben festgestellt, dass dies auf sehr viele Persönlichkeitstheorien zutrifft. Sie halfen uns nicht, unsere Patienten besser zu verstehen und zu behandeln. Sie lieferten uns auch kaum Technologien, die uns gezeigt hätten, was wir im Umgang mit körperlich anwesenden, lebendigen Patienten in der Therapie tun, was wir nicht tun und wie wir es tun sollten. Daher entsprachen sie in vielerlei Hinsicht nicht den Kriterien einer ”guten“ Theorie in dem von Ewen dargelegten Sinn.
Da die Theorie der Ich-Zustände sich aus Konzepten früherer Wissenschaftler entwickelt hat, erscheint es angemessen, einige von denen zu erwähnen, denen wir am meisten verpflichtet sind.
Ellenberger (1996) erwähnt, dass schon Augustinus in seinen Confessiones darüber grübelte, ob die Persönlichkeit eine Einheit sei, und dass der Begriff der ”gespaltenen Persönlichkeit“ bereits Ende des 18. Jahrhunderts bekannt war. Um 1880 wurde er sowohl von den Psychiatern als auch von den Philosophen diskutiert. Das Phänomen der Dissoziation wurde von vielen der Pioniere der Hypnosearbeit beobachtet, und Janet (1907, 1925) beschrieb sowohl dieses Phänomen als auch ”unbewusste“ Prozesse bei verschiedenen Patienten offenbar schon vor Freud.
Janet stellte fest, dass in der Entwicklung der Sprache eine Handlung sich nach und nach von dem verbalisierten Klang, der die Handlung ursprünglich begleitete, trennte und dass später dieser Klang die Handlung auslöste. Insofern wurde die Sprache selbst von ihrem äußeren Verhalten ”dissoziiert“ und ermöglichte es einem Individuum, zeitweise in einer inneren Welt zu existieren, abgegrenzt von der ”realen“, äußeren Existenz. Diese Art der Dissoziation ist ein normaler Vorgang und bei allen Menschen zu beobachten.
Janet beobachtete, dass das für die Kontrollvorgänge, zum Beispiel Denken und Verbalisieren, aufgewendete Quantum an Energie viel geringer ist als dasjenige, das für die kontrollierten Prozesse physischen Verhaltens eingesetzt wird. Vom evolutionären Standpunkt aus gesehen, ist es daher ökonomischer, wenn Verhalten mental ausprobiert werden kann, bevor es tatsächlich ausgeführt wird. Diese Trennung schafft das Potenzial zu einem wesentlich effizienteren Verhalten. Differenzierung ist daher ein wesentlicher Prozess, der für die allmähliche Entwicklung eines sich intelligent verhaltenden Menschen grundlegend ist. Es ist ökonomisch, den hohen Energieaufwand, den Verhalten erfordert, durch das viel kleinere Quantum an Energie zu kontrollieren, das für Kontrollprozesse (Gedanken) auf höherer Ebene erforderlich ist. Dies erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass, sind Verhaltensprozesse erst einmal in Gang gesetzt, das Risiko unangepasster und unerwünschter Ergebnisse herabgesetzt und die Aussicht, das erwünschte Resultat zu erlangen, gesteigert wird. Organismen (wie der Homo sapiens), die diese Fähigkeit zur Differenzierung entwickelten, trugen im Kampf um Überleben und Macht den Sieg davon.
Janet reduzierte auch psychologische Prozesse auf das Ansteigen und Abebben des Energieniveaus. Und das Konzept der physischen Energie nimmt natürlich auch in den Theorien von Jung (1969) und Freud (1938) eine zentrale Position ein. Energiekonzepte waren ein integraler Bestandteil der Theorien von Paul Federn (1956). Insbesondere seine Auffassungen haben unsere eigenen Theorien von den Ich-Zuständen beeinflusst; sie werden weiter unten detaillierter dargelegt werden.
Janet vertrat die Auffassung, dass ein Gedankensystem vom Kern der Persönlichkeit dissoziiert werden und als Persönlichkeit unterhalb des Bewusstseins existieren könne. Diese Persönlichkeit ist Janets Auffassung zufolge dem Individuum unbewusst, kann jedoch mithilfe der Hypnose bewusst werden. Diese Definition einer Persönlichkeit unterhalb der Bewusstseinsschwelle ist fast identisch mit der Definition eines Ich-Zustandes, wie wir sie weiter unten noch darlegen werden.
Die wissenschaftlichen Pioniere, die sich mit dem Phänomen der Dissoziation beschäftigten, gewannen ihr Material jedoch in erster Linie aus der Untersuchung von hysterischen Patienten oder von Patienten mit einer psychopathologischen Symptomatik. Es verwundert deshalb nicht, dass die Dissoziation als anormaler Zustand betrachtet wurde, der vorwiegend bei Geisteskranken auftrat. Während unsere Untersuchungen der Ich-Zustände diese schweren Formen der Dissoziation, die bei anormalem Verhalten zu beobachten sind, durchaus mit umfassen, gehen viele unserer Erkenntnisse aus der Untersuchung oder Behandlung von Individuen mit normalen Problemen (wie zum Beispiel Übergewicht, Lernproblemen oder Rauchen) wie auch mit neurotischen und psychophysiologischen Beeinträchtigungen hervor.
Ein großer Teil der Kontroverse dreht sich darum, in welchem Ausmaß Persönlichkeiten, die unterhalb der Schwelle des Bewusstseins existieren, das normale Funktionieren der Hauptpersönlichkeit beeinträchtigen. So berichteten Nadon, D’Eon, McKonkey, Laurance und Campbell (1988), dass die Aktivität der sekundären Intelligenz dazu tendiert, den Gedankenfluss der der Hauptpersönlichkeit zugeordneten Intelligenz zu beeinträchtigen.
Andere Forscher versuchten, das Konzept der Dissoziation zu diskreditieren, und zwar anhand von Untersuchungen, die zeigten, dass die Störung entweder die gesamte Persönlichkeit erfassen oder andernfalls das Konzept aufgegeben werden müsse. Hilgard (1986,1987) hat sich ausführlich mit diesen Untersuchungen auseinander gesetzt und festgestellt (1986, p. 12), dass ”die Urheber des Konzepts (Dissoziation)2 keine so extreme Position einnahmen“; er hielt es für einleuchtend, davon auszugehen, dass die Störung auch nur partiell sein kann. Genau diese Position vertreten wir hier; wir schlagen lediglich vor, den Begriff ”Störung“ durch ”Einfluss“ zu ersetzen. Dieser Einfluss von untergeordneten Entitäten kann das Funktionieren der primären Persönlichkeit modifizieren oder sogar fördern, er kann sich aber auch störend auswirken. Die Theorie der Ich-Zustände bietet auch eine Erklärung dafür, dass solche Subpersönlichkeiten die primäre Persönlichkeit in unterschiedlichem Grad beeinträchtigen oder beeinflussen, wie auch für die Frage, warum dieser Prozess mehr oder weniger unbewusst sein kann.
Jungs System der analytischen Psychologie (1969) besteht in einer sehr komplexen Reihe von Beiträgen zum Verständnis des Funktionierens der Persönlichkeit; viele seiner Konzepte sind Vorläufer der von uns entwickelten Theorien (sowie deren von Paul Federn, dessen Psychologie wir in Kapitel 2 beschreiben werden). Obwohl Jungs Theorien hauptsächlich auf der klinischen Praxis beruhen, haftet ihnen ein gewisser Mystizismus an, der es ”objektiveren“ Wissenschaftlern schwer macht, ihre Bedeutung einzuschätzen. Wir befassen uns hier nur mit denjenigen von Jungs Konzepten, die direkt mit der Entwicklung der Theorie der Ich-Zustände zu tun haben.
Jung hat schon früher auf die beiden wesentlichen Beiträge von Federn, auf die sich die Theorie der Ich-Zustände gründet, hingewiesen: das Konzept der psychischen Energie und die Überzeugung, dass Persönlichkeit durch Multiplizität gekennzeichnet und nicht einfach eine Einheit ist. Jung war der Ansicht, dass die Psyche aus verschiedenen Komponenten bestehe, die in der Lage sind, zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten zu oszillieren, eine Position, die von Beahrs (1986) weiter ausgeführt wurde. Jung postulierte die Existenz von ”Komplexen“ innerhalb der Persönlichkeit, eine Gruppe aneinander gelagerter unbewusster Gedankenvorstellungen. Auch war er der Auffassung, eine Person habe nicht etwa einen Komplex, sondern der Komplex habe sie, die Person. Dieses Konzept hat viel Ähnlichkeit mit Federns Ich-Zuständen wie auch mit unserer Auffassung vom ausführenden Ich-Zustand, das heißt, dem Selbst im Hier und Jetzt, das sich insbesondere in multiplen Persönlichkeiten manifestiert. Jung hat auch die Archetypen beschrieben, dauerhafte verborgene Strukturen im kollektiven oder ethnischen Unbewussten. Die Ego-State-Therapie geht zwar nicht von derartigen Entitäten aus, aber Jungs Konzept der Multiplizität als etwas, das menschlicher Erfahrung und menschlichem Verhalten inhärent ist, ist grundlegend für unsere Theorie.
Das Konzept der psychischen Energien steht in Einklang mit Freuds Libido-Konzept sowie mit Federns Konzept der Ich- und Objekt-Besetzungen, auch wenn diese anders definiert und ihrer Funktion nach qualitativ verschieden davon sind. Auch Sullivan (1980) betrachtete das menschliche Individuum als energetisches System. Und in ähnlicher Weise ist dieses Konzept von vielen früheren Autoren vertreten worden. Der Ego-State-Theorie dagegen liegt das Bemühen zugrunde, dieses Konzept in spezifischerer Weise anzuwenden, nämlich mit dem Ziel, seelisch-geistige Störungen besser zu verstehen und ihre Therapie zu verbessern.
Unsere Theorie von den Ich-Zuständen ist auch durch neuere Entdeckungen beeinflusst worden, wie zum Beispiel Hilgards Neo-Dissoziations-Theorie der Hypnose und seine Untersuchungen bezüglich des Phänomens des ”verborgenen Beobachters“ (1977, 1986; siehe auch Nadon et al. 1988). Unsere ersten Konzeptualisierungen der Ego-State-Theorie gehen allerdings auf die frühen 70er-Jahre zurück. Die Arbeiten von Braun (1986), Coons (1984), Kluft (1987), Kluft und Fine (1993), Putnam (1986), Ross (1989) und anderer neuerer Forscher auf dem Gebiet der Dissoziation haben ihr Teil zu den Modifikationen und Entwicklungen von Theorie und Praxis der Psychologie der Ich-Zustände beigetragen.
Wir haben diese Theorie und die entsprechende Praxis in einer Reihe von Workshops vorgestellt (siehe Steckler 1989) und dabei beachtlichen Zuspruch erfahren; manche klinisch arbeitenden Therapeuten haben uns von ihren Behandlungserfolgen berichtet, nachdem sie Patienten unter dem Gesichtspunkt der Multiplizität der Persönlichkeit behandelt hatten. Wir hoffen, dass die weitere Forschung diese Konzepte, die sich aus der praktischen Arbeit ergaben, bestätigen wird.
Keine Form der ”Tiefen“-Psychologie oder der analytischen Behandlung ist denkbar ohne die Anerkennung des gewaltigen Einflusses von Freud und seinen Schülern. Seine Untersuchungen der unbewussten Prozesse und der Abwehrmechanismen, ganz besonders der Verdrängung, sind grundlegend für jede Untersuchung der menschlichen Motivation – sie haben sogar die Hypnose beeinflusst, die er zunächst selbst anwendete und dann verwarf. Wir sind uns bewusst, dass wir den vielen Entdeckungen und Entwicklungen der Psychoanalyse unendlich viel verdanken, und wir wissen, dass das psychoanalytische Denken unsere Theorie und unsere therapeutische Vorgehensweise auf vielfache Weise beeinflusst hat. In der Tat wurde mein (J. G. W.) Interesse an der Erforschung unbewusster Prozesse ursprünglich durch den Prozess meiner persönlichen Analyse und die nachfolgende Ausbildung bei Edoardo Weiss (einem freudianischen Analytiker) sowie durch die hypnotherapeutische Forschung und Praxis geweckt.
Wenn wir im Folgenden unser Konzept der Ego-State-Therapie darlegen, werden wir uns bemühen:
die Quellen aufzuzeigen, aus denen sie entwickelt wurde,
den früheren Forschern, von denen die Konzepte, die wir heute verwenden, zum ersten Mal formuliert wurden, die Anerkennung zu zollen, die ihnen gebührt,
darzulegen, inwiefern wir der Auffassung sind, dass ihr theoretischer Beitrag unvollständig oder unzulänglich ist, wenn es darum geht, Verhaltens- und Erfahrungsphänomene zu erklären,
anzugeben, wo wir den ursprünglichen Konzeptionen von Federn zustimmen und in welchen Punkten wir anderer Auffassung sind,
Modifikationen vorzuschlagen, von denen wir glauben, dass durch sie diese Phänomene verständlicher werden und
auf diesem Verständnis basierende therapeutische Vorgehensweisen zu präsentieren, die wir an unseren Patienten getestet und die sich in der Behandlung als wirksam erwiesen haben.
Die von uns angewendeten Konzepte werden definiert und erklärt, und wir werden Beispiele geben, die sicherstellen sollen, dass der Leser/die Leserin3 sie mit den gleichen Bedeutungen füllt wie wir. In manchen Fällen werden wir Begriffe in einem anderen Sinn gebrauchen, als es bei anderen Theoretikern und Therapeuten üblich ist. Wir wollen versuchen, die Ego-State-Theorie verständlich zu machen, ob sie sich letztendlich nun als gültig erweisen mag oder nicht.
Zwar handelt es sich bei der Ego-State-Therapie um eine analytische Behandlung, sie unterscheidet sich jedoch (sowohl konzeptionell als auch hinsichtlich des praktischen Vorgehens) in signifikanter Weise von der klassischen Psychoanalyse. Wir halten uns an die Theorien von Paul Federn (1943, 1947a, 1947b, 1956), einem langjährigen und engen Mitarbeiter Freuds, sowie an die ausführlichen Darstellungen dieser Theorien durch Edoardo Weiss, Analysand und Schüler Federns, der auf die Entwicklung von Theorie und Therapie der Ich-Zustände gleichfalls großen Einfluss gehabt hat. Federn schlug eine Zwei-Energien-Theorie vor, mit deren Hilfe viele psychologische Phänomene zu erklären sind, für die Freuds Theorie von der einen Energie (Libido) keine ausreichende Erklärung bieten konnte. Weiss (1960, 1966) arbeitete Federns Theorie auf der Grundlage der Psychoanalyse von klinischen Fällen weiter aus. Wir haben sie unter dem Einfluss sowohl experimenteller als auch klinischer Daten noch weiter modifiziert. Wir sind der Überzeugung, dass Federns Konzepte auf einer wesentlich größeren Basis, nämlich bei der Behandlung von Dissoziationsstörungen sowie einem breiten Spektrum anderer psychogener Störungen, angewendet werden können.
Es handelt sich bei der Ego-State-Therapie also um ein Instrumentarium therapeutischer Vorgehensweisen und Strategien, die auf Modifikationen der Theorien von Federn und Weiss beruhen und auch von den anderen in diesem Kapitel genannten Autoren beeinflusst sind. Unser Konzept führt darüber hinaus auch zu einer etwas anderen Betrachtung der normalen Persönlichkeit und ihrer Entwicklung, ihrer Pathologien und ganz besonders der Auffassung davon, was das ”Selbst“ ausmacht.
Anmerkungen
1Dazu gehören Adler (1974), Allport (1955), Freud (1938), Erich Fromm (1964), Fromm (1977), Horney (2000), Jung (1934, 1969), Maslow (1994), May (1982), Piaget (1963, 1966), Rank (1929), Rogers (1997), Sullivan (1980), um nur einige zu nennen, sowie die Beiträge der Objektbeziehungstheoretiker wie Kernberg (1997), Kohut (1996), Mahler (1998), Winnicott (2002) und vieler anderer.
2Eine ausführliche Diskussion des Phänomens der Dissoziation von einem historischen Standpunkt aus findet sich bei Ellenberger (1996).
3Die Autoren sind davon überzeugt, dass die Geschlechter vollkommen gleichberechtigt sind. Gelegentlich werden wir das Personalpronomen ”er“ oder ”sein“ zur Bezeichnung eines menschlichen Wesens jedoch in generalisierendem Sinne gebrauchen (ohne damit auf die Geschlechtszugehörigkeit zu verweisen); wir möchten damit lediglich die stilistische Schwerfälligkeit vermeiden, die aus der häufigen Wiederholung von Wendungen wie ”er/sie“ oder ”sein/ihr“, ”ihn/sie“ oder ”der Leser/die Leserin“ usw. entsteht.
2 Energien und das Funktionieren der Persönlichkeit
Wir erleben unsere Existenz aufgrund von zwei dichotomischen Persönlichkeitsfunktionen: bewusst – unbewusst und Subjekt – Objekt. Zunächst einmal wollen wir definieren, was wir unter jedem dieser Begriffe verstehen, und sie dann auf eine ”Energietheorie“ anwenden, die möglicherweise eine Erklärung bietet für ihre Manifestationen und Veränderungen.
Bewusst – unbewusst
Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir seien uns einer Sache bewusst? Webster’s Dictionary definiert den Begriff ”bewusst“ wie folgt: ”gewahr sein, etwas mit wissen, seine Empfindungen, Gefühle usw. oder äußere Dinge spüren oder wissen; sich seiner selbst als denkendes Wesen bewusst sein; wissen, was man tut und warum, das Gefühl oder das Wissen um die eigene Schuld.“
Aber all diese Definitionen haben als ihren Dreh- und Angelpunkt die Bedeutung des ”Selbst“. Da wir uns selbst erleben, scheint es ganz klar zu sein, was damit gemeint ist, aber sobald wir anfangen, uns mit Dissoziationen, Ich-Zuständen und multiplen Persönlichkeiten zu befassen, wird die Unterscheidung unklar.
In einer anderen Arbeit (J. Watkins 1978a) haben wir formuliert: ”Die menschliche Existenz ist ein Aufeinandereinwirken“, eine Wechselwirkung zwischen einer Entität, die mit Ich- oder Selbst-Energie erfüllt ist, und einem Element, das von einem Objekt oder einer Nicht-Selbst-Energie ”besetzt“ ist. Nach dieser Konzeption wären zwei Parteien involviert, damit so etwas wie Bewusstsein entstehen kann, der Teil, der das ”Sich-bewusst-Machen“ vollbringt, und der Teil, der ”bewusst gemacht wird“. Betrachten wir nun die Aufspaltung des Selbst in Ich-Zustände oder multiple Alter-Personen, dann müssen wir zugeben, dass es sich bei der Feststellung, ein Individuum sei sich einer Sache bewusst, ohne genau zu spezifizieren, was innerhalb der Person bewusst geworden ist, um eine unzulängliche Behauptung handelt.
Wenn die Hand eines Subjekts durch Hypnose dazu gebracht wird, sich nach der Hypnose auf und ab zu bewegen, ist das Subjekt sich dessen bewusst? Gewiss beobachtet das betreffende Individuum, wie sich seine Hand auf und nieder bewegt, aber es betrachtet sie zu diesem Zeitpunkt nicht als Teil seiner selbst. Ihm ist nicht bewusst, warum die Hand sich auf und ab bewegt. Die betreffende Person ist sich nicht bewusst, dass sie das tut. Sie nimmt diese Szene so wahr, als ob sie beobachtete, wie die Hand eines anderen sich auf und ab bewegte. Die Tatsache, dass eine Bewegung, ein Verhalten des eigenen Körpers offen zutage tritt und durch das eigene Selbst oder andere beobachtet werden kann, bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie auch bewusst ist.
Wir würden auch nicht behaupten, dass ein Schlafwandler sich seines Verhaltens bewusst sei, obwohl wir, gesetzt den Fall, wir würden ihn später hypnotisieren und ihn befragen, einen Ich-Zustand aktivieren könnten, einen verborgenen Teil von ihm, der uns möglicherweise sagen könnte: ”Ja. Ich bin letzte Nacht schlafgewandelt, aber er oder sie (die Person, die normalerweise nach außen hin in Erscheinung tritt) wusste davon nichts.“ Würden wir in diesem Fall behaupten, der durch Hypnose aktivierte Zustand sei sich des Verhaltens bewusst gewesen, obwohl dies für die Hauptpersönlichkeit nicht gilt?
Stellen Sie sich einen Dialog zwischen zwei Alter-Personen in einer multiplen Persönlichkeit vor. Wenn die Alter-Person A spricht, ist sie sich bewusst, dass sie es ist, die spricht. Und wenn die Alter-Person B antwortet, nimmt Person A das, was die andere Person sagt, ganz bewusst wahr, aber sie ist sich nicht bewusst, dass sie selbst diejenige ist, die spricht. Würden wir in diesem Fall sagen, die ”Person“ sei sich dessen bewusst, was geschieht? Es scheint also, eine Handlung oder eine Kommunikation kann offenkundig und für andere beobachtbar sein und doch nur einem Teil der Persönlichkeit bewusst sein.
Auf der anderen Seite können wir uns einer geistigen Aktivität, wie zum Beispiel eines Traumes, voll bewusst sein, obwohl kein entsprechendes Verhalten nach außen sichtbar und für andere beobachtbar wird. Auch ”sehen“ wir die Traumbilder, und manchmal haben wir selbst teil an bestimmten Aspekten dieser Traumbilder, wobei wir durchaus das Gefühl haben, wir selbst zu sein; wir können uns beim Aufwachen an die Träume erinnern und unser Verhalten im Traum beschreiben, und doch würden wir nicht sagen, dass es sich beim Träumen um ein bewusstes Verhalten handelt.
Die Menschen können sich ihrer Handlungen sehr wohl bewusst sein und doch die unbewussten Motivationen, die diese Handlungen in Gang setzen, nicht bewusst wahrnehmen. Offensichtlich müssen wir, wenn wir einen Gedanken oder eine Handlung als bewusst etikettieren, detaillierter angeben, was genau bewusst war und wem es bewusst war. Die Tatsache, dass ein Individuum sich eines geistigen Prozesses bewusst ist, seiner Gedanken oder Wahrnehmungen, die ihren Ursprung in seinem Gehirn haben oder von seinem Körper ausgeführt werden – diese Tatsache allein bedeutet nicht, dass der Vorgang bewusst ist. In den meisten Fällen jedoch werden wir, wenn wir die gesamte Persönlichkeit danach absuchen (vielleicht mithilfe der Hypnose), entdecken, dass der geistige Prozess oder die Handlung einem Teil der Gesamtpersönlichkeit bewusst war, einem Teil, der uns sagen kann: ”Ja, ich tat es, und ich hatte die Absicht, es zu tun.“ Aber auch wenn der Vorgang einem oder mehreren Anteilen innerhalb der Person bewusst war, so war er doch anderen unbewusst. Der Grund dafür ist, dass Personen Multiplizitäten sind, nicht Einheiten.
Auch kann es sein, dass eine Handlung einem Individuum bewusst ist und es dafür zur Rechenschaft gezogen wird, obwohl wir vielleicht sagen: ”Er ist sich nicht bewusst, welche Auswirkungen seine Tat auf andere hat.“ Dies stellt die Gerichte vor gewaltige Probleme. An welchem Punkt ist eine Handlungsweise bewusst, und an welchem Punkt genau sollte man das Individuum dafür zur Rechenschaft ziehen? Dieses rechtliche Dilemma wird an anderer Stelle in Hinblick auf spezielle forensische Fälle erörtert (siehe J. Watkins 1976, 1978b, 1989, 1993a).
Subjekt – Objekt
Außer den Kategorien bewusst oder unbewusst bedürfen wir noch einer anderen Dimension, um die menschliche Existenz zu beschreiben. Ich kann mir einer Halluzination bewusst sein, aber ich bin mir nicht bewusst, dass es sich dabei um ”meine“ Gedanken handelt. Bewusst erlebe ich die Halluzinationen als eine Wahrnehmung von Reizen, die von einem Objekt in der Außenwelt ausgehen. Meine Erfahrung ist, dass dieses Objekt außerhalb von mir existiert. Ich bin mir nicht bewusst, wo der Ursprung dieser Erfahrung zu lokalisieren ist. Dementsprechend behaupte ich vielleicht, eine neue Idee stamme von mir, während ich damit tatsächlich bloß eine Wahrnehmung wiederhole, die mir durch eine andere Person zuteil wurde. In diesem Fall bin ich mir der Wahrnehmung bewusst, verlege ihren Ursprung aber in einen kreativen Prozess innerhalb meines eigenen Selbst. Die Tatsache allein, dass ich mir einer Sache bewusst bin (einer Wahrnehmung oder eines Gedankens), gibt ganz offensichtlich keine adäquate Beschreibung meiner wirklichen ”Existenz“. Es ist noch ein anderer Prozess involviert. Dieser Prozess ist mit dem Phänomen Subjekt – Objekt zu umschreiben.
Wenn wir von Subjekt sprechen, dann sprechen wir nicht nur von etwas, das erfahren wird, sondern wir sprechen zugleich von etwas, das als Reiz erfahren wird, dessen Ursprung in meinem eigenen Selbst liegt, in mir. Wenn ich eine Hand auf und ab bewege, dann bin ich das, es ist mein Selbst, das die Hand bewegt. Wenn ich mir eines Gedankens bewusst bin, dann habe ich das Gefühl, er stamme von mir. Es ist mein Gedanke. So gesehen, ist meine Existenz durch die Erfahrung definiert, dass mein Selbst der Ort ist, von dem jene Reize ausgehen, die mein Bewusstsein, mein Gewahrsein wachrufen.
Manchmal beinhaltet meine existenzielle Erfahrung sowohl innere als auch äußere Reize, zum Beispiel dann, wenn ich einen Roman lese. Die kleinen schwarzen Zeichen auf der Seite, die außerhalb von mir existieren (Objekte), setzen in mir Reizmuster in Gang, die ich normalerweise erlebe, wenn ich etwas in der Außenwelt beobachte, ein Spiel oder die Tätigkeiten anderer Menschen. Der genaue Inhalt der Bilder jedoch, in denen ich das Drama der erzählten Geschichte erlebe, wird durch innere Reize näher bestimmt. Meine Existenzerfahrung zu diesem Zeitpunkt ist sowohl subjektiver als auch objektiver Art.
Diese duale Natur des inneren Bildes wird ganz offensichtlich, wenn zum Beispiel jemand den folgenden Satz liest: ”Das Mädchen rannte die Straße hinab.“ Bittet man die Leser oder die Leserinnen, ihre inneren Bilder zu beschreiben, dann wird der eine sagen, das Mädchen sei blond, ein anderer, sie sei brünett. Das Bild eines ”Mädchens, das die Straße hinabrennt“ wird durch den externen Stimulus des gedruckten Wortes in Gang gesetzt, gehört also zur Objektwelt. Die Ausführung im Detail jedoch, die Vorstellung zum Beispiel, dass das Mädchen blond ist, stammt von einem internen, persönlichen Stimulus und gehört daher zur Welt des Subjekts.
Die Tatsache, dass Zeugenaussagen durch innere Stimuli, die nicht aus der direkten Beobachtung eines äußeren Ereignisses stammen, verfälscht werden, spielt bei der gerichtlichen Beweisführung eine nicht unbeachtliche Rolle. Es ist schon häufig untersucht worden, in welchem Ausmaß Berichte von Augenzeugen – mit und ohne Hypnose – auf diese Weise beeinträchtigt sind (Hilgard a. Loftus 1979; Loftus 1979; J. Watkins 1989, 1993a).
Am besten ist dieser Sachverhalt, dass nämlich jeder psychologische Vorgang entweder Subjekt oder Objekt sein kann, an den Träumen zu beobachten. Stellen Sie sich Folgendes vor:
”Ich träumte von einem Mann, der einen kleinen Jungen schlug, aber es war mir egal. Ich erkannte keinen von beiden.“ In diesem Fall werden beide, der Mann und der Junge, als Objekt betrachtet, nicht als Teil des Selbst. Der Träumer ist davon nicht berührt, es ist ihm ”egal“.
”Ich träumte von einem Mann, der einen kleinen Jungen schlug, der Junge tat mir Leid. Er hatte das nicht verdient.“ Auch in diesem Fall behandelt der Träumer beide, den Mann und den Jungen, als Objekte, aber er beginnt in gewisser Weise, sich auf den Jungen ”einzustimmen“, was wiederum den Eindruck erweckt, dass er auf dem Wege ist, sich mit dem Jungen zu identifizieren. Er ”fühlt mit dem Jungen mit“, es ergibt sich eine Art von ”affektiver Identifikation“.
”Ich träumte von einem Mann, der einen Jungen schlug; der Junge sah aus wie ich.“ Dem Träumer geht eine affektive Identifikation ab, kognitiv und visuell jedoch bringt er eine gewisse Verwandtschaft zum Ausdruck. Der Junge ist nach wie vor Objekt.
”Ich träumte, dass mein Vater mich verprügelte, und es tat sehr weh.“ Die Identifikation mit dem Jungen ist vollständig. Der Junge ist nun Subjekt geworden, ein Teil des Selbst des Träumenden (er sagt ”mich“), während der Vater noch immer Objekt ist.
”Ich träumte, dass ich meinem Sohn den Hintern versohlte, weil er ungezogen gewesen war.“ In diesem Fall identifiziert sich der Träumer mit dem Mann und betrachtet den Jungen als Objekt. Er hat sich mit seinem Vater identifiziert, der nun als Subjekt erfahren wird, als Teil seines eigenen Selbst.
Es liegt auf der Hand, dass all diese Traumerfahrungen aus derselben psychischen Quelle stammen. Es handelt sich jedes Mal um den gleichen Traum, der jedoch auf unterschiedliche Weisen erlebt wird, je nachdem, welche Elemente vom Träumer zum Subjekt und welche zum Objekt gemacht werden.
Ein innerer Stimulus kann von einem Teil der Persönlichkeit als Subjekt und zugleich von einem andern Persönlichkeitsanteil als Objekt erfahren werden. Eine multiple Persönlichkeit, eine Frau mit dem Namen Jane, beschrieb folgenden Traum: Sie stand neben ihrem Freund in einem Lebensmittelgeschäft, als ein maskierter Mann in den Laden hereinstürzte und schoss. Sie schrie laut und wachte voller Panik auf. Etwas später während der Sitzung tauchte eine Alter-Person auf, die bisher im Hintergrund geblieben war, mit dem Namen Lynne, und beschrieb spontan einen Traum, den sie gehabt hatte. In diesem Traum ging sie in einer Nebenstraße an einem Supermarkt entlang, als eine schwarzer Wagen neben ihr anhielt. Ein maskierter Mann mit einem Gewehr stieg heraus und rannte in den Supermarkt. Dann hörte sie einen Schuss und einen Schrei. Beachten Sie, dass Jane die Traumerfahrung gemacht hatte, dass ”Ich schrie“; der Schrei war also eine Subjekterfahrung. Für Lynne, die einen anderen Ich-Zustand im gleichen Körper repräsentierte, war derselbe Stimulus eine Objekterfahrung: ”Ich hörte einen Schrei.“
Subjektive Erfahrungen sind einer Verifikation nicht direkt zugänglich, wie es bei objektiven Erfahrungen der Fall ist. Das ist der Grund dafür, dass Behavioristen sie als Quellen wissenschaftlicher Datenerhebung auszuschließen versuchten. Nach Auffassung der Behavioristen sollte eine methodisch saubere psychologische Untersuchung nur Beobachtungen zum Gegenstand der Forschung machen, die von äußeren Beobachtern unabhängig wahrgenommen werden können – eine Haltung, die Witze wie diesen hervorgebracht hat: Der Behaviorist betritt eines Morgens das Institut und sagt zu einem Kollegen: ”Dir geht’s gut. Wie geht’s mir?“
Wir räumen selbstverständlich ein, dass Berichte von subjektiven Erfahrungen in stärkerem Maße Gefahr laufen, keine exakten oder verfälschte Wahrnehmungen zu beschreiben, aber wir können solche Daten dennoch nicht ignorieren, ohne einen großen Teil und vielleicht den bedeutsamsten Aspekt der menschlichen Existenz preiszugeben. Wir können subjektive Erfahrungen mithilfe verbaler Berichte (Introspektionen)1evaluieren wie auch durch indirekte objektive Beobachtungen von Verhaltensweisen, die normalerweise mit ihnen verknüpft sind – zum Beispiel das spontane ”Autsch“, das einer Person herausfährt, die einem schmerzhaften Reiz ausgesetzt ist.
Wir müssen unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf beide Formen der Erfahrung, auf die Subjekt- wie auf die Objekterfahrungen, lenken, wir müssen auch in der Lage sein, sie zu benennen und festzustellen, wie viel an einer Erfahrung mit dem Subjekt, also mit inneren Reizen, und wie viel mit äußeren Objektreizen zusammenhängt. Das Unvermögen, diese Unterscheidung zu treffen, ist die Ursache dafür, dass häufig falsche Schlüsse aus psychologischen Experimenten gezogen werden. Die Interpretation eines Geschehens oder dessen, was eine Person gerade tut, vom inneren, subjektiven Standpunkt des Betreffenden aus kann manchmal die wirklich signifikante Erkenntnis eines Experiments beinhalten.
Ein älterer Junge, der den anderen beweisen wollte, wie dumm sein kleiner Bruder war, zeigte dem Jüngeren im Beisein seiner Freunde ein Fünf-Cent-Stück und ein Zehn-Cent-Stück und forderte ihn auf, sich eines von den beiden Geldstücken auszusuchen. Der Kleine nahm jedes Mal das Fünf-Cent-Stück, sehr zum Amüsement der Umstehenden, die glaubten, er habe seine Wahl nach der Größe des Geldstücks getroffen. Als der Jüngere später gefragt wurde, sagte er: ”Ich nehme das Fünf-Cent-Stück, denn so bekomme ich am Ende mehr Geld zusammen. Wenn ich nur ein einziges Mal das Zehn-Cent-Stück nehmen würde, würde mein Bruder das nie mehr machen.“ Objektive Beobachtung allein kann häufig irreführend sein.
Dieses Buch macht stets aufs Neue deutlich, dass die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt in der Hypnose, bei der Behandlung multipler Persönlichkeiten und in der Therapie von Ich-Zuständen von besonderer Bedeutung ist. Unser Verständnis von geistig-seelischen Phänomenen jeder Art wird immer fehlerhaft bleiben, solange wir sie nicht unter beiden Perspektiven betrachten, der Subjekt- wie der Objektperspektive.
Nachdem wir klar gestellt haben, was wir unter den Begriffen bewusst, unbewusst, Subjekt und Objekt verstehen, können wir uns nun der Energietheorie zuwenden, die Paul Federn (1956) entwickelt hat und die für uns die theoretische Grundlage für diese Begriffe darstellt – obwohl Federn selbst und auch sein Schüler Edoardo Weiss (1960) ihre Konzeptionen eigentlich nie auf die Phänomene, mit denen wir uns hier befassen, nämlich Hypnose und multiple Persönlichkeit, angewandt haben.
Die Ich-Psychologie von Paul Federn
Federn (1928,1932,1943,1947a, 1947b, 1956) war einer der frühesten und treuesten Schüler von Sigmund Freud, der die Beziehung zu ihm stets aufrechterhielt, von 1903 bis zu Freuds Tod im Jahre 1939. Federn wird von seinen Zeitgenossen als ein Mann mit breiten wissenschaftlichen und literarischen Interessen und als einfühlsamer, kreativer Therapeut beschrieben. Auch war er ein überaus produktiver Schriftsteller, dem viele kreative Modifikationen der Psychoanalyse zu verdanken sind, insbesondere auf dem Gebiet der Ich-Psychologie. Leider wurden seine Auffassungen von den meisten anderen Psychoanalytikern nicht verstanden. Federn war ein bescheidener Mensch und neigte dazu, seine eigenen Innovationen denen von Freud unterzuordnen. Während der heftigen theoretischen Auseinandersetzungen in der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft war er einer von denen, deren Stimme eher leise und mäßigend zu vernehmen war.
Nach der Besetzung Österreichs durch die Nazis im Jahre 1938 zog Federn nach New York. Er litt an depressiven Verstimmungen, und stets begleitete ihn der Gedanke, dass er seinem Leben eines Tages selbst ein Ende setzen würde – was er, nachdem er unheilbar an Krebs erkrankt war, auch tat. Er überlebte Freud um elf Jahre.
Federns Auffassungen vom Ich unterschieden sich in wesentlichen Aspekten von denen der anderen Ich-Psychologen innerhalb der psychoanalytischen Bewegung, wie Hartmann (1970), Kris (1951), Rappaport (1967), sowie auch von denen der viel späteren Objektbeziehungstheoretiker, zu denen Guntrip (1971), Jacobson (1954), Kernberg (1997), Kohut (1996) und Winnicott (2002) gehörten. Tatsächlich hatte Federn viele von den Beiträgen der späteren Objektbeziehungstheoretiker bereits vorweggenommen, ganz besonders, was die Ich-Zustände betraf; er verwendete allerdings eine etwas andere Terminologie, die von seinen Kollegen nicht richtig verstanden wurde. Das hing zum Teil auch mit dem Stil seiner Publikationen zusammen. Seine theoretischen Konzeptionen sind selbst dann, wenn sie aus dem deutschen Begriffsapparat ins Englische übertragen werden, sehr komplex und schwer zu verstehen. Wir werden versuchen, hier nur jene Teile seines Denkens darzustellen, die für die Theorie und Praxis der Ego-State-Therapie relevant sind. Eine etwas detailliertere Darstellung findet sich in J. Watkins The therapeutic self (1978a).
Federns Theorie von den zwei Energien
Freud entwickelte seine Libidotheorie (1905, 1922), um die Energieströme zu erklären, die aus seiner Sicht die verschiedenen psychischen Prozesse aktivierten. Die Libidotheorie brachte jedoch viele Schwierigkeiten mit sich, zum Teil deshalb, weil Freud (1923) diese Energie als eine ihrem Wesen nach erotische Energie beschrieb. Andere Autoren (Jung 1969) gebrauchten den Begriff im Sinne einer Art von ”psychischer“ oder Lebensenergie, und im Laufe der Zeit nahm das Wort eine Vielzahl von Bedeutungen an. Freud gebrauchte das Wort Besetzung (cathexis) mit libidinöser Energie, um auf eine Energieladung hinzuweisen, die einen Prozess aktivierte. Wenn also die innere Vorstellung eines anderen Individuums ”libidinös besetzt“ war, dann bedeutete das, sie war mit erotischer Energie besetzt, wodurch das betreffende Individuum zu einem Liebesobjekt wurde. Man könnte sagen, es ist so, als ob man in einem dunklen Zimmer einen Scheinwerfer auf eine andere Person richtete. Diese Person würde sich nun von anderen Aspekten der Umgebung abheben. Die Libido war also nicht nur eine erotische Energie, sondern auch eine Objektenergie, da Objekte, die in dieser Weise besetzt waren, energiegeladen und bedeutsam wurden, aber sie waren außerhalb des Selbst.
Beim Narzissmus, so stellte Freud (1914) fest, lenkt das Individuum diese libidinöse Energie auf das Ich zurück. Er nannte sie Ich-Libido. Es handelte sich jedoch um dieselbe Energie, nur hatte sie die Richtung geändert, sie richtete sich nicht nach außen, sondern nach innen.
Federn war der Auffassung, dass eine einzige Art von Energie, die Libido, nicht all die Verästelungen des Energieflusses erklären konnte, und kam zu dem Schluss, dass es sich bei der Ich-Libido nicht um dieselbe Energie handelte, die ihr Ziel bloß in einer anderen Richtung suchte, sondern qualitativ gesprochen um eine vollkommen andere Art von Energie als die gewöhnliche Libido. Er gab den Begriff ”Libido“ im Laufe der Zeit auf und bezog sich immer häufiger auf zwei verschiedene Arten von Energien: die Objektbesetzung und die Ichbesetzung.
Aus Federns Sicht war keine dieser Energien sexueller Natur, obgleich das, was er unter Objektbesetzung verstand, Freuds Libidobegriff ähnlich war. Der große Unterschied war dieser: Wenn ein mentaler Prozess eine Objektbesetzung erfuhr, dann machte diese Energie allein dadurch, dass sie sich darauf (den mentalen Prozess) richtete, dieses Element zu einem Objekt. Wenn also die Wahrnehmung (Perzeption) einer anderen Person eine Objektbesetzung erfuhr und in dieser Form erfahren und aufgenommen wurde und wenn diese Objektbesetzung mehr oder weniger dauerhaft war, dann wurde sie zu einem inneren Objekt, einem Introjekt oder einer Objektrepräsentanz.
Die Quantität der Objektbesetzung, die das Objekt erfährt, bestimmt, wie wichtig es ist. So könnte man die Objektbesetzung mit der Elektrizität vergleichen, die einen Motor antreibt – je größer der Energiebetrag, umso stärker ist der Motor und umso höher die Geschwindigkeit. Die Besetzung, ein Quantum an Energie, stellt wie die Elektrizität, die einen Motor antreibt, die Kraft bereit, die einen psychischen Prozess aktiviert. Wenn sie objektbesetzt ist, dann wird die innere Vorstellung vom Individuum als Objekt wahrgenommen, nicht als ein Teil des Selbst. Eine Objektbesetzung ist eine von außen kommende, auf ein ”Es“ bezogene Energie, die aufgrund ihrer Besetzung (investment) dafür sorgt, dass das so besetzte Element oder jeder auf diese Weise besetzte psychische Vorgang als ”Nicht-Ich“ erfahren wird. Ist das innere Bild meines Bruders mit einer Ich-Besetzung aufgeladen, dann erfahre ich ihn als Perzeption. Die Frage, ob eine innere Repräsentanz zu einem Objekt oder zu einem Subjekt wird, hängt also von der Art der Energie ab, mit der sie besetzt ist.
Federn konzeptualisierte die Ich-Besetzung als Selbst-Energie (energy of selfness), und alles, was in dieser Weise besetzt war, wurde seiner Auffassung nach erfahren als etwas, das sich innerhalb des eigenen Selbst befand, als ein Teil des ”Ich“. Dehnt man das Konzept noch weiter aus, dann ist Ich-Besetzung nicht nur die Energie des Selbst, sie ist das Selbst. Das Selbst ist eine Energie, nicht ein Inhalt, eine Energie, die nur ein Merkmal hat, das Gefühl des Selbst. Federn (1956, S. 60) charakterisierte dieses ”Ichgefühl“ als ”das Gesamtgefühl der eigenen lebendigen Person; es bleibt übrig, wenn alle gedanklichen Inhalte fehlen …“
Diese Energie ist, wenn sie als Besetzungsenergie auftritt oder auf irgendein psychisches oder physisches Element der Person ausgedehnt wird, die Grundlage für das Gefühl einer ”zusammenhängenden Einheit“ (ebd., p. 182) mit Blick auf Kontinuität, Kontiguität und Kausalität in der Erfahrung des Individuums. Ja, Federn (ebd., p.172) stellte darüber hinaus fest: ”Weil dem Ich bestimmte Funktionen vorbehalten sind, ist die gewohnte Verwendung des Wortes ‚Ich‛ als einer Bezeichnung für ein Aggregat wohl bekannter und wichtiger Funktionen gerechtfertigt. Doch ist dieses Aggregat nicht einfach die Summe der Funktionen, sondern ist die einigende Besetzung, die aus dem Aggregat ein eigenes seelisches Gebilde macht.“
Wenn ein Teil meines Körpers, zum Beispiel mein Arm, eine Ich-Besetzung erfahren hat, dann erlebe ich ihn als ”meinen Arm“. Wenn ein Gedanke mit dieser Art von Energie aufgeladen ist, dann erfahre ich ihn als ”meinen Gedanken“. Jedes kör





























