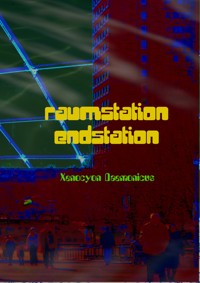3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Existentielles Wer bin ich und was bin ich? Eine Frage, die sich viele in ihrem Leben stellen dürften, die sich in ihrer Umgebung fremd vorkommen und irgendwie nicht in ihren Körper oder Bewusstsein zu passen scheinen. Das zeigt auch das Leben von Tino, der über eine eigenartige Fähigkeit und Sichtweise verfügt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Xenocyon Daemonicus
EGO
Kontaktlicht
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Beginn
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
3
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
5
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
7
8
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
10
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
12
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
14
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
16
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
18
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
20
Fortschritt
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
22
23
24
25
26
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
28
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
30
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
32
┼╖╙┼╫╞╗╬╧╦
34
Gipfel
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
36
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
38
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
40
41
42
43
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
45
46
47
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
49
50
51
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
53
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
55
Stillstand
56
57
58
┼╖╙┼╫╞╗╬╧╦
60
61
62
63
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
65
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
67
68
69
70
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
72
73
Rückgang
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
75
76
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Abgang
Rückkehr
Nachwort
Wörterbuch - Auszug
Impressum neobooks
Prolog
Jede Lebensform ist seit jeher bestrebt zu kommunizieren. Ob innerhalb der eigenen Gruppe, generell mit Artgenossen oder sogar mit anderen Spezies. Wobei man sagen muss, dass sich das Gespräch mit seinesgleichen schon schwierig gestaltet. Aber mit völlig Fremden... erst recht. Vor allem wenn beide Arten nicht einmal ansatzweise einer gemeinsamen Gattung, geschweige denn Ordnung angehören.
Wenn alle Gesprächspartner nicht einmal von derselben Lebensquelle stammen, ist das Ganze fast schon unmöglich. So viel dazu.
Nicht einmal auf dem eigenen Planeten können sich zwei verschiedene Arten gut verständigen. Klar, die Basis ist immer Futter, jemanden wegdrängen oder nichts tun. Wie der Gegenpart das Ganze interpretiert, steht auf einem anderen Blatt... Selbst das Auslöschen eines Wesens ist eine Art der Kommunikation. Man könnte das Ganze unter anderem mit: „Du bist hier unerwünscht!“ übersetzen.
Die Grundbedürfnisse nach Nahrung, Sicherheit, Fortpflanzung und Raum sind stets gleich. Die genaueren Spezifikationen können höchst unterschiedlich sein. Was für den einen ein leckerer Snack ist, stellt für einen anderen ein tödliches Gift dar.
Der eine pflanzt sich durch geschlechtliche Interaktion fort und der andere durch Parthenogenese. Die Sinnesspektren und -schwerpunkte der einzelnen Arten variieren ebenso stark. Genau wie die Anatomie, die Art der Fortbewegung, sowie das Medium, in dem man sich befindet.
Das alles wirkt sich natürlich auf die Denkweise und damit auf die Kommunikation aus. Und auch die kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: Durch Geruch, durch Berührungen, durch Farbwechsel, durch Gesten, durch Schall oder andere, mir unbekannte und unbegreifliche Formen. Nicht zu vergessen die Bilder und Schriftzeichen.
Als unsere intergalaktische Föderation in den Kinderschuhen steckte, beziehungsweise unsere Technologie schon so weit fortgeschritten war, dass sie Raumfahrt und andere technische Spielereien zuließ, mussten wir unsere Erfahrungen mit den Spezies des eigenen Planeten nutzen, um uns früher oder später mit den Völkern anderer Himmelskörper auseinanderzusetzen.
Das gelang den Fortgeschrittensten von uns auch zunehmend besser. Na ja... Anfangs gab es Konflikte. Und das nicht zu knapp. In vielen Millionen Jahren wurden mehr Planeten ausgelöscht und Leben beendet, als man zählen konnte – vor allem wenn man noch sämtliche existierenden Kleinstlebewesen in die Kalkulation mit einbezog... Damit wurde zugleich auch das Potential von noch unbekannten und unentwickelten Lebewesen und deren Denkweise, die sie andernfalls hätten entwickeln können und vor allem Wissen, unwiederbringlich vernichtet.
Irgendwann hatten die Vordenker der einzelnen Völker genug von all der Verschwendung von Ressourcen und auch von genetischen Informationen, setzten sich auf die Entsprechungen ihrer Hinterteile und versuchten Lösungen zu liefern, um die allgemeine Verständigung mit anderen Völkern möglich zu machen. Zur allgemeinen Erleichterung. Auch wenn es immer seltener wurde, dass man Teile der Bevölkerung dazu zwang, im direkten Kampf gegeneinander anzutreten, war es nicht ganz ausgeschlossen, dass eine Kommunikation schief lief, das Ganze eskalierte und die Bevölkerung von einer Gegenpartei aufgerieben, beraubt, versklavt, getötet oder einfach aufgefressen wurde.
Anfangs geschah die allgemeine speziesübergreifende Kommunikation über einfache auf Binärzahlen basierende Symbole. Als man sich über komplexere Sachverhalte austauschen konnte und auch musste, weil sich der Informationsgehalt verdichtete – neben dem Fortschritt, welchen die Technologien aller größeren Weltraumzivilisationen machten – fand man die Möglichkeit der Datenübertragung durch Licht.
Und als sich der Staatenbund über mehrere tausend Lichtjahre erstreckte, reichte auch das nicht mehr aus und kluge Köpfe ersannen Gerätschaften, mit denen man die Naturkonstante der Lichtgeschwindigkeit überwinden konnte.
Das wirkte sich nicht nur auf die Raumfahrt, sondern auch auf die Kommunikation aus. Jeder Planet, jede Kolonie – egal wer dazu in der Lage war, konnte an das Überlichtnetzwerk angeschlossen werden und mit anderen Zivilisationen in Austausch zu treten.
Dabei traten gewisse Nebeneffekte auf, die man sich zunutze machen konnte: Man konnte sogar Gedanken, Gefühle oder Bewusstseinsinhalte von einem Ort des Universums zu einem anderen schicken. Davon wurde auch reger Gebrauch gemacht. Primitive Welten heimlich beobachten oder sogar auf deren Entwicklung günstigen Einfluss nehmen.
Vor allem wenn fast alle hochentwickelten Völker diese Möglichkeit nutzten. Man hatte dabei nur einen Nachteil: Ein Beobachter konnte nicht direkt und im Sinne der Allgemeinheit handeln, hatte während seiner Mission keinerlei Erinnerung an sein eigentliches Selbst, sondern war zur Untätigkeit verdammt und als handelndes Organ nutzlos. Abgesehen davon, dass das Individuum, zu dem man dann wurde, sich in der Regel noch in einem Embryonalstadium befinden und sogar einen bestimmten Genmarker aufweisen musste. (Letzteres war kein Problem, denn als Nebenwirkung der Überlichtkommunikation wurden ohnehin überall Streupartikel verteilt, die solche Spontanmutationen überhaupt erst ermöglichten...)
Und wenn die Spezies, welche man solcherart unterwanderte, hinreichend (un)sensibel war, wurden solche Außenseiter, denen man oft ansah, dass etwas nicht den Regeln entsprach, oft gemieden, davon gejagt oder sogleich umgebracht. (Was oft sogar die weniger grausame Weise war, mit denen umzugehen.)
Man konnte als Beobachter seinen Körper also zwischenlagern, um sein Bewusstsein auf Reisen an weit entfernte Orte zu schicken, wo man mit viel Glück ein komplettes Leben aus der Sicht eines primitiveren Planetenbewohners führen konnte und nach dessen Ableben wieder zurückkehrte, um anhand der veränderten Überlichtdaten die Beobachtungen zu analysieren und das eigentliche Leben weiterzuführen. Vorausgesetzt der Fremdeinfluss auf den Beobachter war nicht zu groß geworden...
Manchmal nahmen Beobachter, denen immer ein Rest ihres eigentlichen Seins anrüchig war, doch einen Einfluss auf die Gastspezies – es kam ganz darauf an, wie freigeistig oder engstirnig diese im Normalfall war...
Soviel zum Status quo, in den ich hineingeboren wurde; ein einfacher Bewohner unter Abertausenden in dieser abgelegenen Kolonie. Ich spielte schon lange mit der glorreichen Idee, mich für einen Einsatz als Beobachter freiwillig zu melden.
Über mein Leben gibt es wenig zu sagen. Ich lebe in meinem Familienverband, tue meine Pflicht in der Arbeitslotterie, wenn ich entweder Lebensmittel herstelle, technische Bauteile zusammensetze oder bei der Aufzucht und Erziehung des Nachwuchses helfe.
Ich bin ein Kregg1, wie etwa ein Drittel der Einwohner der Station, die ich bewohne und hoffe, irgendwann eine Wlegg und ein Tegg zu finden, um irgendwann eine eigene Familieneinheit innerhalb meines Klans bilden zu können.
Dazu bräuchte ich eben noch einiges an Leistungen, welche ich für das Wohl der Kolonie erbringen muss, ehe ich mir das Anrecht zur Familiengründung verdienen kann, beziehungsweise die Zuweisung einer eigenen Wohneinheit und notfalls vom Computer ausgewählter genetisch und psychologisch geeigneter Hanagg.
Einen Namen besitze ich in dem Sinn nicht. Wozu auch? So eine Art Individualbezeichnung ist in unserer Gemeinschaft völlig überflüssig. Innerhalb von persönlichen Kontakten brauchten wir auch nichts dergleichen. Nur eine Kombination aus Laut- und Zählzeichen dient für offizielle Vorgänge zu meiner Identifikation.
Jeder mit entsprechenden Implantaten oder Lesegeräten versehene Bürger wäre dazu in der Lage, mich damit als Individuum von anderen zu unterscheiden. Normalerweise taten das vorrangig die Administration, deren Ordnungskräfte oder Verwalter. Darüber hinaus gab es olfaktorische Merkmale und solche anhand meines Erscheinungsbildes. Das Fleckenmuster, beziehungsweise die Anordnung der knotigen, eng nebeneinander liegenden Schuppen auf meiner Haut unterschied mich von anderen meiner Art. Genau so wie die äußerlichen Eigenheiten meiner Mitbürger sich für mich abhoben. Es waren subtile Details, aber durchaus vorhanden.
Zu jeder Zeit kriechen viele Bürger – unterwegs zu ihren zugewiesenen Aufgaben – die Tunnel und Röhren der Kolonie entlang. Die langen, schuppigen flexiblen Leiber bewegen sich normalerweise mittels ihrer sechs gelenkigen Extremitäten auf speziell dafür angepassten Fortsätzen – ein altes Erbe unserer kletternden Vorfahren – und tragen manchmal ihre Gebrauchswerkzeuge in ihren Greifern. Alle diese Glieder enden in drei beweglichen, gliedrigen und opponierbaren Fingern. Nur dass sie als Füße benutzt, nun eher flach und breit wurden – sowohl zum gröberen Festhalten an Griffen als auch zum Anhaften an glatten Oberflächen – und als Manipulatoren gebraucht, runder, dünner, beweglicher und somit für feinere Aufgaben geeignet waren. Jede der sechs Extremitäten war somit sowohl Hand als auch Fuß.
Ich reihte mich, wie zu Beginn jeder Arbeitsschicht – geleitet von meinem Interkom – dem stetigen Strom von Arbeitern oder solchen Individuen, die gerade ihre Freischicht hatten, ein und vollbrachte meine zugewiesenen Aufgaben, ehe ich am Ende meines Pensums meine Zuteilung an Nahrungseinheiten zu mir nahm, bevor ich mich zurück in die Wohneinheit meiner Familie begab. Jeden Zyklus aufs Neue...
Am liebsten würde ich mich dem entziehen, nachdem meine Wlekretegoi erneut weiteren Wnukan’gogg ausgebrütet hatten. Wieder neun neue Vamiwnugg, welche die nächsten Wochen ziemlich turbulent werden ließen, wenn sie sich überall herumtrieben, alles mögliche selbstständig austesteten, bevor sie nach vielen, vielen Wsesenaron endlich Bewusstsein besaßen, weitreichend in Wnadnaboldamatkardo ausgebildet würden und ihre ersten Implantate bekommen sollten, die ebendies zusätzlich bescheunigten.
Als Stationsgeborene wussten wir alle, dass alles straffer durchorganisiert war als es auf einem der von meiner Art besiedelten Planeten der Fall war. Selbst die Notdurft wurde hier nach Plan verrichtet. Nicht einmal das konnte man in Ruhe...
Etwas riss mich aus meinen internen Gedankengängen, während meine sechs Füße ihren Weg wie von alleine fanden und meine drei Augen immer den Verkehrsfluss beachteten.
„Pass doch auf!“, rief mir mein Nachbar zu, als ich ihn einmal versehentlich streifte. Der Geruch des anderen verriet mir, dass er eine Sie war – ein Wlegg. Ihre Farbe verriet mir ihre Verärgerung; ebenso die Art und Weise, in der sie die Worte geklickert hatte. Die Vokale klangen bereits wie eine Metallsäge und die Aussprache der Konsonanten verwischte schon.
Eines meiner Augen erkannte, was geschehen war. Bei unserem Zusammenstoß hatte sie vor Schreck eines ihrer Geräte verloren. Das Ding trudelte bereits schwerelos mitten im Tunnel und war unerreichbar für einen meiner oder ihrer Arme. Aber nicht für meine Zunge. Gezielt ließ ich sie hervorschnellen und erwischte das Gerät – einen Kommunikator, welcher bereits einen Anruf signalisierte – bevor es außer Reichweite war.
Normalerweise war dies eine Unsitte aus der Zeit unserer primitiven Vorfahren, wenn sie nach Beute jagten, aber was soll’s. Eine andere Möglichkeit sah ich nicht, meinen Patzer wieder gut zu machen. Ich fuhr meine Zunge wieder ein, nahm den Apparat in eine meiner Greifer, um ihn ihr zu reichen.
„Verzeihung, Bürgerin“, machte ich sichtlich zerknirscht wegen meiner geistigen Abwesenheit.
Sie scannte mich daraufhin und schien sich meine Identnummer gut merken zu wollen. Ich tat es ihr nach.
Sie erwiderte: „Schon gut, ist ja nichts weiter passiert... Wir sollten uns beeilen, wir sind spät dran.“ Vor allem, weil sie nicht nur den Anruf, sondern weitergehende schriftliche Nachrichten auf dem Kommunikator ablas.
Jetzt dämmerte es mir: Sie arbeitete in der gleichen Schicht wie ich. Aber weil auf der Arbeit niemand wirklich sprach, sondern alle Kommunikation zentral über den Hauptrechner lief und zudem alles über Pheromone gesteuert wurde, nahm man einander kaum als Individuum wahr, sondern als einen ein großes Ganzes – einen Schwarm.
Sie schaffte es noch, mir etwas mitzuteilen, bevor wir für die Zeit des Dienstes nicht mehr dazu in der Lage sein würden: „Wir werden uns in der Freischicht in Ruhe unterhalten. Du interessierst mich!“
Die Wirkung der Pheromone und die Steuerung durch das Interkom übernahm nun den Körper eines jeden von uns, sodass wir uns im Kollektiv in ein Nichts aus Allem auflösten...
…
Erst als die heutige Arbeitszeit abgeleistet war, verlor sich die vereinheitlichende Wirkung der Geruchsstoffe und mein Ich-Bewusstsein übernahm wieder meinen Körper.
Ich reflektierte noch einmal den morgendlichen Zusammenstoß und ärgerte mich einerseits über den Umstand dass man die Pheromone schon nicht die Verkehrsadern steuern ließ oder doch die Interkom. Aber andererseits hatte ich deswegen die unverhoffte Begegnung mit der Person, auf die ich nun neugierig wartete...
Jemand berührte sanft meine schuppige Haut, sodass ich kurz aufschreckte.
„Du bis anscheinend immer so in Gedanken versunken“, lachte sie und registrierte sehr wohl meine Färbung, die ich aufgrund ihrer Berührung angenommen hatte. Ich blickte auf einen meiner Arme und stellte fest, dass meine Haut der Schattierung einer sexuellen Erregung entsprach und schämte mich nun für diese öffentliche Entgleisung.
Anscheinend war sie in etwa so jung wie ich und nicht minder verlegen, während einige ältere Kollegen, welche soeben an uns vorbei krochen, wissende Schnalzlaute von sich gaben und eine belustigte Hauttönung zeigten.
Auch die Haut meiner Begleiterin zeigte inzwischen dieselben sexuellen Anzeichen wie meine. Wir schauten uns an und taten exakt dasselbe: Wir checkten gegenseitig unsere Identnummern in der Registrierungsstelle für Partnerfragen. Dabei bestätigten wir uns das, was unsere Haut – unsere Körper schon längst wussten. Dann tasteten wir uns gegenseitig ab und befühlten jede Stelle des anderen, um sich die Beschaffenheit der mit unregelmäßig von schuppenartigen Strukturen besehenen Haut genau einzuprägen.
„Zwei hätten wir schon mal, jetzt fehlte nur noch der Dritte im Bunde“, sagte ich schließlich trocken.
Sie lachte und entgegnete: „Humor hast du jedenfalls! Finden sich zwei, kommt der Dritte automatisch hinzu. Ist immer so.“
„Wie viele Punkte hast du schon?“, fragte ich nun.
„Leider noch nicht genug. Und du?“
„Geht mir genau so.“
Wir schlenderten durch die Kolonie – diesmal achteten wir beide besser darauf, dass wir nirgendwo anstießen – und unterhielten uns. Wobei wir auf die Idee kamen, das Arboretum aufzusuchen, welches ein beliebter Treffpunkt für Leute in unserem Alter war. Na ja im Grunde für Leute jeden Alters...
Die uralten riesigen Pflanzen, welche die freiläufige Halle dominierten, zeigten einen Bruchteil der früheren Vielfalt unserer Heimatwelt, welche einige Lichtjahre entfernt lag, aber für die meisten von uns gesperrt war. Sie musste sich erst noch vom Raubbau früherer Jahrtausende erholen.
Jeder von uns wurde vom Instinkt übermannt, sofort in der Borke eines Baumstammes herumzuklettern und das violette Blätterdach nach kleineren Lebensformen abzusuchen.
Das war durchaus nicht verboten, solange man Maß hielt und bewahrte unser Volk davor, hier in diesem Metallkasten eingezwängt, verrückt zu werden.
Die winzigen Tiere – vor allem die vielbeinigen mit dem gegliederten Exoskelett – waren eine willkommene Abwechslung zu der synthetisch aufbereiteten Nahrung, welche aus Algen, Pilzen oder anderen, im Wasser lebenden Wesen bestand.
Wir unterhielten uns angeregt über alles Mögliche, ehe die Zeit uns einholte...
„Wir sollten nach Hause gehen“, wies sie auf meine Haut, welche bereits eine Färbung von Müdigkeit andeutete.
„Durchaus. Du siehst nämlich mindestens so müde aus.“, antwortete ich, hielt einen meiner Arme gegen ihren, um ihr zu verdeutlichen, dass wir beide in etwa dieselbe Farbe hatten. Ich nickte mit dem Kopf, woraufhin wir uns in Bewegung setzten.
Mit etwas Bedauern trennten wir uns, um zu unseren eigenen Familien zurückzukehren.
„Du warst ungewöhnlich lange weg“, stellten meine Wlekretegoi bei meiner Rückkehr in unser Quartier fest.
Meine verbliebenen gleichaltrigen Vamidnugg nickten leicht wissend und die jüngeren krabbelten auf ihren wuseligen Beinen auf uns allen herum, ehe es uns zu viel wurde und wir unwirsch in grelle Farben wechselten. Ein Zeichen, welches selbst unverständigen Kleinkindern klar war.
Wlai rief: „Los, alle ab ins Nest! Die Wnugg haben morgen Unterricht und die Dnugg müssen morgen arbeiten!“
Krai und Tai hielten sich bedeckt wenn es um Angelegenheiten ihrer Wlekretehan ging.
Wir gehorchten alle. Erstens weil man sich besser nicht mit Wlai anlegte und zweitens weil wir einsahen, dass sie recht hatte und wir alle müde waren.
Jeder von uns suchte sich eine der Nischen in den Wänden und kroch hinein. Danach passte sich die Hauttönung unbewusst dem Untergrund an. Ein Erbe unserer tierischen Vorfahren, die sich noch vor gefräßigen Verwandten oder anderen Raubtieren verstecken mussten.
Nach und nach wechselten wir in das dämmrige Unbewusstsein des tiefen Schlafes hinüber, ehe der zyklische Ablauf, den die Station vorgab, wieder unsere Geister ausfüllte...
Mein Punktekonto wuchs nur langsam. Genau wie das meiner Geliebten, was uns beide frustrierte. Wir sannen nach einem Ausweg und fanden einen, den ich schon seit langem im Sinn hatte...
„Beobachter gesucht! Registriere dich jetzt! Hohe Belohnung!“, versprach eine Werbeeinblendung. Auch wenn das hieß, dass wir unsere Körper für lange Zeit würden einfrieren lassen müssen. Und wir uns auch nicht sicher waren, ob wir die Prozedur überlebten...
Wir schoben diese Bedenken beiseite und entschieden uns einstimmig dafür, es darauf ankommen zu lassen. Entweder wir schafften es und bekamen alle Ehrungen, beziehungsweise die Erlaubnis, viel früher als normalerweise eine eigene Vamigoi zu gründen oder eben nicht und wir wurden zur Nahrungsgrundlage für den Rest der Kolonie.
Sobald wir uns registriert hatten, löschte uns das System aus der normalen Arbeitsschicht und ersetzte unsere Stellen durch die Nächstbesten.
Man wies uns eine Frist zu, in der wir die Gelegenheit nutzten, uns erst – ganz wie es sich gehörte – von unseren Angehörigen und uns beide später intensiv voneinander zu verabschieden – egal, was da kommen mochte. Wir berührten einander überall und leckten einander gegenseitig ab. Das Einzige, was zu unserem vollkommenen Glück noch fehlte, war die Hormongabe und die Sporen, die ein Tegg hinzusetzte und uns neben trillernden Lauten, wie nur einer von ihnen sie erzeugen konnte, in die Lage versetzte, richtigen Sex zu haben und uns fortzupflanzen. Ak’hananak’wretekrehan.
Man wies uns dann einen Wartebereich zu, rief irgendwann unsere Nummern via Nachricht auf unseren Interkoms auf und wir warfen uns noch einen letzten Blick zu, wobei wir noch einmal versuchten, uns gegenseitig unser Schuppenmuster und die Hautstruktur abzutasten und einzuprägen. Jeder von uns verschwand in einem anderen Raum, über dessen Durchlass die entsprechende Nummer aufleuchtete und auch nur denjenigen Eintritt gewährte, der diese innehatte.
Dort lag eine Röhre, in die ich hineinkriechen sollte. Sie schloss sich und Elektroden verbanden sich an Schnittstellen zu meinen Implantaten.
Ich wurde nun betäubt, wie ich sehr wohl wusste, damit mein Bewusstsein in die Lage versetzt wurde, ins Überlichtnetzwerk einzugehen und eine weite Reise anzutreten.
Mein Atem verlangsamte sich genau wie mein Pulsschlag.
Mein Sichtfeld trübte sich...
Schwärze umfing mich...
Ein seltsames Licht überwältigte meine interne Wahrnehmung.
Weiß. Aber unterlegt von Farben aus dem ganzen elektromagnetischen Spektrum und sogar aus welchen darüber hinaus.
Mein letzter bewusster Gedanke, den ich formulieren konnte, war: Wohin würde es mich nun verschlagen?
Weiß.
Nichts.
1Pssst! Am Ende der Geschichte befindet sich ein Wörterbuch – der Autor XD. ;)
Beginn
Ich gehöre hier nicht her! Das mochte eines meiner ersten unbewussten Gefühle sein, seit ich zur Welt kam. Wenn ich denn welche hatte. Natürlich konnte von Gedanken anfangs nicht die Rede sein. Auch wenn ich ein Mensch war, wie einer aussah mit einem Kopf, zwei nach vorn ausgerichteten Augen, einer Nase, zwei Ohren, einem Mund.
Ausgestattet mit einem Rumpf, zwei Armen mit Händen mit je fünf beweglichen Fingern und zwei Beinen mit Füßen und je fünf stummeligen und kaum beweglichen Zehen.
Und Geschlechtsorganen, welche zwischen den Beinen herumbaumelten...
Ich fühlte mich schon immer fremd in meinem Körper und empfand diesen als unzulänglich, musste aber das beste aus der Situation machen.
Meine Eltern erzählten mir stets, wie ich die ersten Jahre schrie, gegen Wände schlug oder biss, wenn mir etwas zu viel war oder nicht meinen Vorstellungen entsprach.
Es war mir allerdings andauernd etwas zu viel: Das Licht war seltsam. Es erschien mir fremdartig im Spektrum und in der Helligkeit. Zudem wurde man überall mit Tönen beschallt, die ich nicht zuordnen konnte. Gerüche schwebten durch die Luft, die mich des öfteren nicht nur in der Zusammensetzung oder der Intensität überwältigten. Ohnehin konnte ich erst einmal gar nichts zuordnen.
Immer wenn ich meine Hände ansah – das Einzige, was ich neben meiner Vorderseite und meinen Beinen ohne Zuhilfenahme eines Spiegels sehen konnte – empfand ich sie seltsam. Ich mochte den Anblick nicht.
Oder wenn ich mich irgendwie unabsichtlich selbst berührte. Aber das ging ja noch aus. Ich lernte die ersten Jahre so halbwegs mit den Gegebenheiten umzugehen.
Auch, wenn mich meine Eltern hochhoben oder mich generell anlangten, fühlte sich das seltsam an und der Eindruck einer Fingerkuppe oder einer Handfläche verblieb noch tagelang auf meiner Haut und reizte diese aufs Extremste.
Wie es ihnen sagen? Ich war noch zu klein zum Sprechen. Also konnte ich nur schreien, schlagen oder beißen. Sie gingen natürlich auf mich ein, so gut sie es vermochten. Aber sie verstanden mich nicht – genau so wenig wie ich sie. Aber irgendetwas ließ sie tolerant mir gegenüber sein. Auch wenn ich ihnen eine Menge Aufmerksamkeit und Energie abverlangte.
Die ersten Monate lernte ich erst einmal die Eindrücke meiner Umwelt zu sortieren und zu erkennen, dass die farbigen Flecke und Formen meine Umgebung optisch widerspiegelten. Dass die tapsenden Geräusche Schritte waren. Dass manche Laute aus dem Wohnblock von Haustieren anderer Leute stammten. Hunde, oder ‚Wauwaus‘ wie meine Eltern diese mir gegenüber bezeichneten. Ich fand es lustig, wenn sie so sprachen. Sie wussten doch, wie die Tiere hießen, warum nannten sie sie mir gegenüber so komisch? Ich kannte doch jede Bezeichnung, die sie ihnen gaben...
Meist waren es allgemein Hunde. Mir oder anderen Kindern in meinem Alter gegenüber nannte man sie eben ‚Wauwaus‘ – eine unzutreffende Bezeichnung, wie sie selber zugaben. Oft nannten sie die Tiere aber auch ‚Kläffer‘, ‚Töle‘ oder eben ‚Köter‘. Vor allem, wenn sie dachten, ich höre sie nicht. Konnten die sich nicht einfach für einen Begriff entscheiden?
Die Worte zu verstehen war leicht. Ich hatte relativ schnell einen Bezug vom Wort zum gemeinten Gegenstand oder der entsprechenden Tätigkeit. Aber sie wiederzugeben, fiel schwer.
Meine Gedanken – sofern ich sie so nennen konnte – waren aber alles andere als wortbezogen und eigneten sich kaum dazu, diese in gesprochenen Worten auszudrücken.
Ich war deswegen gerade in den ersten Jahren frustriert und verstand nicht, was ich machen konnte, um das zu verbessern.
Meine Eltern unternahmen alles Mögliche, um mich zu fördern. Das, was jeder in der Situation machte: Mich mit anderen Kindern zusammensetzen, welche in einem ähnlichen Alter wie ich waren.
Anfangs fiel ich kaum auf, weil alle bis zu zwei Jahren eher nebeneinander her spielten als miteinander. Das einzige, was allen Erwachsenen seltsam vorkam, war, dass ich stundenlang entweder meine eigenen Hände anstarrte oder irgendeinen Gegenstand. Entweder den bunten, schlierigen Ball, bestimmte Muster, die Raufasertapete an der Decke, ein spiraliges Schneckenhaus, ein schwarz schillernder Käfer, einen besonderen Stein...
Manchmal faszinierten mich auch die roten Haare meiner Mutter oder meiner Schwester, deren Sommersprossen oder die Beschaffenheit der Iris irgendeines Menschen.
Vor allem Regenbögen mit ihren vielen Farben taten es mir an.
Was zum Beispiel den Erzieherinnen in der Kinderkrippe auch auffiel: Ich verzog selten eine Miene, aber hielt mir krampfhaft beim kleinsten Schallereignis die Ohren zu oder wenn sich viele Geräusche an einem Ort zu einem verworrenen Brei vermengten.
Vor allem schrie ich. Ich schrie, um dem Krach entgegenzuwirken, ich schrie aus Verzweiflung und aus Überforderung und ich schrie auch, wenn mir irgend etwas nicht passte. Wenn etwas nicht nach meinen Vorstellungen geschah.
Das war zwar bei jedem Kind so, aber bei mir besonders. Die Welt war und ist nicht, wie ich sie erwartet hatte und ich bemühte mich, sie mir an den Stellen anzugleichen, wo ich sie nicht verstand.
Sei es, dass ich nicht den roten, sondern den blauen Trinkbecher bekam oder nicht das Besteck mit dem Wellenmuster. Oder wenn es etwas zu essen gab, was ich nicht ausstehen konnte und wovon mir beim Geruch schon übel wurde...
Am schlimmsten war es, wenn mich jemand berührte, mich gar küsste oder man mir eine Backpfeife gab. Dieses Gefühl war... ungeheuerlich! Das löste eine Kettenreaktion aus, mit der nicht nur ich fertig werden musste, sondern auch alle anderen...
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
… in solchen Momenten wundere ich mich. Die Welt um mich herum wirkt verzerrt, bizarr, wenn nicht vollkommen grotesk.
Die Bewohner scheinen sich stets zu verändern. Stetig und je nach Stimmung. Waren sie vor einem Moment noch eher weich und mit Haaren bedeckt, ähnelt ihre Haut im nächsten Augenblick einer Schuppenstruktur.
Ich kann förmlich riechen, wenn sich die Stimmung verschlechtert. Ich spüre, wie das Stammhirn meines Gegenübers sein Bewusstsein übernimmt. Das äußert sich, indem sich auf einmal in meinem inneren Auge das Gesicht, welches vorher ausdrucksstark und flexibel war, sich scheinbar in das starre Antlitz einer völlig anderen Kreatur verwandelt.
Momentan fehlen mir auch die Worte, dies zu beschreiben. Ich weiß zwar, dass ich über eine andere Wahrnehmung und andere Denkmuster verfüge als die Wesen um mich herum, aber wenn so etwas passiert, übersteigt dies mein Fassungsvermögen.
Fremdartige Worte kommen mir unkontrolliert in meinem Unterbewusstsein in den Sinn, die mir irgendwie helfen, das Ges(ch)ehene zu verarbeiten und einzuordnen: Baragoi nenne ich diejenigen, unter deren Mitte ich gelandet war.
Noch weiß ich zu wenig über diese Welt...
Das Wesentliche ist mir klar. Und auch die Grundbedürfnisse hier unterscheiden sich nicht von anderen Lebensformen: Nahrung, Flüssigkeit, Atmung, Schlaf... Mehr bin ich momentan nicht imstande zu begreifen...
▀▐▄▌▀█▀ ▄ █▀
3
Sobald ich mich in so einer Situation wieder beruhigt hatte – was lange dauern konnte und man mich zur eigenen Sicherheit und der der anderen in ein Laufgitter stellen musste – und wieder zurechnungsfähig war, gesellte man mich wieder zu der Gruppe, machte einen Vermerk über meine Betragen und das wars dann.
Meine Familie – bestehend aus meinen Eltern und meiner großen Schwester – holten mich jeden Tag aus der Kindergrippe ab.
Sie verstanden nicht, was mir die Interaktion mit der Umwelt schwer machte: Dass mein Körper mir nicht so gehorchte, wie anderen Kindern, dass meine Gedanken sich überschlugen und keine Form annehmen konnten, dass ich kaum imstande war, irgendwelche Ereignisse – gerade im Zwischenmenschlichen – richtig zuzuordnen.
Ich verstand es selber nicht. Und wenn sie mir irgendetwas versuchten zu erklären – in sehr einfachen Worten – ergab das irgendwie kaum einen Sinn für mich...
Das aufrechte Laufen bekam ich ohne ständig hinzufallen erst nach fast zwei Lebensjahren richtig hin. Trotzdem stieß ich mich ständig oder riss den Arm irgendwo hin, wo ich ihn eigentlich nicht hin haben wollte.
Im Vergleich zu anderen brauchte ich zu allem länger, um alleine das Grobmotorische zu lernen als meine Altersgenossen. Vor allem auch Worte, beziehungsweise Sätze zu artikulieren, gelang anfangs nicht. Es fehlte eine Brücke zu mir und meiner Familie, geschweige denn zu den anderen Menschen...
Mit unserem Kater verstand ich mich prima. Er war eindeutiger zu verstehen, weil ich mich nicht parallel auf Worte und auf den Körper konzentrieren musste, sondern nur auf sein Verhalten achten musste. Er teilte auch mein Bedürfnis nach mehr Ruhe. Bei meiner Familie hingegen lief stattdessen zu viel parallel ab.
Im Gegensatz zu meiner Schwester verzieh mir Moritz auch, wenn ich ihm doch mal grob ins rot getigerte Fell grapschte oder wenn ich ihm mit meinen unbeholfenen Schritten doch einmal auf den Schwanz trat. Das mochte an meinem Alter gelegen haben oder an der Tatsache, dass sie ihn als eine Art Spielzeug betrachtete, welches ständig zu ihrer Verfügung zu stehen hatte. Was ihm nicht sonderlich gefiel.
Aber wem gefiel es schon, wenn man eben noch schön gemütlich auf einem weichen Sofakissen schlief und von einem Augenblick zum nächsten aus dem Schlummer gerissen wurde und gegriffen wurde.
„Moooritz! Komm mihiit!“, schrie sie. Sowohl ich als auch der Kater zuckten beim Klang ihrer schrillen Stimme zusammen.
Ich sah dem Ganzen von meinem Laufställchen aus zu, welches sich in der Nähe befand und konnte dem Kater nicht helfen. Aber er brauchte mich dazu auch nicht wirklich. Er fauchte kurz, sodass sich Nadine erschrak, entwand sich ihrem Griff, sprang direkt zu mir und setzte sein unterbrochenes Nickerchen direkt fort.
Es passte ihr gar nicht, dass das Tier sich ihrem Zugriff entzogen hatte und sie fing an zu weinen und zu plärren: „Maaamaaa! Die Katze ist mir weggelaufen!“
Mama trug noch ihre violette Kittelschürze über ihrer Bluse und der blauen Jeanshose als sie aus der Küche gelaufen kam und versuchte ihrerseits, das Geschehen zu erfassen. Ihr rotes Haar war unter einem Tuch versteckt, damit es ihr nicht über die Augen fiel.
Sie bemerkte die eingedrückte Stelle, wo sich das Tier üblicherweise hinlegte, sie sah, wo es nun lag, sie kannte ja ihre Tochter und wusste, dass sie vernarrt war in das lebendige Schmusetier. Sie verstand auch die Intention desselben...
„Nadine! Du weißt ganz genau, dass Moritz keins von deinen Kuscheltieren ist, sondern ein Lebewesen und dass du ihn schlafen lassen sollst! Der kommt schon von selbst, wenn er schmusen möchte! Lass ihn bitte in Ruhe!“, schimpfte Mutter mit meiner Schwester und berechnete damit nicht ein, dass ihre schrille Stimme mich ebenfalls beeinträchtigte.
Nadine stampfte auf, blies ihre Wangen auf, warf einen komischen Blick in Richtung von Moritz und ging in ihr Zimmer.
Ich fing inzwischen wieder an zu schreien, weil mir die Ohren weh taten. Meine Mutter sah das und hob mich aus dem Laufstall...
Das war aber das Letzte, was ich wollte. Nein! Nein! Nein! NEIN!, schrie es in meinem Inneren. Lass mich runter!, würde ich am liebsten sagen, konnte es aber nicht. Also schrie ich und versuchte, mich wie vorhin Moritz zu entwinden.
Der blinzelte nur mit einem Auge schläfrig, um die jetzige Situation zu erfassen und schlief weiter. Solange niemand auf die Idee kam, ihn zu stören, war ihm alles gleichgültig...
Meine Mutter erdrückte mich in ihrer Fürsorge, und verstand nicht, dass ich mich einfach nur abschotten wollte. Sie tat das Falsche: Sie hielt mich an sich gedrückt, streichelte meinen Kopf, küsste mich ab und veränderte ihre Stimme zu einem summenden Ton.
Die Stimme, die an das Schnurren von Moritz erinnerte, war noch das Angenehmste an der Situation. Mir bereitete aber die Änderung ihres Verhaltens Probleme. Erst schrill, dann wieder sanft. Wie schnell konnte sich die Stimmung eines Mitgliedes meiner Familie, beziehungsweise auch anderer Menschen ändern und mich vollkommen unvorbereitet treffen... Von den Berührungen ganz zu schweigen... Und das Küssen... Wah!
Sie sah ein, dass sie mich nicht beruhigen konnte, setzte mich wieder zurück in den Laufstall, wo sie wusste, dass ich dort keinen großen Schaden anrichten konnte, wenn ich meinen Koller bekam und wandte sich entnervt ihrer eigentlichen Beschäftigung in der Küche zu – dem Abwasch.
Ich hörte das Klirren des Geschirrs, wenn sie es abtrocknete oder in die Schränke stellte, das Klappern des Bestecks, wenn es wieder in der Schublade verschwand.
Irgendwann verstummte es und sie ging nun wesentlich langsameren Schrittes in das Zimmer von Nadine, um noch einmal über das Vorgefallene zu reden.
Die Stimmen drangen durch die Wände. Die eindringlichen Ermahnungen meiner Mutter, das Gequengel meiner Schwester...
Alleine die Tatsache, dass ich nun nur ein unbeteiligter Beobachter war, beruhigte mein Gemüt. Auch die Anwesenheit des Katers, der zu schnurren begann und zu dem ich mich legte, nur um die Vibrationen unter seinem weichen Fell zu spüren, trug zu meiner Besänftigung bei und ich schlief neben ihm ein...
Schritte im Treppenhaus, ein klappernder Schlüssel, welcher in unserer Wohnungstür gedreht wurde, die sich kurz darauf öffnete, weckte mich wieder auf. Mein Vater kam nach Hause.
Er seufzte, hing seine Jacke und seine Mütze an die Garderobe und rief: „Bin wieder da und hab was zum Vesper mitgebracht!“
Dann ging er in die Küche und legte die Tüte, die nach Quarkbällchen roch, dort ab und suchte den Rest der Familie.Im Wohnzimmer fand er nur mich, der sich langsam wieder beruhigt hatte. Er tat aber etwas, was mir lieber war: Er zog nur Fratzen, um mich zu begrüßen, beziehungsweise zu bespaßen.
Was der alles mit seinem Gesicht anstellen konnte, reizte mich immer wieder zum Lachen, vor allem, wenn er dabei dem Kater ähnelte... Auch der zog Grimassen, welche lustig aussahen, aber eigentlich nicht so gemeint waren.
Die anderen kamen aus dem Kinderzimmer meiner Schwester und gesellten sich zu uns. Nun wurde es wieder schwierig für mich, wenn statt zwei verschiedener Stimmen sich derer drei beim Erzählen überschlugen.
Um damit umzugehen tat ich es wie Moritz und verhielt mich still. Ich beobachtete nur...
Sie deckten den Esstisch des Wohnzimmers, stellten Teller hin und Tassen. Die Eltern kochten sich Kaffee und für uns Kinder warmen Kakao.
„Was ist mit Tino? Soll der im Laufstall bleiben?“, wollte Papa etwas irritiert wissen, kratzte sich kurz über seinem hellbraunen Haar und machte bereits Anstalten, mich aus meinem momentanen Aufenthaltsort zu holen.
„Der hat sich gerade erst beruhigt. Vorhin gab es etwas Trubel wegen der Katze und Nadine und das gefiel unserem Sohnemann gar nicht... Lass ihn erstmal bloß drin“, erwiderte meine Mutter.
„Dann will er wohl keine Quarkbällchen?“, und wies demonstrativ auf sein Mitbringsel und steckte sich selber eines in den Mund.
Mit großen Augen verfolgte ich das Geschehen. Ich hatte bereits verstanden, wie ich denen klar machen sollte, dass ich auch etwas abhaben wollte.
Ich richtete mich an den Stangen des Gitterställchens auf und hielt meine Arme nach oben. Eher in Richtung der Quarkbällchen und meines Trinkbehälters.
Meine Mutter kam zu mir hin, mit dem Becher und einem Quarkbällchen in der Hand und hockte sich vor mich hin. Sie kam recht nahe heran...
Nahe genug, dass ich blitzschnell in ihr Gesicht greifen konnte und vor allem ihre sommersprossige Nasenspitze wie eine Hupe betätigte. Sie machte ebenfalls ein lustiges Gesicht – ähnlich wie mein Vater zuvor. Ich quietschte vor Lachen und versuchte das Gesehene nachzuahmen. Es gelang mir nicht gut, hatte aber den Erfolg, dass meine Familie ebenfalls kicherte.
Ich glaubte in dem Moment, dass ich eine Brücke zu ihnen gefunden hatte... Eine komische Fratze ziehen. Dann gab mir meine Mutter das Gebäck. Ich ergriff es und zog mich in eine Ecke zurück, um es zu essen. Die Hälfte verschwand in meinem Mund, wo ich die Süße des Teigs, der Zuckerstreusel und den Geschmack von etwas Milchigem genießen und die fluffige Konsistenz wahrnehmen konnte, ehe der Brocken zu einem Matsch wurde, den ich hinunterschluckte.
Sie zeigte auf den Becher: „Will Tino auch Kakao? Dann muss Tino zu Mama kommen...“
Natürlich wollte ich Kakao! Ich tippelte zu ihr und griff nach der Tasse. Sie entzog sie mir, weil sie dachte, ich könnte das noch nicht alleine und versuchte, nachzuhelfen.
Das gefiel mir nicht. Ich wusste inzwischen, wie weit ich das Gefäß abkippen konnte und wollte das alleine machen, ihr zeigen, dass ich das auch selber konnte... Ich entwand mich und verzog mich.
„Ich dachte du magst Kakao“, wunderte sie sich. „Möchtest du lieber Tee?“, fragte sie eher sich als mich.
Es lag nicht am Getränk sondern daran, dass ich alleine trinken wollte...
Ich wunderte mich nur, dass Mama vorhin den Kater und seine Bedürfnisse besser verstanden hatte als mich jetzt...
Papa dämmerte etwas: „Gib ihm einfach den Becher und lass ihn mal machen!“
Sie zögerte, aber folgte seinem Hinweis.
Ich nahm das Trinkbehältnis und setzte an. Der Großteil landete tatsächlich dort, wo er hin sollte – in meinem Bauch, der Rest eben... nicht. Mein Pulli hatte nun stetig wachsende Kakaoflecken und ein Teil davon rann die Strumpfhose hinunter.
Mama meinte gereizt zu Papa: „Ich hab doch gleich gesagt, dass er es noch nicht alleine kann!“
Der zog ein seltsames Gesicht, indem er die Augen verdrehte, als er sagte: „Was ist denn los mit dir? Als Nadine in dem Alter war, hast du dich nicht so angestellt, wenn ihr etwas daneben ging... Wie soll Tino das denn lernen, wenn du ihn nichts selbst machen lässt?“
„Du weißt doch, dass ihm das schwerer fällt, also wollte ich ihm nur helfen. Nu bin ich wieder die Dumme oder was?“
Die Stimmung des Nachmittags war nun im Eimer. Ich fragte mich was ich falsch gemacht hatte, rollte mich zusammen und fing an zu schaukeln. So lange, bis man mich doch aus dem Laufstall zog, weil man mich meiner fleckigen Kleidung entledigen und waschen musste.
Einer unangenehmen Prozedur – vor allem, wenn sie so plötzlich vorgenommen wurde. Die Windel hatte ich mir auch vollgemacht und ich wurde gleich trotz heftiger Gegenwehr einer Grundreinigung unterzogen.
Nadine fand das Schauspiel saukomisch und kringelte sich ebenfalls zusammen – vor Lachen! Bald aber nicht mehr, denn unsere Eltern stritten sich noch einige Zeit über Fragen der Kindererziehung.
Die Laune beim Abendbrot war etwas frostig und keiner sagte auch nur noch einen Piep. Danach wurde der Fernseher eingeschalten – der Sandmann kam für uns. Das sichere Zeichen, dass wir danach ins Bett mussten. Beziehungsweise ich war derjenige, der zuerst schlafen gelegt wurde, während Nadine noch den Trickfilm für größere Kinder sehen durfte.
Ich war sowieso zu müde. Die mehrfache Überreizung schaffte mich und ich glitt in einen Traum hinüber...
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
Die Baragoi tun wieder das, was sie sonst taten: sich je nach Laune zu verwandeln. Erst tun es nur ihre Gesichtszüge, die sich in meiner Vorstellung wie Teig zusammenziehen oder entfalten. Bald ist auch die Kopfform und die Körperhaltung anders, so wie die Kommunikation...
Einfachere Lebewesen taten das seltsamerweise nie... Deswegen waren sie auch wesentlich leichter zu verstehen...
Meine sechs Hände wehren ihre immerwährenden Versuche, mich zu ergreifen ab und meine sechs Beine versuchen ihnen stets zu entkommen.
Sinnlos. Man erwischte mich oft meist am Schwanz. Aber ebenso oft kann ich ihnen entgleiten und verschwinde in einer Ritze...
▀▐▄▌▀█▀ ▄ █▀
5
Ein entscheidender Moment in meinem Leben war in der Zeit als ich im fünften Lebensjahr war. Bisher wunderten sich alle, dass ich immer noch nicht sprach. Aber bald verblüffte ich meine Familie damit, DASS ich doch dazu in der Lage war.
Meine Babylaute, wenn ich überhaupt welche von mir gab, erschienen ihnen seltsam genug. Sie entsprachen nicht dem, was Babys normalerweise von sich gaben, wenn ich nicht gerade schrie...
Schreie verstanden sie, aber das Gegurgel, Geschnarre und Geschnalze nicht. Man hätte meinen können, ich wäre taub. Aber keineswegs.
Der Anlass meines ersten Wortes, beziehungsweise meines ersten Satzes war Papa. Wir waren zu Besuch bei Onkel Rolf und Tante Nina und ihren beiden Jungs. Es war ein schöner Frühlingstag im Garten, wo ich jede Gelegenheit nutzte, mich davonzustehlen und den Teich zu bewundern, in dem es vor Molchen nur so wimmelte. Die Tiere übten eine Anziehung auf mich aus. Sie wirkten mir vertrauter als meine Familie, wie sie unter Wasser schwammen oder an Steinen entlang krochen.
Niemand kümmerte sich um mich. Nadine spielte mit den beiden Jungs, während ich in den Teich starrte und das Treiben beobachtete...
Zumindest so lange, bis es später Nachmittag war und man mich suchte. Es gab im Grunde nur zwei Orte, an denen ich mich aufhielt: Man fand mich entweder am Teich, oder hinten im Garten, wo der Schutthaufen lag, in dem sich vor allem im Sommer die Eidechsen tummelten.
Ich war gezwungen, mich von dem Anblick der vertrauten Wasserwesen oder von dem der Reptilien loszureißen und musste mich ins Auto setzen.
Natürlich winkte ich allen zum Abschied. Das war sozusagen ein Kompromiss. Ich winkte allen, dafür hoben sie mich nicht gleich hoch und schmatzten mich ab. Manchmal hupte ich die Nasen der anderen Menschen. Vor allem am liebsten die von Onkel Rolf, weil die so dick und porig war...
Wir fuhren durch die ganze Stadt und kamen im Licht des Abendrots zu Hause an. Papa parkte das Auto und kam uns kurz darauf hinterher, als wir in Richtung der Haustür strebten.
Er überraschte mich, indem er mich direkt anstarrte, was mir unangenehm war. Das legte sich schnell, als er wieder dieses Gesicht zog, das ich so lustig fand. Das Faltige.
Wie das aussah! Ich hatte kaum eine Gelegenheit, das mal anzufassen, wie ich es gerne tat, so schnell machte er es wieder weg...
Ich rief zu aller Überraschung auf einmal für sie klar verständlich aus: „Mach das nochmal mit deiner Nase!“
Er stutzte und wiederholte die Fratze.
Ich lachte, hielt meinen Finger daran und fühlte die Veränderung auf seiner Haut. Dann wandte ich mich Mama zu und sagte zu ihr: „Jetzt du!“ Auch sie realisierte noch nicht richtig, dass ich eben gesprochen hatte und reagierte eher unbewusst, indem sie sich auch zu mir beugte und ebenfalls die Nase verzog. Ich stellte nun bewusster fest, dass sich ihre Mimik im Muster von Papas unterschied. Ich ertastete den Verlauf der Linien und der Erhebungen und fand das ungefähr genau so lustig.
Nun setzte ich einen obendrauf und zog meine Schwester am Arm und sagte zu ihr: „Jetzt du!“
Sie machte es auch und ich prägte mir ihren Gesichtsausdruck genau ein, wie ich es bei den Eltern tat. Ihr fiel es schwerer, die Berührung durch meinen Finger zu dulden, aber ich schaffte es dennoch, mir einen Eindruck davon zu verschaffen.
Aufgedreht, wie ich aufgrund dessen war, rief ich: „Wer zuerst oben ist!“ und flitzte ins Treppenhaus, wobei ich die Stufen bis zur unserer Wohnung im dritten Stock wie eine Eidechse oder wie unsere Katze auf allen Vieren nahm.
Ich hockte mich auf unseren Fußabtreter und zog mir die Schuhe aus, stellte sie säuberlich in die Ecke, während ich auf die anderen wartete. Nadine hatte meinen Ausruf nicht einmal richtig wahrgenommen, sodass sie erst mit Verzögerung reagierte und kurz nach mir vor unserer Wohnungstür ankam.
Auch sie zog sich die Schuhe aus und wartete.
Unsere Eltern kamen endlich und schlossen die Tür auf, sodass wir endlich die Jacken ausziehen konnten. Ich legte meine Jacke auf den Hocker neben dem Telefon, wie ich es immer tat und verschwand in meinem Zimmer um ein wenig zu malen.
Nadine zog sich ebenfalls zurück. Sie hatte Hausaufgaben. Sie ging ja schon zur Schule und musste noch etwas tun. Das wusste sie auch und tat dies ohne Aufforderung.
Man rief uns einige Zeit später zum Tischdecken fürs Abendbrot. Es gab Tomaten und Leberwurstsemmeln und Tee. Wir setzten uns an den Tisch und aßen. Bis ich feststellte, dass mich alle anderen seltsam ansahen. Ich blickte mich um und verstand nicht, was passiert sein konnte. Ich aß einfach nur genüsslich und ließ mir den Geschmack der Leberwurst auf der Zunge und dem Gaumen zergehen.
Noch verstand ich nicht, was ich durch meine Worte ausgelöst hatte. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht einmal bewusst, dass ich überhaupt einen Satz von mir gegeben hatte.
Ich ließ mich nicht weiter stören und nahm mir ein weiteres Brötchen und aß es auf. Danach griff ich eine Tomate und biss herzhaft hinein und mochte den leicht metallischen Geschmack. Nur den Stängel und die grüne Stelle, wo der sich zuvor befunden hatte, ließ ich übrig. Ich ergriff meinen lila Becher mit den weißen Punkten mit dem Pfefferminztee und trank ihn mit einem Zug aus. Danach hielt ich ihn meiner Mutter hin und sagte nur: „Ich möchte mehr Tee!“
Nun erst realisierten sie das Geschehene. Das was sie bisher für unmöglich hielten: Ich hatte gesprochen. Und das in ganzen Sätzen!
Kein Geschrei oder meine Klick-, Schnarr-, Schnalz- und Gurgellaute, ich überging nämlich das babytypische Gaga-gugu, die Ein-, Zwei- und Dreiwortsätze, sondern ich gebrauchte sofort dem Alter entsprechende Sätze. Und das das relativ flüssig und klar verständlich. Auch wenn meine Stimme für sie eher monoton und leise wirkte und ich nach jedem Wort eine kleine Pause einlegte.
Sie goss mir etwas ein. Aber diesmal trank ich langsamer und schmeckte den kleinen Löffel Honig heraus, den sie oft mit unterrührte.
Dann stand ich auf und ging ins Bad, wobei ich den Rest der Familie etwas fassungslos zurückließ. Erstens arbeitete der Tee und zweitens wollte ich mich waschen und schon umziehen, ehe der Sandmann begann, damit ich danach pünktlich meiner Gewohnheit entsprechend schlafen gehen konnte.
Während ich weg war, unterhielten sie sich über das Ereignis, wobei ich sie genau hören konnte.
„Hat Tino eben wirklich gesprochen?“, wollte meine Schwester wissen.
„Du hast es doch mit eigenen Ohren gehört. Ja, hat er“, antwortete Papa.
„Wieso jetzt auf einmal?“, fragte sie weiter.
„Das weiß ich selber nicht so genau. Wenn es überhaupt jemand weiß, dann er.“
„Mein Junge spricht!“, rief Mama bewegt aus. Sie traute mir ohnehin nur wenig zu, wenn es nicht gerade in meine eigene kleine Gedankenwelt hineinpasste.
Alle drei wussten nicht so recht, was sie mit der veränderten Situation anfangen sollten. Willkommen in meiner Welt!
Ich kehrte in Schlafanzug, Socken und Schlappen zurück und sah zur Uhr. Ich konnte sie zwar noch nicht richtig lesen, aber ich wusste genau, wie die Zeiger aussahen, wenn der Sandmann lief.
Ich ging zum Fernsehgerät und schaltete es an. Dann suchte ich so lange, bis ich den richtigen Sender fand – das Symbol kannte ich genau und setzte mich hin.
Alle anderen schauten mir fassungslos zu. Ich starrte in ihre Richtung, sah wie sie mich anstarrten und dachte nur: Was ist?
Die Sendung ging los. Da Sonntag war, lief Herr Fuchs und Frau Elster. Die mochte ich, genau wie Pittiplatsch oder den Plumps, eh lieber. Was ich nicht mochte – Nadine jedoch schon, als sie noch mitgeschaut hatte – waren Freitags die Kinder, die sangen. Ich verstand das Ganze mit dem Singen nicht. Ich konnte es selber nicht, hatte auch keinen Spaß dran, wenn im Kindergarten gesungen wurde.
Ich hörte zwar die Töne und versuchte das System der Melodie zu erfassen. Rhythmus und Takt, die Betonung, die Geschwindigkeit oder die Höhe. Jedes für sich betrachtet, ging. Aber alles zusammen brachte mich durcheinander. Vor allem wenn man mich zum Singen aufforderte. Ich hatte ohnehin bisher nie gesprochen und dementsprechend auch das Singen erfolgreich verweigert. Selbst viele Jahre später klang mein Gesang – oder vielmehr der klägliche Versuch davon – abgehackt und monoton. Das Beste, was ich so zustande brachte, war eher ein Sprechgesang.
Abgesehen davon löste das Ganze bei mir nichts aus. Ich sah zwar, wie die Lieder oder Melodien die Stimmung anderer veränderten, konnte diese Regungen bei mir jedoch nicht feststellen. Ich fühlte mich dadurch zunehmend isoliert. Mehr als ohnehin schon. Wenn wir im Kindergarten mit Instrumenten herumprobierten, nahm ich meist das Becken, den Tambourin oder die Triangel. Nichts Kompliziertes. Trotzdem brachte ich oft den einfachsten Takt durcheinander...
Die Geschichte vom Sandmann war zu Ende und ich wandte mich wie immer ab, wenn er seinen Sandbeutel auskippte. Ich wollte keinen Sand in den Augen haben. Schon gar nicht, nachdem man mich neulich im Kindergarten in die Sandkiste gestoßen hatte und damit beworfen hatte, als die Erzieherinnen nicht hingeschaut hatten.
Danach kam noch ein kurzer Trickfilm – ich gehörte ja nun zu den großen Kindern. Diesmal handelte es von einem Ritter und einem Drachen. Ein Höhepunkt. Ich mochte Drachen lange Zeit sehr gern und merkte mir genau, wie dieser aussah, weil ich ihn dann morgen einfach abzeichnen würde. Schade, dass der Ritter das Geschöpf tötete, nur um eine Prinzessin zu retten.
Als das Märchen vorbei war, löste ich mich vom Gerät und ging in mein Zimmer. Dort überlegte ich es mir anders und brachte den Drachen am besten gleich zu Papier. Zumindest mit meinen bescheidenen Fähigkeiten.
Nachdem ich meine Zeichnung beendet hatte rief ich nach Papa, der mir noch etwas vorlesen sollte. Was er auch tat. Er zeigte mir das Buch mit den Tieren und erklärte mir jeden Tag etwas daraus. Danach wollte ich wieder, dass er das lustige Gesicht machte. Was er dann auch tat – sehr zu meinem Vergnügen. Ich machte dasselbe, wie am Nachmittag: Die Grimasse anzuschauen und mit dem Finger komplett abzutasten.
Ich machte selber die Grimasse, woraufhin er mal kurz meine Nase stupste. Als ob er verstand, dass das für mich ein Begrüßungs- und Abschiedsritual war. Abgesehen davon sah es bei ihm einfach zu komisch aus... Die lange, breite und etwas schiefe Nase und dann das bisschen an Fältchen oben drauf.
Er verließ das Zimmer, machte das Licht aus und schloss die Tür. Ich hingegen schlief bald ein und verarbeitete den Tag.
▀▄█ ▄▌▀▐▄▀█ ▄
Die Baragoi brabbeln etwas und verrichten ihr Tagwerk. Ich mache ihnen alles nach, wozu ich anatomisch und kognitiv imstande bin. Dann bringe ich ihnen bei, wie man sich bei mir zu Hause begrüßt: Indem man sich gegenseitig berührte und abtastete.
Sie fühlen sich seltsam an. Vor allem dann, wenn sie während des Abtastens wieder ihre andere Gestalt annehmen. Eine Gestalt, die der meinen durchaus ähnelt. Aber dadurch für mich eher fremdartigere und unangenehmere Verhaltenszüge aufzeigen. So aggressiv und teilweise brutal...
Einer von ihnen verwandelt sich in ein schuppiges Ungeheuer, welches einen langen Zackenkamm auf dem Rücken und Flügel bekommt, die aus langen Streben bestehen und mit einer dünnen Membran bespannt sind.
Ich bin von dem Wesen fasziniert, aber fühle mich wegen seines intensiven Blickes aus leuchtenden, irisierenden Augen verängstigt. Ich wende mich ab und tauche in eine Art dunkles Gewässer. Dabei stelle ich auch eine Veränderung fest: Meine sechs Laufbeine haben sich in Flossen verwandelt und schieben mich mit Unterstützung meines umsäumten Schwanzes von den Geschöpfen weg.
Seltsamerweise fühlt sich das Medium um mich herum nicht im Geringsten wie Wasser an, sondern eher wie Leere. Überall um mich herum leuchten kleine Lichtpunkte – Sterne – in denen ich mich verliere...
▀▐▄▌▀█▀ ▄ █▀
7
Seit ich anfing zu sprechen nahm ich alles um mich herum anders auf. Nun konnte ich mich besser verständigen. Aber zwei Sachen waren anders: Meine Denkweise, die oft windschief zu den Möglichkeiten war, die mir die Wörter boten. Und der Entwicklungsrückschritt, den ich hatte, weil ich die sozialen Fähigkeiten meiner Umgebung kaum begriff. Am meisten war das für mich wahrnehmbar, wenn meine Mutter das Schlimmste tat, was man einem Kind antun konnte: mich unmittelbar mit gleichaltrigen Kindern zu vergleichen, die so viel weiter als ich in ihrer Entwicklung waren, nur, damit ich mir an denen ein Beispiel nehmen sollte.
Meine Familie kannte mich und wusste inzwischen, wie sie mich zu nehmen hatte. Bei unseren Verwandten und Bekannten war es ebenso. Bei Fremden war es schwieriger. Sie kannten mich nicht, ich sie auch nicht. Und einige Menschen konnte ich einfach nicht ab.
Vor allem manche der Kinder im Kindergarten. Ich verstand manche ihrer Spiele nicht richtig. Ich war ohnehin nicht schnell genug. Außerdem war ich ungeschickt, sodass sie mich entweder gar nicht erst mitmachen ließen oder sich über mich lustig machten. Meistens wollte ich auch nicht mitmachen, sondern für mich sein.
Ich mochte auch die eine Erzieherin nicht, Frau Müller, die bei sportlichen Übungen die Langsamen und Ungeschickteren vom Rest der Gruppe umringen ließ und mit einem Spottlied bedachte.
Das dauerte eine Weile bei mir, ehe ich realisierte, was sie da tat. Und dass sie nicht wusste, was sie damit bei uns anrichtete. Sie erhob damit nämlich die einen über die anderen und sorgte für ein Ungleichgewicht der Kräfte. Was vor allem Michael gerne ausnutzte.
Der Spaßmacher, den ich mir oft wie einen Affen vorstellte, wie er so herum hampelte und damit alle zum Lachen brachte. Er hatte nur eine schlechte Angewohnheit: Er nahm anderen Kindern – vor allem kleineren – die Spielsachen weg, zertrat deren Sandburgen oder schubste sie.
Er war etwa so groß wie ich aber ein vollkommen anderer Charakter. Er hatte mich damals in den Sand gestoßen und die anderen dazu gebracht, mich mit Sand zu bewerfen.
Ich saß gerade in der Sandkiste und baute mit einem Eimer und einigen gesammelten Steinchen eine Burg. Es war mir zum ersten Mal gelungen, den Eimer ohne Schwierigkeiten umzustülpen und ohne, dass das Gebilde auseinanderfiel und es somit die Form des Kübels beibehielt.
Ich setzte gerade in die Mitte einen kleinen Tannenzweig und an den kreisrunden Rand der flachen Oberseite die Kiesel.
Dann kam er von mir unbemerkt hinzu, betrachtete kurz mein Werk und trat drauf.
Fassungslos versuchte ich das soeben Geschehene zu verarbeiten und sah zu ihm auf, wie er mich anschaute. Er wirkte mit seinen starren ausdruckslosen Augen wie ein Reptil und kurze Zeit sah er für mich auch aus wie eines.
Ich stand auf und schaute ihn wütend an. „Du hast mein Gebautes kaputtgemacht!“, rief ich verwundert und zornig aus.
„Du kannst ja sprechen“, wunderte er sich.
„Du doch auch. Lass mich in Ruhe!“, forderte ich.
„Und wenn nicht?“, versetzte er und kam einen Schritt auf mich zu.
Ich tat das, was er vor einigen Wochen bei mir tat: Ich schubste ihn zu Boden. Mit der Heftigkeit hatte er nicht gerechnet und er fiel über den Rand des Sandkastens.
In diesem Moment erblickte uns Frau Müller. Sie stürmte auf uns zu, und erfasste die Situation. Zumindest glaubte sie das. Anstatt erst einmal zu fragen, was passiert war, hielt sie Michael für den Angegriffenen und mich für den Angreifer. Sie half ihm auf und untersuchte, ob er sich etwas getan hatte, dann ergriff sie mein Handgelenk und zerrte mich ins Innere, wo sie mich richtig ausschimpfte.
Ich wollte ihr ja erklären, was passiert war, sie ließ mich aber nicht zu Wort kommen. Für sie war der Fall ja klar und abgehakt. Sie wusste ja noch nicht, dass ich sprechen konnte. Und so, wie es aussah, würde sie mir ohnehin nicht glauben. Diese blöde Kuh!
Sie sperrte mich in eine Kammer ein, wo man die Unartigen hin verfrachtete.
Bald ließ sie mich aber wieder raus. Jedoch nur, damit meine Mutter, die sie im Schlepptau hatte, mich abholen konnte.
Meine Mutter war rasend. In meiner Vorstellung sah auch sie wie ein wütendes Monster aus, so wie ihre Augen glühten. Sie schalt mich aufs Heftigste und ließ mich ebenfalls nicht einmal ausreden. Ihre genauen Worte waren: „Eigentlich wollten wir ja morgen in den Zoo gehen, aber mit dieser Chaotik kannst du das vergessen! Warte mal ab, was Papa dazu sagt!“
Das war ein harter Schlag, den sie mir damit verpasste. Ich hatte mich wochenlang auf diesen Ausflug gefreut und nun das? Und das nur, nachdem ich mich einmal gegen jemanden, der selber Schwächere angriff und ihnen zusetzte, zur Wehr gesetzt hatte? Dem sollten sie solche Verbote aussprechen!
Ich riss mich von ihr los, schrie ihr meinen Frust in schrillen Vokalfolgen entgegen – sprechen konnte ich nicht mehr – und rannte davon.
Sie lief mir hinterher, ergriff mich am Arm und verpasste mir eine Ohrfeige. Das war zu viel! Ich gebärdete mich wie wild. Ich bekam nicht mal mehr mit, dass sie mich nach Hause zerrte, mich in meinem Zimmer einsperrte, wo ich gegen den Schrank trat und mit meinem Kopf gegen die Wand hämmerte und dabei schrie.
Irgendwann weinte ich nur noch. Ich verstand die Welt nicht mehr – was ich ohnehin kaum tat. Aber jetzt zweifelte ich daran, ob alles mit rechten Dingen zuging...
Was ich an dem Abend jedenfalls nicht mehr tat, war sprechen. Hunger hatte ich auch nicht. Schon gar nicht wollte ich Zeit mit Leuten zubringen, die mir nicht glaubten und meiner Sicht weder Gehör schenkten oder sie überhaupt verstanden.
Das Wochenende verbrachte ich auf meinem Zimmer und schwieg mich aus. Ich zeichnete nur noch. Vor allem Monster. Die Monster, als die ich sowohl meine Familie als auch Frau Müller und Michael sah. Ich krakelte meine eigene Entsprechung einer Schrift auf die Rückseiten meiner Gemälde und schob die Bilder in meine Schreibtischschublade.
Wortlos nahm ich die Mahlzeiten mit meiner Familie ein, wusch ich mich, schaute den Sandmann, malte oder blätterte in einem meiner Bücher oder trottete lustlos neben meiner Familie her, als wir statt den ersehnten Zoobesuch nur einen Spaziergang durch die Siedlung unternahmen. Bis zum Park, wo sich der tolle Spielplatz aus Holz befand.
Meine Schwester war ebenfalls sauer, dass ihr die Tiere entgangen waren und machte mich dafür verantwortlich, dass sie nun einen anderen Tag verlebte als sie wollte. Dabei konnte sie sich doch denken, dass es mir genau so ging. Aber ich verstand mich inzwischen nicht sehr gut mit ihr. Sie war knapp drei Jahre älter und hielt sich für etwas besseres.
Das Klettergerüst lockte mich nicht. Ebenso wenig der Krach, welchen die anderen Kinder verursachten. Ich entzog mich meiner Mutter und setzte mich an einen Rand der Sandkiste, der so weit wie möglich von ihr entfernt lag.
Sobald ich aus ihrem Fokus verschwand, machte ich mich davon und ging auf eigene Faust in der Siedlung spazieren. Ich kannte den Weg von meiner Wohnung bis zum Kindergarten auswendig. Genau wie den Weg zur Oma und dem zum Park. Ich zog die Verbindung von einem der vier Orte zum anderen wie von selbst.
Ich legte den Weg wie ferngesteuert zurück und versank dabei in mir selbst...
Die quaderförmigen Wohnblöcke reihten sich überall aneinander und waren nur von den Grünflächen der Innenhöfe oder von Straßen, Parkplätzen, Fußwegen unterbrochen.
Fremde würden denken, dass jeder Wohnkomplex wie der andere aussah. Für mich jedoch nicht. Ich wusste genau, an welchem Haus ich wann abbiegen musste. Dass dort, wo die Achtgeschosser standen, es nicht mehr weit war bis zu Oma. An dem mit den roten Balkonen musste ich rechts in den Fußweg abbiegen, der Ladenstraße folgen und den Innenhof mit dem Denkmal links liegen lassen.
Das gelbliche Haus war das meiner Oma. Die Wohnung unten links. Ich wusste genau, wo ich klingeln musste. Schritte erklangen, Oma erschien, öffnete die Balkontür, erblickte mich, wunderte sich und fragte: „Tino? Wie kommst du denn hierher? Ist etwas passiert?“
Ich schaute ihr ins Gesicht. Ich wusste nicht, ob ich ihr trauen konnte. Erwachsene hielten ja doch immer zusammen...
Sie schlug sich gegen die Stirn: „Ich werd alt. Ich lass dich erst einmal rein, Junge...“ Sie verschwand und kam stattdessen an der Haustür zum Vorschein.
„Mein Junge! Dich scheint etwas zu bedrücken. Komm rein und sag deiner Oma, was los ist...“
Sie ließ mich ins Wohnzimmer, holte die bunte Keksbüchse aus dem Schrank in der Küche und gab mir einen davon. „Kriegst gleich noch einen. Ich mach uns einen Tee... Ich hab einen ganz Besonderen: Schwarztee mit Wildkirsche.“
Als der fertig war, kam sie ins Wohnzimmer zurück mit einem Tablett, auf dem sich die Teekanne, zwei Tassen und die Keksdose befanden.
Ich entspannte mich etwas. Bei Oma durfte ich ich selber sein. Sie ließ mich einfach gewähren, vor allem, wenn sie die Nase krauste und mich das Durcheinander an Falten einfach anfassen ließ. (Das sah so ganz anders aus als das symmetrische Muster, welches sich auf Mamas Nase bildete...) Sie wusste, dass mich das tröstete, dass ich das irgendwie brauchte. Dafür ließ ich zu, dass sie mir das Haar kraulte.
Ich sprach trotzdem kein Wort. Sie war einfach nur für mich da.
Plötzlich stand sie auf, holte einen Bogen Papier und ein paar Buntstifte, breitete all dies vor mir aus und ließ mich in Ruhe.
Ich legte los und zeichnete. Ich brachte Geschöpfe aufs Papier. Ganze Bildergeschichten. Wie ein Affe sich in eine grüne Echse verwandelte, eine seltsam wirkende rote Echse, welche eine Sandburg baute, schubste und das Bauwerk zertrat. Danach schubste die rote Echse zurück. Eine Schlange kam ausgerechnet in jenem Augenblick hinzu und wütete zur roten Echse, statt zur grünen, die sich wieder in einen Affen zurückverwandelt hatte und holte die Mutter der roten Echse.
Die Familie der roten Figur schimpfte mit ihr und ließ sie nicht zu Wort kommen. Mein Gekrakel, das die Worte darstellen sollte, war spitzeckig und wurde mit zunehmendem Frust zackiger und abgehackter und bald durchgestrichen.
Zwei Wege malte ich. Der eine endete im Zoo, dessen Wahrzeichen ich sehr genau zu Papier brachte. Den Torbogen mit dem Löwenkopf. Ich strich den Zoo ebenfalls durch. Der andere endete im Park, den ich mit Bäumen und dem Spielplatz darstellte.
Ich zog von der Baumgruppe aus eine weitere Linie und deutete am Ende mit einem gelben Viereck das Haus meiner Oma an.
Ich betrachtete mein Werk noch einmal und reichte es ihr wortlos.
Sie sah sich mein Kunstwerk genau an. Sie studierte jede Einzelheit. Aber sie verstand nicht alles. Sie bekam aber mit, wie ich reagierte, als ich selbst noch einmal über das Ganze nachdachte. Wie ich mich zusammenkauerte und schaukelte und dabei meine für sie seltsamen Laute von mir gab.
Sie dachte lange nach und kam zu einem Schluss: Irgend etwas ist dieser Tage schiefgegangen, soviel weiß ich.
Ich überraschte sie mit einer Frage: „Verstehst du mein Bild, Oma?“
Sie zuckte kurz und drehte sich zu mir um. „Ich glaub es kaum, als deine Mama das neulich erzählte: Du sprichst wirklich! Mein Junge! Mein Junge!“
Sie fiel mir um den Hals. Und ich ließ es zu, weil sie momentan der einzige Mensch war, den ich nicht total doof fand...
„Bist du wirklich alleine hierher gekommen?“, wollte sie wissen.
Ich bejahte.
„Und die wissen nicht, wo du bist?“
Ich schüttelte den Kopf. Und setzte nach: „Ich möchte da nicht mehr hin.“
„Meinst du nicht, die machen sich keine Sorgen, wenn du weg bist?“
Ich schüttelte erneut den Kopf. „Nein! Denn die haben mir nicht geglaubt oder mir zugehört! Aber ausmeckern können sie mich! Ich hab mich doch nur gewehrt!“