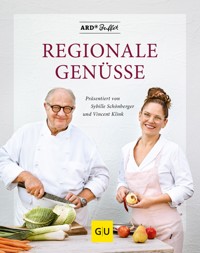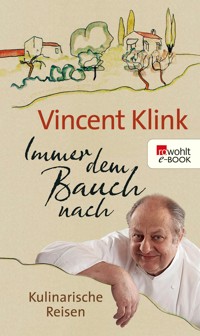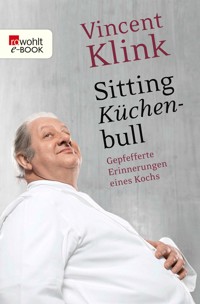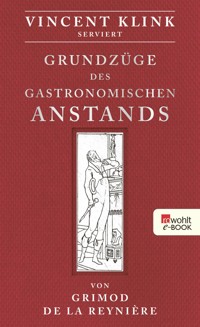14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit vierzig Jahren fährt Vincent Klink in jene Region Italiens, die einen geflügelten Löwen in ihrem Wappen trägt: Venetien. Die dortige Küche liebt er fern der Klischees von «Tomate-Mozzarella». Die Köstlichkeiten Venetiens haben ihn geprägt, ebenso die eindrucksvollen, reichen Kunst- und Kulturschätze Venedigs, der Sehnsuchtsstadt auf Stelzen, die Vincent Klink uns in diesem Buch jenseits der Rialto-Brücken-Postkarten-Romantik auf seine gewohnt lässige und authentische Art nahebringt. Mit Goethe und Montaigne im Gepäck begibt er sich auf die Reise, passiert den Brenner Richtung Bozen und Trient, wo er lilafarbenem Risotto begegnet, macht Abstecher nach Vicenza und Padua, bis er auf dem berühmten Markusplatz im Caffè Quadri (wo schon Lord Byron und Stendhal verkehrten) zum Frühstück ein Cornetto genießt. Was folgt, ist eine gewohnt reizvolle, Klink′sche Mischung aus Rezepten, Beschreibungen venezianischer Spaziergänge und Ausflügen in die Umgebung: ein ebenso kultursattes wie kulinarisch verheißungsvolles Porträt von Venedig und Venetien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vincent Klink
Ein Bauch spaziert durch Venedig
Über dieses Buch
Als junger Koch fuhr Vincent Klink zum ersten Mal nach Venedig. Seitdem ist er immer wieder zurückgekehrt, denn die Lagunenstadt bietet alles, was sein Herz begehrt: hinreißende Architektur, fantastische Alte Malerei, vielfältige Fischküche und das beste Carpaccio, das seinen Namen passenderweise einem Renaissancemaler verdankt.
Klink flaniert mit seinen Lesern gewohnt charmant und mit zahlreichen Anekdoten im Gepäck durch die engen Gassen und über die vielen Brücken, besucht seine Lieblingskirchen, präsentiert die Gemälde, die ihn am meisten begeistern, schippert auf dem Vaporetto auf die Inseln – und kehrt selbstverständlich immer rechtzeitig in eine Osteria ein, um regionale Köstlichkeiten vorzustellen: sarde in saòr,spaghetti alle vongole und natürlich immer wieder Tintenfisch.
Eine Liebeserklärung an die Serenissima – und eine Einladung an alle Italienreisenden, auch die terra ferma, die Region Venetien, einmal genauer in den Blick zu nehmen.
Vita
Vincent Klink, geboren 1949, betreibt in Stuttgart das Restaurant Wielandshöhe. In der verbleibenden Zeit musiziert er, widmet sich Holzschnitten, malt und pflegt seine Bienen. Er ist Autor zahlreicher Bestseller, darunter «Sitting Küchenbull» (2009), «Ein Bauch spaziert durch Paris» (2015) und «Ein Bauch spaziert durch Wien» (2019).
Impressum
Originalausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Karten © Peter Palm, Berlin
Lithografie Susanne Kreher
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Gerald von Foris
ISBN 978-3-644-01192-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig.»
Friedrich Nietzsche
Ein paar Worte vorab
Während ich vor vielen Jahren vor allem in meine Töpfe hineinstierte und auf der «Wolke sieben» meines Restaurants ein arbeitsames, aber zugleich wohliges Leben führte, fehlte mir irgendwann trotzdem etwas, nämlich fremde und neue Impulse. So kam es schließlich auf Drängen meiner Frau zur längst überfälligen Erweiterung meines Horizonts, als ich 1987 ein Flugzeug nach Venedig betrat. Beim Abheben starrte ich bedrückt und an der Technologie zweifelnd auf die sich durchbiegenden Flügel. Meine Frau hatte alles organisiert, und die junge Familie zog ins berühmte Luxushotel «Gritti Palace» ein. Ich konnte anfangs an nichts anderes denken als an die einzig sichere Konstante meines jungen Unternehmerlebens, das Ostinato von Eingangsrechnungen. Nach zwei Tagen war mir das aber vollkommen wurscht, denn der Sog dieser bezaubernden Stadt wurde rasch stärker als alle Existenzsorgen. Außerdem hatte ich irgendwo gelesen, dass nahezu alle Genies dieser Welt auf dem wackeligen Boden der Unvernunft zu Ruhm gelangten.
Venedig blies mir den Kopf frei, und ich sog die venezianische Lebensart, die neuen Gerichte und die Umgangsformen im Gritti auf wie ein Löschpapier, das ein Goethe-Epigramm abgetupft hatte. Mich begleitete dabei ein Reclambüchlein über die Geschichte der Architektur und die venezianische Renaissance. Das kleine gelbe Heft habe ich bei Besuchen in der Lagunenstadt bis heute in der Jackentasche.
Welch ein Wohlleben, die zwanglosen Osterien, die vielen Trattorien und Restaurants! Venedig hat sich bei mir bis heute schwer festgesetzt, und ich bin nahezu jedes Jahr einmal wiedergekommen – im Winter, im Sommer, bei Hitze, bei Nebel und Hochwasser. Immer wieder zog es mich in die Serenissima, und so wird es auch bis zu meinem Lebensende bleiben.
Auf meinen Reisen habe ich stets Tagebuch geführt, und die Hefte füllen mittlerweile eine ganze Bordeauxkiste. Von all diesen Erlebnissen kann ich hier nur einiges berichten, natürlich reicht es in keiner Weise, um dieser Stadt gerecht zu werden. Denn was man dort sehen, fühlen und schmecken kann, lässt sich letztlich nicht in ein Buch packen, sondern verlangt nach immer neuen Besichtigungen vor Ort.
Beim Reisen geht es mir immer um Gewinn, und zwar den beglückendsten, den es gibt, nämlich die Einverleibung des Schönen. Und nirgendwo auf der Welt ist der Tisch damit reichlicher gedeckt als in der Serenissima. Man muss aber dafür empfänglich sein. Casanova sagte sinngemäß, mit dem Hirn sei es wie mit dem Schießpulver, es ist tot und still. Wenn man es aber entzündet, gibt es Explosionen. So weit muss es mit unserem Verstand zwar nicht kommen, und keinesfalls sollen sich meine Leser wie in einem Kunstführer verfranzen. Es geht mir im Folgenden darum, eine Empathie für Vergangenes zu entzünden, weil die Ernte davon bis in die Zukunft tragen kann.
Über Venedig wurden schon Schiffsladungen von Büchern abgekippt. Braucht es noch ein weiteres? Ich meine ja, denn jeder sieht ein anderes Venedig. Mein Flanieren durch die Kultur dieser Stadt, ohne jeden Stein umzudrehen, sondern bequem dosierte Erlebnisberichte, sollen Lebensfreude spendieren und für die Schönheit die Augen öffnen. Ich gehe gerne den Essensdüften nach, die beispielsweise zentral auf dem Markt unter der berühmten Rialtobrücke zu wittern sind. Von dort, auf dem Trampelpfad bis zum Piazzale Roma, der Einfallschleuse für Pauschaltouristen, oder in die andere Richtung bis San Marco, riecht es genauso wie in deutschen Fußgängerzonen. Wenn man keinen Venezianer sehen möchte, dann ist man auf dieser Route in der richtigen Spur, nicht einsam und nicht selten unter seinesgleichen. Nur: Nichts ist ermüdender, als sich als Venedig-Tourist über Venedig-Touristen zu beklagen, und jeder hat ein Recht, sich an der schönsten Stadt der Welt abzurackern. Außerdem findet man auch heute noch viele stille Ecken, wenn man sie haben will.
Ich möchte in diesem Buch ein paar meiner Lieblingsorte vorstellen und zeigen, dass man sich in Venedig am besten einfach treiben lässt und auch auf den Nebenpfaden wandeln sollte, denn an jeder Ecke tut sich etwas Neues auf. Bevor es aber Richtung Lagune geht, möchte ich auch das Festland ein wenig vorstellen, die Terra ferma. Im Laufe der Geschichte hat sich die Dogenrepublik, die den geflügelten Löwen im Wappen trägt, zu der Region Veneto erweitert, das hinaufreicht bis zu den dolomitischen Zacken. Der majestätische San-Marco-Löwe verbindet die Hauptstadt mit dem Festland, denn auch in Venetiens Flagge ist er zu finden. Im Süden grenzt Venetien an die Region Emilia-Romagna, im Westen an die Lombardei, der Nordzipfel ans österreichische Tirol und Kärnten. Die Grenze führt am Ostufer des Gardasees entlang hinauf bis nach Südtirol. Auch nach Osten lässt sich weit blicken, denn Friaulisch Venetien dürfte die besten Weißweine Italiens keltern, deshalb wäre auch eine Anreise über Salzburg und Kärnten mit einer Rast in Udine zu erwägen.
Es lohnt sich sehr, den Blick auf dieses Umland Venedigs zu lenken, das oft etwas unterbeleuchtet bleibt. Davon handelt der erste Teil dieses Buches, sozusagen die Vorspeise, bis dann im zweiten Teil der Hauptgang serviert wird: die Durchlauchtigste Republik Venedig (la Serenissima Repubblica di San Marco). Ich sage es gern und immer wieder: Die schönste Art zu verreisen ist immer noch, den Kopf in Bücher zu stecken.
In der Nähe von Ca’ d’Oro
Terra ferma bellissima: Eine kleine Reise durch Venetien
Der Weg in den Süden: Über Brixen nach Asolo
Ich begebe mich als leidenschaftlicher Italienreisender gern auf die Spuren des französischen Schriftstellers Michel de Montaigne (1533–1592), dessen Essais für mich zu den wichtigsten Büchern überhaupt zählen. Nachdem er jahrelang zurückgezogen auf Schloss Montaigne sein philosophisches Dasein gefristet hatte, ließ er sich in den Jahren 1580/81 über die Alpen nach Venetien kutschieren, bereiste auch Venedig und Rom. Seine Erfahrungen hielt er im Tagebuch einer Reise durch Italien über die Schweiz und Deutschland fest, und etwas darin erinnert an die heutige Zeit. Epidemien plagten das Volk, Montaigne musste an den Toren jeder Stadt eine bolletta di sanità vorlegen, sozusagen seinen Impfausweis. Tolerant, genau und in entspannter Laune schildert er Koch- und Tischgebräuche, beschreibt das Leben des «einfachen Volkes», die Besuche bei den «höheren Ständen» und natürlich die Landschaft. Motorboote gab es damals noch nicht, auch führte keine Brücke nach Venedig. In Fusina bei Mestre wurde eine Gondel bestiegen. In Venedig angekommen, war Montaigne begeistert von der Lage und angetan vom «Gewühl von Menschen aus aller Herren Länder …».
Ungefähr zweihundert Jahre später, von 1786 bis 1788, trat auch Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) in diese Spur, bereiste Italien und verfasste ein zweibändiges Reisetagebuch, die Italiänische Reise. Es war dann aber vor allem ein Gedicht, das zum ersten Mal in Wilhelm Meisters theatralischer Sendung veröffentlicht wurde, das bis in heutige Zeiten zum Inbegriff deutscher Italiensehnsucht wurde: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn / Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn / Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht / Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? / Kennst du es wohl? Dahin! dahin möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. Am 28. September 1786 ließ sich Goethe von Padua die Brenta hinab nach Venedig schippern. Auf dem Lido sah er zum ersten Mal in seinem Leben das Meer. Er blieb fast drei Wochen und schrieb täglich seine heute immer noch interessanten Tagebucheinträge.
Und nun wiederum, grob gerechnet weitere 250 Jahre später, macht sich ein schwäbischer Koch auf den Weg nach Italien, zwar nicht gerade im Postkutschentempo, dafür aber mit Bedacht, sodass das Innere dem Äußeren gut folgen kann. Etappenweise möchte ich mich diesmal der Lagune nähern, und meine Tochter Eva begleitet mich. Im Juni 2021 brechen wir auf zu einem kleinen Roadtrip durch Venetien. Eva meint, beim Fliegen käme die Seele nicht hinterher, man solle sich stets auf dem Landweg nähern und auf diese Art behutsam in «Land und Leute» hineinwachsen. Übrigens, meine Tochter dient mir auf dieser Reise sozusagen als Blindenhündin. Sie regelt alles, zu dem ich zu faul bin, organisiert unsere Hotels und unsere Tische und ist die unangefochtene Herrin der Kreditkarte.
Unsere Route wird uns von Stuttgart über Ulm und Füssen nach Reutte in Tirol, über den Fernpass nach Innsbruck führen und dann den Brennerpass hinauf und wieder hinunter nach Brixen, der Bischofsstadt in Südtirol. Die beiden erwähnten Dichterfürsten nahmen übrigens den Weg über München, Garmisch, Seefeld und den Zirler Berg ins Inntal hinab. Der Berg, der die Wasser des Inn entlässt, ist der Piz Lunghin. Wenn man mich heute so anschaut, traut man es mir nicht zu, dass ich diesen Berg, immerhin 2780 Meter hoch, einmal bestiegen habe. Aber das ist lange her, und damals warf ich auch noch nicht den Schatten eines Wochenendhauses.
Sehr bequem fahren wir die Brennerautobahn bergan und kein Stau klemmt uns fest. Es ist wenig Verkehr, nur ein antiker VW-Bulli mit Hippiebemalung orgelt sich über die Europabrücke und ist für kurze Zeit unser Augenglück und Weggefährte. In jüngeren Jahren litt ich unter ungestümem Vorwärtsdrang und sammelte jede Menge Strafzettel, drückte das Gaspedal durch bis zum Anschlag, bekam aber von der Landschaft fast nichts mit. Nun erlebe ich, dass es wahrlich Schöneres gibt als den Rausch der Raserei. Es fällt mir nicht schwer, die österreichische Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, über die der Altkanzler Helmut Kohl mal die Warnbotschaft hinausschleuderte: «130 km/h sind für Deutsche unzumutbar.» Goethe schrieb seinerzeit von der Fahrt über den Brennerpass: «Die Postillons fuhren, daß einem Sehen und Hören verging, und so leid es mir tat, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freute es mich doch innerlich, daß ein günstiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte.»
Ziemlich verschnarcht verfehle ich fast die Ausfahrt nach Brixen. Ohne Brixen war mir noch nie eine Fahrt in den Süden möglich. Das liegt nicht daran, dass gehobene Stände mit Bildung mir dort den romanischen Kreuzgang mit den mittelalterlichen Fresken anempfohlen hätten oder mir die Bedeutung des gotischen weißen Turms ins Gemüt treiben wollten. Der Grund für meine Verankerung an diesen Bischofssitz sind nicht das mittelalterliche Ortsbild oder die Schätze des Diözesanmuseums. Nein, die Messlatte der Kultur liegt um einiges höher: Über ein gutes Gasthaus geht nichts hinaus. Andere Meinungen sind selbstverständlich gestattet, aber nicht mir.
Erkundung Brixens mit dem Rad
Goethe übernachtete als wirklich erste Verfehlung seiner Italienreise 1786 nicht im «Hotel Elephant», das schon seit über 400 Jahren die Türen für Vorbeireisende geöffnet hat. Seine Pferde zogen bergab schneller als ihm lieb war: «Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen den schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felsen, an dem reißenden Etschfluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure Gegenstände.» Goethe stand ziemlich unter Kuratel der Kutscher, die sich nicht nach ihm richteten, sondern nach den Pferden: «Brixen, wo man mich gleichsam entführte, so dass ich mit dem Tage in Kollmann ankam.»
Michel de Montaigne berichtete 1581 hingegen empört von der Halsabschneiderei der Wirte. Er nächtigte in Brixen jedoch ebenso wenig wie Goethe im «Elephanten», sondern im «Goldenen Adler». Diesen Gasthof gibt es urkundlich schon seit 1500, und Montaigne erwähnt ihn und die Stadt sehr lobend: «très belle ville» (eine sehr schöne Stadt) in einer «bonne auberge» (einer guten Herberge) übernachtet!
Das «Hotel Elephant» wurde schon zur Zeit Goethes von der gleichen Familie geführt wie heute. Das erste Mal war ich als junger Kerl mit meinen Eltern hier, später dann in den Achtzigerjahren, aber erst dieses Mal entdeckte ich den zauberhaften Garten, dessen zierliche, weißgestrichene Schmiedeeisentüre sich über die schmale Straße hinweg gegenüber dem Hoteleingang befindet. Der Garten, mitten in der Stadt gelegen, ist riesig und wird von einem Gärtner gepflegt, der nicht nur wie ein Philosoph aussieht, sondern das Pflanzen-Elysium auch aufs Herrlichste präsentiert. Im Grunde ist es ein kleiner, nach allen Regeln der Kunst angelegter Zauberort mit einem restaurierten Pavillon aus der Jahrhundertwende. Ein großes Schwimmbecken ist schwer zu finden und stört das romantische Auge nicht, denn es liegt mittendrin, leicht erhöht von Blumen eingefasst.
Garten gegenüber dem Hotel «Elephant»
Das «Elephant» ist ein Hotel wie ein Museum, aber alles andere als museal, sondern perfekt in Schuss, und das Personal ist von beeindruckender Professionalität. Der Koffer gelangt ohne mein Zutun aufs Zimmer. Der Uhrzeiger schiebt sich auf fünfe, und in Tirol wird früher gegessen als im südlichen Italien. So senke ich meinen heißen Schädel im Bad kurz unters eiskalte Gebirgswasser und restauriere mich binnen einer Minute. Habe ich vergessen zu erwähnen, dass meine Tochter als Expeditionsmanagerin stets alles im Griff hat? Wenn nicht, dann sei es jetzt erneut gesagt. Unten am Auto hat sie schon die Fahrräder von der Halterung befreit.
Brixen, wenn auch keine große Stadt, ist bei mittlerer Sommerhitze zu Fuß kein Vergnügen. Überhaupt, tierartige Fortbewegung überlasse ich gerne anderen, und meine Tochter denkt zum Glück genauso. Sie ist eine ziemlich modern ausgerüstete Lady, und an ihrer Lenkstange ist das Handy mit Ortungssystem befestigt. Wir radeln gemächlich die antiken Pflastersteine zum Dom hinab. Ursprünglich wurde die Kirche in der Zeit der Gotik gebaut und in den späteren Jahren dem barocken Zeitgeschmack angepasst. Das Innere ist dementsprechend üppig, was nicht so mein Ding ist. Vielleicht liebe ich ausladenden Gipsstuck mit obligater Goldhöhung auch deshalb nicht so sehr, weil ich selbst so üppig bin.
Beim Kreuzgang des Doms verweilen wir länger. Mit seinen gotischen Fresken gehört er zu den bedeutendsten Kunstdenkmälern Südtirols. An der dritten Arkade tritt der berühmte Elefant vor unser Auge. Geboren wurde das geradezu adelige Tier 1540 in Indien und auf den Namen Soliman getauft. Er war ein Geschenk der Tochter Karls V. und Isabellas von Portugal an den Neffen des Kaisers und späteren Kaiser Maximilian II. Elefanten galten als die gewaltigsten Staatsgeschenke und wurden immer wieder halb um die Welt befördert. Karl der Große erhielt von Kalif Harun ar-Raschid schon ums Jahr 800 einen Elefanten mit Namen Abul Abbas. Größere Sensationen konnte die damalige Zeit nicht bieten, deshalb werden diese Elefanten in den Geschichtsbüchern aufgeführt wie Statussymbole, die wir heute in Form von Angeber-Yachten und Protztempeln bei bestimmten Oligarchen vorfinden. Ein Elefant war nun einmal unübersehbar. Das Brixener Ungetüm befand sich also auf der Reise von Spanien nach Wien. Das Volk gierte nach Abbildungen, und da kaum ein Künstler das Vieh wirklich zu Gesicht bekam, richteten sich Zeichner, Kupferstecher und Maler nach Erzählungen und Berichten. Der Elefant an der Hausmauer unseres Hotels mutet deshalb eher wie ein Hausschwein an, dem ein langer Rüssel drangemalt wurde.
Von unser Besichtigungstour zurück, verweilen wir noch kurz im Hotelpark. Es herrscht immer noch eine Bullenhitze, und so nehmen wir das Abendessen auf der Terrasse ein, an einem Tisch, den mancher vielleicht einen Katzentisch nennen würde. Es war jedoch der letzte, der zu haben war, und wir sind mitten im Geschehen. Hinter, neben und vor mir wuselt das Servicepersonal. Hätte ich es ruhiger haben wollen, hätte ich mir eine lauschige Ecke im Garten suchen können. Aber nix da, mich interessiert immer, wie der Service den Ansturm der vielen Gäste bewältigt. Und ja, sie machen es sehr gut, ich brauche mich nicht sorgen, dass ich mich als Kollege zum Helfen anbieten muss.
Der Tisch direkt neben mir ist eine sogenannte Service-Station, dort sind Bestecke, Servietten und sonstige Tischgeräte bevorratet. Der Oberkellner bereitet dort gerade ein Tatar zu, es klappert und scheppert und er entschuldigt sich lachend: «Da sitzen Sie direkt neben der Werkstatt!» Es ist faszinierend, mit welcher Routine er das Tatar mit den vielen Zutaten anmischt. Der Mann ist sich seines Auftritts auch ziemlich bewusst, er ist sozusagen «on stage». Das hat zur Folge, dass der halbe Laden nun Tatar bestellt, Eva und ich ebenso. Für Unterhaltung ist also gesorgt. Der Oberkellner und Tatar-Virtuose entschuldigt sich noch mal wegen der andauernden Unruhe. Ich beruhige ihn und sage: «Es gibt nichts Schöneres, als Könnern beim Arbeiten zuzuschauen!»
Nach einem kalten Bier, nun sichtlich erholt, bestelle ich einen Wein vom Schloss Juval. Das Weingut im Vinschgau ist im Besitz von Simon Messner, dem Sohn des Bergsteigers Reinhold Messner. Der Weißburgunder aus dem Jahr 2019 mit frischem Duft spendet mir geradezu morgendliche Frische. Nach dem Tatar sind Schlutzkrapfen an der Reihe. Letztere sind nichts anderes als Ravioli, meist in brauner Butter mit Salbei serviert. Eva gibt bereits auf, aber ich nehme noch etwas Reh. Dann kommt noch Käse und ein schöner Rotwein dazu, ein Lagreiner, beides sind mir immer das beste Betthupferl. Die Südtiroler Weine liebe ich wirklich sehr, denn gerade die rote Lagreinertraube um Bozen zwickt mich nicht durch übermäßige Säure. In meiner Jugend, als mein Magen noch rieslingtauglich war, konnte ich noch jeden Sauerampfer vertragen.
Im «Elephanten» wurde schon immer auf solidem Niveau gekocht. Damals kaute sich die Tiroler Küche aber noch vorwiegend krachledern, knödelig und von Bauernspeck befeuert. Mittlerweile ist diese Küche zwischen Gebirgsspezialitäten und italienischen Einflüssen auf dem Höchststand. In nahezu jedem Ort ist ein außergewöhnliches Gasthaus zu finden. So die Berichte meiner Freunde. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mir nie eine andere Idee kam, als den «Elephanten» aufzusuchen.
Wer nach solchen Abendessen nicht traumlos ins Bett fällt, dem ist nicht zu helfen. Als finalen Gutenachtgruß hole ich mir auf dem Zimmer, wahrscheinlich etwas navigationsunsicher wegen des abschließenden Grappas, an einer wertvollen Intarsienkommode einen blauen Fleck.
Nach einer tatsächlich formidablen Nacht schaue ich mir am nächsten Morgen vor dem Frühstück noch das Hotel genauer an. Zwar bin ich hier schon oft abgestiegen, aber ich will ja nun darüber schreiben und gucke deshalb ein bisschen genauer hin. Es tut richtig gut, dass man hier die Gewissheit hat, nicht in einem juvenilen Start-up-Unternehmen verwahrt zu werden. Nur erlesene Antiquitäten sind hier zu finden, und keinerlei Kunstblumen beleidigen meinen Sinn fürs Exquisite. Ganz besonders sticht mir die breite, geradezu festliche Treppe ins Auge. Ein roter Teppich ist über die Stufen gezogen und wird von polierten Messingstangen in Fasson gehalten. Es kommt aber noch toller, und das habe ich wirklich noch nirgends gesehen: um den Teppich zu schonen, und überhaupt wegen des Sauberkeitsanspruchs, führt in der Mitte der Teppichtreppe ein weiß erstrahlender, frisch gewaschener Baumwollstreifen ins Parterre. Es mutet an, als hätte man dem roten Läufer eine gestärkte Serviette aufgelegt. Man merkt, hier ist eine Besitzerfamilie am Start, die mit Herz und Professionalität zu Werke geht. Die Tradition des Hauses ist immer spürbar, aber mein Zimmer ist dennoch modern und absolut elegant. Nirgends überflüssige Schnörkel, die vielleicht mein Vater geliebt hätte, der an diesem Hotel nie vorbeifuhr, ohne hier gut zu essen.
Edler Aufstieg
Dem Licht entgegen gehe ich zum Frühstück auf die Terrasse mit Ausblick auf den gegenüberliegenden Park, der mitten in der Stadt liegt. Gute Croissants machen mich ganz verrückt, und ich verliere in ihrer Anwesenheit rasch die Beherrschung. Opulentes Frühstück ist ja eigentlich mehr was für Engländer und Amerikaner als für den Schaffer aus Schwaben. Doch hier kann ich nicht widerstehen, esse gleich drei von den Dingern, allerdings nicht mit Marmelade garniert, sondern als Kraftpaket mit gekochtem Tiroler Schinken angehäufelt. Nach so einem reichlichen Mampf könnte man sich eigentlich gleich wieder ins Bett legen, aber meine Tochter möchte unbedingt die Drei Zinnen besichtigen. Sie meint, einmal im Leben müsste man diese schönsten Berge der Welt sehen. Also unterbrechen wir unsere geradlinige Fahrt mit einem Schlenker nach Osten.
Dem geneigten Leser sage ich es gleich: Lassen Sie es bleiben, es sei denn, Sie haben wirklich sehr viel Zeit. Wir befehlen unserem Auto das Bergsteigen auf dem Weg nach Sankt Ulrich im Grödnertal, durchfahren Wolkenstein, um kurz zu verweilen und eine kleine Gedenkminute für den Dichterfürsten des Spätmittelalters, Oswald von Wolkenstein (um 1377–1445), einzulegen. Von ihm sind über 130 Texte überliefert. Sie gehören zu den bedeutendsten Buchschätzen überhaupt. Seine zwei Liedersammlungen sind kalligraphisch prachtvoll gestaltet und mit Notenschrift ausgestattet und waren schon in damaliger Zeit eine Seltenheit.
Doch weiter. Auf dem Papier mutet die Berg-und-Talfahrt zunächst harmlos an. Die Karte liegt unschuldig eben auf dem Tisch, in meinem Fall ist es das iPad, und gaukelt uns vor, völlig flach und easy zu sein. Unser Plan ist es, auf die andere Seite der Dolomiten ins Tal der Piave vorzustoßen, um dann von oben nach Venetien einzufallen.
Venetien beginnt allerdings viel früher als man ahnt, nämlich mitten in den Dolomiten in der Nähe des Falzaregopasses. In Luftlinie dehnt sich die Strecke durch die Bergwelt höchstens auf 60 Kilometer. Durch die schöne, ergreifende Landschaft arbeitet sich unser Auto durch Spitzkehren in tiefe Täler und dann wieder hoch zu atemberaubenden Felsenzacken. Andauerndes Kurbeln am Lenkrad, es ist eine anstrengende Fahrt. Aber meine Tochter will nun mal furchterregende Felswände sehen, und ich bereue es am Ende auch trotz aller Strapazen nicht, denn eine solch wilde Landschaft habe ich noch nie erlebt. «Meine Berge» fand ich immer in der Schweiz, aber bis auf die Eiger-Nordwand und einige Zacken im Bergell oder das Matterhorn sind nur wenige so steil und schroff wie hier in den Dolomiten. Da wird man richtiggehend demütig.
Dramatische Landschaft – die Dolomiten
Rauf und runter durch enge Kurven, dann, endlich, meine ich, die Drei Zinnen erahnen zu können. Doch welch ein Irrtum. Es geht wieder runter ins Tal, und das noch sehr häufig. Hinauf auf 2000 Meter, dann wieder runter und wieder hinauf und wieder hinunter … Die Straße führt über Pässe nicht nur über das Grödnerjoch. Die von vielen Rennradlern gekaperte Straße zieht sich an der Sellagruppe vorbei, über den Falzaregopass nach Cortina d’Ampezzo. Diese Stadt hat seit den Olympischen Winterspielen im Jahr 1956 einen legendären Ruf. Mir sei ein Bremsmanöver der Begeisterung erlaubt, wenn ich sage, dass die Stadt unter Umständen dann schön sein könnte, wenn sie von hohem Schnee gnädig bedeckt wäre. Also weiter.
Nach der Olympiastadt werden die Spitzkehren weniger, es geht nun ständig bergab. Die Ortschaft Giralba liegt direkt unter den Drei Zinnen, so sieht es jedenfalls auf der Landkarte aus. Auf dieser kann man nicht erkennen, dass dazwischen noch ein Gebirgsmassiv die Sicht nimmt. Ein bisschen wehmütig sind wir schon, denn um sich den Drei Zinnen zu nähern, hätten wir noch mal einen Umweg fahren müssen. Kurz vor Auronzo di Cadore können wir wenigstens eine Zacke der Drei Zinnen erspähen. Diese zeigt sich wegen der großen Entfernung jedoch ziemlich klein, aber Eva und ich sind beide mit außergewöhnlicher Fantasie ausgestattet und meinen, vor dem inneren Auge dort sogar Kletterer erspähen zu können. Egal, jetzt wissen wir wenigstens, warum die Dolomiten seit Generationen die Leute in Begeisterung versetzen. Die Durchfahrung des Gebirgs hat über fünf Stunden in Anspruch genommen, dies nur nochmals als Warnung. Hätten wir Evas Mutter, meine Ehefrau und meinen Lebenskompass Elisabeth dabeigehabt, sie hätte uns für diese Detour schwer zusammengestaucht.
Das Tal der Piave ist erreicht, die Schnellstraße führt an Pieve di Cadore vorbei. Gedanklich spendiere ich mir eine Gedenkminute für den großen Maler Tizian (ca. 1488–1576), der hier geboren wurde und zu Lebzeiten auch «Cadore» gerufen wurde. Er ist der große Meister der Hochrenaissance und wird uns noch öfter begegnen.
Wir genehmigen uns keine Pause und kein Mittagessen, sondern drängen vorwärts. Vor Valdobbiadene mehren sich die Hinweisschilder, dass wir uns nun auf einem Schlachtfeld befinden. Drei furchtbare Gefechte des Ersten Weltkriegs entließen viel Blut in die Wasser der Piave, die sich teilweise aufstaute, da die Leichen den breiten Fluss verstopften. 1918 kämpften an der sogenannten «Prosecco-Linie» die Österreicher und Deutschen gegen die Italiener. Ernest Hemingway (1899–1961) diente zu dieser Zeit an der Piave als Sanitäter. Er versorgte Verwundete und machte sich freiwillig mit einem Fahrrad auf den Weg, um den Kameraden einen Rucksack voll Schokolade und sonstiger Verpflegung zu bringen, als er sich einen Granatsplitter fing. Aus dieser Erfahrung destillierte er seinen späteren Roman In einem anderen Land (1929). Auch sein Landsmann, der sozialkritische Schriftsteller John Dos Passos (Manhattan Transfer), diente kurze Zeit als Sanitätsfahrer an dieser Front.
Damals wurden alle Brücken gesprengt. Heute ist davon nichts mehr zu sehen, das Grün um uns herum zeigt sich als aufgeräumte Kulturlandschaft, und bequem führt die Straße nach Westen über die Piave auf die Asolaner Berge zu. Links und rechts säumen unzählige Prosecco-Weinstöcke unsere Straße. Das echte Proseccogebiet liegt zwischen Valdobbiadene am östlichen Ufer der Piave und dehnt sich weiter bis ins südöstliche Conegliano aus. Im Südwesten schließt sich das Prosecco-Dreieck bei Asolo. Aus diesen, geradezu ineinander lieblich verschlungenen Hügeln kommen die edelsten Schaumweine mit dem berühmten Signet: Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Mamma mia! Was für ein Promotiontitel. Drum herum liegt ein weiträumigeres Gebiet, dort keltert man eine Stufe darunter und verliert einen Buchstaben: DOC (Denominazione di Origine Controllata). Und noch etwas weiter am Rand dieser Rebengegend wächst ein Gebizzel, was millionenweise in die Kehlen dieser Welt geschüttet wird. Als Partygetränk kann man es durchgehen lassen, die Bayern nennen billigen Sekt jeder Art «Kracherl».
Valdobbiadene – Heimat des Prosecco
Eine gefüllte Prosecco-Flöte erster Güte erwartet uns im legendären «Hotel Cipriani» in Asolo, aber das muss noch warten. Die Uhr zeigt erst vier, und an der Villa di Maser einfach so vorbeizurauschen, käme einem Kulturfrevel gleich. Die Villa di Maser nennt sich eigentlich Villa Barbaro (nach der berühmten venezianischen Patrizierfamilie) und liegt unweit von Asolo an einer schmalen Landstraße. Vom riesigen Tor führt eine Parkanlage hinauf zum breit angelegten Palazzo. Der gelbweiße, elegante Bau ist einstöckig und in der Mitte zentriert sich ein klassizistischer Säulenbau mit einem weiteren Stockwerk. Die Villa wurde um 1554 von Andrea Palladio (1508–1580) erbaut, dem bedeutendsten Architekten der Renaissance, und zu Recht ins UNESCO-Welterbe aufgenommen. Das Besondere an dieser Villa sind die darin befindlichen Fresken des venezianischen Renaissancekünstlers Paolo Veronese (1528–1588). Er war ein Meister raffiniertester Perspektive, gab seinen Gemälden und Fresken dadurch großen Raum, so als könne man ihn ungehindert betreten. Seine Farbenlebendigkeit und die Lichtführung machten ihn ebenfalls zu einem Neuerer.
Ein Juwel: Villa di Maser
Wer sich die Villa Maser anschauen möchte, sollte allerdings vorher das Internet nach den Öffnungszeiten abklopfen. Ins Innere habe ich es vor vielen Jahren einmal geschafft, dieses Mal sind die Pforten verschlossen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als die Fassade zu fotografieren und auch die Landstraße ins Auge zu fassen, die mit einer schönen klassizistischen Kirche geschmückt ist. Sie gehört zum Ensemble dieses Glücksortes.
Weiter geht’s. Es bleibt noch Zeit für einen Umweg nach Possagno. In nur fünfzehn Minuten sind wir am Grab Antonio Canovas, dessen Werke man im Museum des Ortes bewundern kann. Sein Mausoleum ist dem Parthenon in Athen nachempfunden, also wieder ein Tempel, der an die alten Griechen erinnert. Der Bildhauer gilt als ein ganz Großer des Klassizismus, er lebte von 1757 bis 1822, wurde hier in Possagno geboren und wirkte viel in Oberitalien, vorwiegend jedoch in Venedig. Das Museum müssen wir uns leider sparen, aber ein Rundgang um das Bauwerk, auf den eine Sichtachse mit weißem Kies hinführt, ruft in mir, mittlerweile hungrig und müde, doch noch erhebende Gefühle hervor.
Nicht nur die Stimmung an diesem Ort, sondern auch der dahinter aufragende Monte Grappa zwingt mich zur Nachdenklichkeit. Am 11. November 1918 war nach vier verheerenden Jahren der Krieg zu Ende, aber im Geburtsstädtchen von Canova lebte schon seit einem Jahr niemand mehr. 1917 war der Ort evakuiert worden, weil deutsche und österreichische Truppen ins Veneto vorgedrungen waren. Ständig wurde Possagno vom Monte Grappa aus beschossen. Canovas Bruder hatte die vielen Gips-Plastiken des großen Künstlers zu einer Sammlung, der «Gipsoteca di Possagno» zusammengeführt, damals weltweit die größte ihrer Art. Sie wurde dann im Dezember 1917 dezimiert, als zwei Granaten der österreichischen Artillerie einschlugen. Auch diese Geschichten gehören zu dieser lieblich anmutenden Gegend, in der man sich wirklich noch viel längere Zeit herumtreiben könnte. Es ist die typische südliche Voralpenlandschaft mit malerischen Hügeln und Weinbergen und Eichenwäldern. Und immer wieder darin eingestreut, wie Signale oder in den Himmel gereckte Zeigefinger, die schwarzgrünen Zypressen.
Canova-Tempel bei Possagno
Eine schmale Straße führt bergan, dann wieder hinab. Vor vierzig Jahren verbrachte ich in dieser idyllischen Endmoräne, welche die Gletscher der Eiszeit hinterlassen haben, mit meiner Frau Elisabeth einige Tage. Das Städtchen Asolo kann man getrost als Traumort bezeichnen, in der Hauptreisezeit kann es hier allerdings sehr voll werden. Den Marktplatz schauen wir uns morgen an, lieber biegen wir in eine enge Gasse ab und dann rechter Hand pfeilgrad in die große Garage des Hotels ein, in das wir heute einkehren werden.
Der «Palazzo Cipriani», zu Palladios Zeiten erbaut, war schon immer ein Luxushotel, das wir uns damals eigentlich nicht leisten konnten. Am Haus hat sich bis heute nicht viel geändert, an unserem Geldbeutel auch nicht. Es gibt ja den wunderbaren Merksatz: Wer sich nicht ruiniert, aus dem wird nichts. Schon damals war mir bewusst, dass man gute Gastronomie und Hotellerie nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Man muss zuvor auch etwas hineingeben, muss Erfahrungen sammeln und viele Gasthäuser und Herbergen aufsuchen, sozusagen mit den Augen stehlen. In meiner Jugend, als blindes Küchenkaninchen, kam es bei jedem Ausflug zu einem Gewinn. Mit Mund, Nase und mit den Augen wurde «einverleibt».
Im Restaurant des Hotels ist eine Klientel anzutreffen, die sich vom sogenannten Neureichentourismus erheblich absetzt. Auf der Terrasse am Nebentisch sitzt ein Engländer, der deutlich hörbar kein Cockney spricht. Er gibt seine Bestellung auf und wendet sich dann wieder seinem Buch zu, auf dem ich den Titel Aretino ausmachen kann. Auf Pietro Aretino, der über lange Zeit in Venedig wilde Schriften verfasste und mit seinen Texten in einem Maße glänzte, dass sogar Tizian ihn porträtierte, werden wir noch gesondert zu sprechen kommen.
Neben dem Hotel führt eine schmale Gasse bergan aufs Zentrum zu. Die Villa Duse ist leider nicht zu besichtigen, ihre prächtige Vorderseite wäre nur vom gegenüberliegenden Abhang zu sehen. Eleonora Duse (1858–1924) war um die Jahrhundertwende neben der Französin Sarah Bernhardt die berühmteste Schauspielerin der Zeit. In Asolo lebte auch die englische Forschungsreisende Freya Madeline Stark (1893–1993), die stolze hundert Jahre alt geworden ist. Von der hatte ich noch nie gehört, aber der Concierge, der schon viele Jahre seinen Dienst verrichtet, erzählte mir, was es mit dem Foto im Seitentrakt des Hotels auf sich hat. Es zeigt ein Porträt der englischen Queen Mom mit der Signatur «Elizabeth R. 1987». «Ja, Queen Mom hielt sich hier im Hotel für neun Tage auf, um sich mit ihrer Freundin Freya Stark zu treffen», so die Auskunft des kundigen Concierge. Wenn eine englische Adlige eine solch weite Reise unternimmt, muss schon ein bisschen was geboten werden. Und das war neben der märchenhaften Gegend auch Freya Stark mit ihren Romanen wie Pässe, Schluchten, Ruinen oder Durch das Tal der Mörder. Die Bücher handeln von Emanzipation und Abenteuern in den 1930er-Jahren und sind heute noch spannend zu lesen.
Keine Frage, das «Cipriani» hat eine starke Aura, vielleicht nicht für jeden, aber ich bin für alte Gemäuer empfänglich. Ich glaube nicht an Geister, aber meine reichliche Fantasie zieht mich zu den Verstorbenen, für die ich manchmal mehr Empathie empfinde als für die Lebenden. Nach drei Tagen war dann aber so viel Geld verwohnt, dass wir die Stätte dieser gastronomischen Hochkultur verlassen mussten. Seitdem sind 45 Jahre vergangen, und in Zehnjahresabständen sind wir immer wieder mal vorbeigekommen.
Hotel Cipriani in Asolo
Das Hotel ist sich immer treu geblieben, ist aber dennoch zeitgemäß in Schuss und gut restauriert, durch WLAN auch mit der modernen Welt verbunden. Hinzu kommt wirklich geschultes Personal und hochwertige Ausstattung. Auf meinem Zimmer, es ist nicht groß, finde ich schlanke, feinpolierte Möbel, Sessel und ein kleines Sofa in sandfarbenem Jacquard-Stoff, also gewoben und nicht bedruckt. Im Bad lachen mich handbemalte Kacheln an. Sie sind farbig, aber nicht bunt. Ich schätze mal, sie sind mindestens 80 Jahre alt. Ich öffne das zweiflügelige Fenster, das nicht der deutschen DIN-Norm entspricht und gerade deshalb sehr schön ist und trotzdem funktioniert! Und dann öffnet sich der Blick auf die kleinen Hügel, die Colli Asolani, mit den vielen Zypressen, die sich dem Himmel geradezu mahnend entgegenstrecken, als wollten sie darauf hinweisen, dass ein besonderer Gast die Gegend beehrt.
Auf der Terrasse blicken meine Tochter und ich anschließend auf einen wundervollen Garten mit Palmen, einem Granatapfelbaum und auf die traumhafte Landschaft, die sich dahinter erstreckt. Der Dichter Giosuè Carducci (1835–1907), in Oberitalien berühmt, nannte Asolo «die Stadt der hundert Horizonte». Es ist eine schöne Wandergegend, aber selbst mit dem Auto tut sich hinter jeder Kurve ein anderer entzückender Blick auf. Irgendwie erinnert mich diese Kulturgegend an die idealisierte Landschaftsmalerei der Romantik.
Zum Asolaner Prosecco werden heute bigoli di Bassano con ragù d’anitra, also Entenragout, bestellt. Bigoli sind eine Spezialität Venetiens, es handelt sich dabei um dicke hausgemachte Eierspaghetti. Es gibt Teigpressen, durch die man sie quetschen kann. Man kann sie auch fertig kaufen, aber dann sehen sie aus, als hätten sie im Windkanal trainiert. Mit diesem Rezept jedoch bereiten Sie sie zu wie vor fünfhundert Jahren. Sie werden mit dem Handteller auf einem bemehlten Brett zu langen, dünnen Würstchen «genudelt».
Für 4 Personen
Hartweizengrieß
3Eidotter (Eigelb)
1Ei
1 TLOlivenöl
1 TLSalz
Egal, wie die Maßeinheiten sind, am Schluss muss ein sehr fester Teig zusammengeknetet sein. Den Teig immer feucht abdecken und etwa haselnussgroße Stücke entnehmen. Diese zwischen den Handtellern zu einem Torpedo formen. Möglichst kein Mehl auf den Tisch streuen, dann lange Würstchen ausrollen. Die fertigen Bigoli anschließend gut mit Mehl bestreuen, damit sie nicht zusammenkleben. Die «Würmer» dürfen gern zwanzig Zentimeter lang sein. Sie kommen für 7 Minuten in kochendes Wasser.
Eine kleine Warnung vorab: Pro Person benötigt man, wenn der Teig fertig ist, mindestens 15 Minuten für das Zwirbeln. Die Nudeln sehen etwas «homemade»-zerknittert aus.
Im Hotel Cipriani und in ganz Venetien werden die Bigoli bevorzugt mit Entenragout gereicht. Ganz zwanglos kann man aber Bigoli in allen Variationen bereiten, die auch für Spaghetti angewendet werden.
Meine Tochter wählt das berühmte «Carpaccio Cipriani». Es gibt mittlerweile unzählige Carpaccio-Varianten, von Käse, Orangen, Kohlrabi, Rote Bete, Zucchini usw. Alles Blödsinn, es gibt nur ein Carpaccio, und das wurde vom Gründer dieses Hotels erfunden: Ein großer Teller wird mit hauchdünn geschnittenem Rinderfilet belegt, Pfeffer und Salz kommt obenauf und darüber wird mit einer speziellen Mayonnaise, ein Geheimrezept, ein Rautengitter gespritzt. Fertig. Mehr ist es nicht, kein Rucola oder sonst irgendwas. Arrigo Ciprianis «Harry’s Bar» in Venedig, die wirkliche Keimzelle des Gerichts, stelle ich später noch ausführlich vor. Als Hauptgericht bestellen wir costoletta alla Milanese. Das ist letztlich nichts anderes als ein Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken, an dem der Kotelettknochen noch dran ist. Alles wird paniert und sanft gebraten.
Für 2 Personen
Kalbskoteletts, dünn geklopft
2 ELSemmelbrösel (bitte vom Bäcker)
2 ELMehl
2Eier
250 gButterschmalz
1 ELfrische Butter
Pfeffer, Salz
Allgemein hält man die costoletta, wie das Wiener Schnitzel, für ein simples Gericht. Trotzdem behaupte ich, dass neunundneunzig Prozent der Bröselfans, im Gegensatz zu mir, nicht an einer Fritteusenphobie leiden. Kurzum, was man oft unter einfacher Küche einordnet, ist meist davon belastet, dass es sich viele Köchinnen und Köche zu einfach machen und die Lappen einfach in die Fritteuse schmeißen. Es kommt aber eben genau auf die Panade an. Fertige Industrie-Semmelbrösel taugen nicht einmal zum Sandburgenbauen, man sollte deshalb das Gebrösel beim Bäcker kaufen.
Auf das Fleisch kommt es natürlich auch an. Ein vakuumiertes, im eigenen Saft vor sich hinsäuerndes Quälfleisch wird immer erstickt schmecken. Also gutes Fleisch aus dem