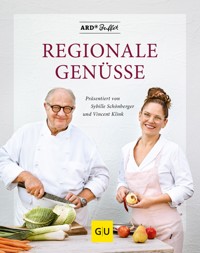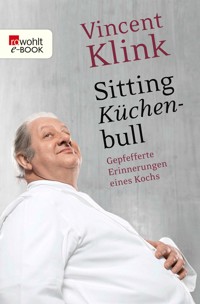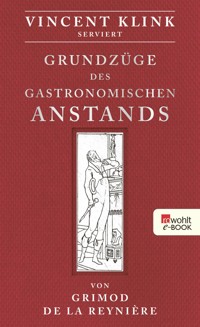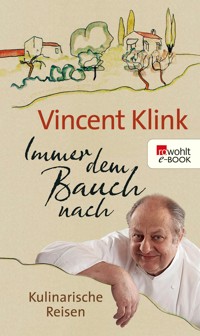
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Sternekoch Vincent Klink unterwegs ist, denkt er vor allem an eines – das Essen. Und was er auf der Suche nach Gaumenfreuden in aller Welt erlebt hat, davon erzählt er hinreißend: Ob er Venedig mit Kanu und Zelt erkundet, in Grönland furchtlos von merkwürdigen Fischspezialitäten kostet oder man im Jemen rasch eine Ziege schlachtet, um ihm ein Frühstück servieren zu können – immer wieder trifft er auf ungewöhnliche Menschen und erlebt skurrile Begebenheiten. Ein Buch für Reiselustige und Genießer! Mit Fotos und Zeichnungen aus dem Reisetagebuch des Autors. «Klink war schon immer weniger nur der Koch als vielmehr ein Entdecker und Aufschreiber der Welt.» Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Vincent Klink
Immer dem Bauch nach
Kulinarische Reisen
Über dieses Buch
«Beim Anblick des Gewusels auf dem Fischmarkt von Chioggia, des Geschreis der Verkäufer und der Begeisterung, mit der die jeweilige Ware angeboten wurde, bekam ich einen Wahnsinnshunger. Ich musste handeln. Also lehnte ich mich an eine der Säulen der Arkaden und ließ meinen Blick schweifen. Das mache ich immer so: So lange Ausschau halten, bis ich eine Type ausmachen kann, die einen ähnlich großen Bauch hat wie ich. Es ging ruck, zuck, denn ich lag ja nicht in Berlin-Mitte auf der Lauer, sondern im Kernland der leiblichen Genüsse. Einen fassartigen Signore sprach ich mit dem wichtigsten Satz meines Reisewörterbuchs an: ‹Dov’ è un ristorante buono?› Der Mann strahlte mich an, wie wenn sich zwei Christen auf einem Pass in Afghanistan gut leiden mögen. Wahrscheinlich fand er einfach meinen Ranzen gut. Jedenfalls zeigte er darauf und betonte ein Wort, das für mich wie ‹Pansen› klang. Und ich verstand: ‹Si, un ristorante al centro, a sinistra.› Ich warf dankend die Arme hoch und verfrachtete mich dorthin.»
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Umschlagabbildungen: Boris Schmalenberger; privat)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62714-9 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-44391-4
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vincents Reisetagebücher
Vorwort
Vincent der Seefahrer lernt ein neues Artischockenrezept
Barrique im Remstal
Die Entenpresse des Tour d’Argent
Blutwurst in den Tropen
Riesling, Riesling, Riesling
Zwei Schwaben in New York. Ein Dramolett
Das Auge des Hammels
Frühstück im Jemen
Stuttgart
Schotterboden und Weihrauchduft – eine Weinexkursion ins Elsass
Harry’s Bar Venedig
Bavarian Breakfast
Angeln im Jura
Halloween
Neapel sehen und doch nicht sterben
Überfall in den provenzalischen Bergen
So riecht der Norden
Eine Reise zum Vierkanthof des Thomas Bernhard
Das Butterbrot auf San Lazzaro degli Armeni
Burgund, schön und tragisch
Gaudium Gamundia oder warum ich immer noch gerne nach Gmünd fahre
Vincents Reisetagebücher
Vorwort
Es gibt Leute, die ein solch geruhsames Berufsleben führen, dass sie im Urlaub den Amazonas hinaufschnorcheln müssen. Andere haben zu Hause zu wenig Durst, so zieht es sie in die Wüste. Der Mensch braucht Abwechslung, und mancher will nach oben, immer öfter so weit, bis die Luft ausgeht und man gleich oben bleibt, auf dem Mount Everest. Es gibt viele Gründe, sich zu ruinieren. Mich treiben Hunger, Durst und die Neugierde nach anderen Aromen in die Fremde.
So hänge ich meine Nase in den Wind und lasse meine leergetrunkenen Flaschen auf dem Boden kreisen. Achtung, sie zeigen selten nach Norden, sondern fast immer nach Süden, nach Italien oder Frankreich. Nichts gegen den Norden, auch dort gibt es passable Futterstellen. Die des Südens sind jedoch mehr nach meinem Geschmack. Die lateinische Lebensfreude ist überschäumend, die Tafeln sind reich gedeckt und die Weinkeller prall gefüllt. Das Leben folgt dort nicht der Rücksichtnahme auf den Gelderwerb, sondern der Tagesrhythmus wird durch die Essenszeiten bestimmt. Er folgt dem Dejeuner, den Soupers, Diners und der Vielfalt des mediterranen Angebots, wunderbare Salate, Gemüse, Trippa, Minestrone – Mangiare eben und nicht Food oder dolles Frühstück.
Was liegt mir näher, als die Länder zu meiden, in denen gut gefrühstückt wird? Wozu brauche ich ein Frühstück, wenn mir vom abendlichen Bœuf Bourgnignon, von Meeresfrüchten und olivenölschwangerer Pasta und Vino noch der Ranzen spannt? Gewiss, Busreisen nach Skandinavien zu sagenhaften Smörgåsbords sollen sehr billig angeboten werden. Gut frühstücken, und was kommt dann? Oder muss man nach England, nur weil die Billigflieger dorthin steuern? Da gibt’s auch nur Frühstück oder einige Superköche, die in der Stunde mehr kosten als ein Jahr lang Ryan-Air fliegen.
Tja, Paris, das wäre auch mal wieder dran. In vielen Restaurants wird immer noch das kulinarische Maß aller Dinge zelebriert. Ganz billig kann das nicht sein, aber zu den Leuten möchte ich auch nicht gehören, die nur Urlaubsspaß haben, wenn’s billig ist. Da könnte ich mich ja gleich in ein Aldi-Regal legen und endlich mal heilfasten.
Vincent der Seefahrer lernt ein neues Artischockenrezept
Nicht die Sonne weckte mich, sondern mein kleines Zeltchen wackelte, als rüttelte der Schirokko, der sandgelbe Wind aus Afrika, daran. Nichts wie raus aus dem Schlafsack! Da zerrte jemand von außen den Reißverschluss nach oben, und mit der kalten Morgenluft drängte ein drohgebärdiger Schädel ins Innere und verfinsterte das Morgenlicht. Alarm! Ein Überfall? Doch schnell sprang mir der glitzernde Kragenspiegel entgegen. Es musste ein Soldat, Carabiniere oder sonstiger Ordnungsfanatiker sein. Vorsichtshalber und mit treudeutscher Obrigkeitsangst stammelte ich «Scusi» und wiederholte diese Unterwürfigkeit dann gleich noch einmal. Lag ich doch völlig wehrlos, in der Unterhose, und hatte wohl eine Strubbelfrisur, die in dem Uniformträger womöglich Verhaftungsgelüste weckte. Ich presste mir ein weiteres devotes «Scusi» ab. Wie pflegte mein Vater, der Tierarzt, zu sagen: «Musch immer schwätze mit de Tierle.»
Mir war aber gar nicht nach diplomatischer Finesse, vielmehr kämpfte ich mit meinen rudimentären Italienischkenntnissen gegen das lauernde Schweigen des Uniformierten. Der Reißverschluss des Zelts klaffte nun offen wie eine Wunde. Mein Gegenüber glich einem Heerführer. Er trug eine grüne Jacke aus glattem Loden mit goldenen Abnähern, goldenen Knöpfen und sonst allerlei Zierrat, was dem Mann sicher zu seinem monströsen Selbstvertrauen verhalf. Schließlich kübelte er, offensichtlich befehlsgewohnt, eine Flut italienischer Vokabeln auf mich herab. Es klang nicht gut. Ich schielte an dem Generalissimus vorbei: Mein Kanu dümpelte noch an der Mauer, die Sonne schien bereits hell, und ich krabbelte vollends aus meinem kleinen Kokon. Eigentlich sah alles ganz friedlich aus, bis ich das Schild sah: «Zona Militaria». Aha, Sperrgebiet. Reflexartig ließ ich meinen Charme spielen und deutete mit ausholenden Armbewegungen an, dass ich sofort von hier verschwinden würde. In der Dämmerung des Vorabends hatte ich völlig vernünftig und auch nautisch logisch gehandelt, indem ich das Kanu an der Kaimauer des Leuchtturms von Chioggia festmachte. Wenn es einen sicheren Ort gab, dann den. Auf einem kleinen Wieslein an den Mauern des Turms schlug ich mein Zelt auf.
Den Nachmittag hatte ich am Hafen verbracht und mir all die Fischkutter angesehen, die dort zu Hunderten vor Anker lagen. Chioggia ist der größte Fischereihafen der Adria, dementsprechende Betriebsamkeit herrschte dort, was mich ziemlich faszinierte. Schon damals, vor zwanzig Jahren, hieß es, das Mittelmeer sei leergefischt. Das mochte stimmen, aber am Kai, auf dem angrenzenden Fischermarkt und in der Auktionshalle gab es Unmengen kleinen Meeresgetiers, das der Seezungen- und Steinbuttesser vielleicht als Kroppzeug verschmähen würde: Sardinen, Merluzzo (Dorsch, Seehecht), Coda di Rospo (kleiner Seeteufel), Triglia (Rotbarbe) und Dentice (Zahnbrasse). Sie heißt so, weil jede Zahnarzthelferin beim Anblick dieser kariesfreien Gebisse in Verzückung geriete. Der Fischmarkt von Chioggia ist ein wahres Küchenparadies: Sogliola (kleine Seezunge), Rombo (kleiner Butt), alle Arten von Tintenfischen, Polpo – die mir am besten schmeckende Sepia –, Seespinnen, kleine Gambas und dann noch jede Menge Meeresfrüchte bis hin zu Muscheln, wie Vongole veraci und Capesante oder die an Urviecher erinnernde Canocchie. Das sind Heuschreckenkrebse, die ihren Namen nicht von ungefähr haben; in der Adria sind sie noch sehr häufig.
Blick von meinem Indianerkanu aus, mit dem ich 1988 die Lagunenstadt erkundete
Beim Anblick des merkantilen Gewusels, des Geschreis der Verkäufer und der Begeisterung, mit der die jeweilige Ware angeboten wurde, bekam ich einen Wahnsinnshunger. Ich musste handeln. Also lehnte ich mich an eine der Säulen der Arkaden und ließ meinen Blick schweifen. Das mache ich immer so: so lange Ausschau halten, bis ich eine Type ausmachen kann, die einen ähnlich großen Bauch hat wie ich. Es ging ruck, zuck, denn ich lag ja nicht in Berlin-Mitte auf der Lauer, sondern im Kernland der leiblichen Genüsse. Einen fassartigen Signore sprach ich mit dem wichtigsten Satz meines Reisewörterbuchs an: «Dov’ è un ristorante buono?» Der Mann strahlte mich an, wie wenn sich zwei Christen auf einem Pass in Afghanistan gut leiden mögen. Wahrscheinlich fand er einfach meinen Ranzen gut. Jedenfalls zeigte er darauf und betonte ein Wort, das für mich wie «Pansen» klang. Und ich verstand: «Sì, un ristorante al centro, a sinistra.» Ich warf dankend die Arme hoch und verfrachtete mich dorthin.
Das Restaurant zeigte sich in klassisch abgegriffener Einrichtung, doch das schönste Interieur eines Gasthauses sind die Gäste, und die wirkten sehr vertrauenerweckend rotgesichtig. Eine freudig bukolische Stimmung nahm mich gefangen. Hier hatten sich wirklich echte Lustschmatzer eingefunden, wie man sie in sogenannten Gourmetlokalen selten vorfindet. Es ging gleich zur Sache, Spada crudo stellte ein ebenso altersschwacher wie sehr professioneller Kellner vor mich aufs etwas knittrig gebügelte Weißzeug. Rohen Schwertfisch hatte ich noch nie gegessen. Mit einer Zitronenmarinade empfand ich das als Gedicht, und trotz des modernen Transportwesens – ein Fisch, morgenfrisch vom Kutter, schmeckt anders als im deutschen Binnenland. Es folgte ein Radicchio-Soufflé mit Scampisauce, dazu zwei Triglie, also Rotbarben, in Olivenöl gebraten, und dann wurde die Krönung des Mittags aufgetragen: eine Art Gulasch vom Aal. Der Hotspot der Aalproduktion nennt sich Comacchio, liegt vielleicht zwanzig Minuten im Hinterland und ist eine Art Disneyland für Aalverrückte. Was der restlichen Welt der Donald Duck ist den südlichen Venetern der Aal, den es in Nachbildungen sogar als Halsanhänger gibt. Ich trank zu diesem Fischgedicht einen offenen Weißwein von den nahen Bergen bei Abano Terme. An die Dolci kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das übliche Finale enthielt auf alle Fälle einen Espresso, und diesen von einem Gläschen Sambuca abstützen zu lassen, ja, daran habe ich mich in den letzten Jahren gut gewöhnt.
Jetzt raffte ich mein Zelt zusammen und schlingerte zur Anlegestelle. Bevor der Wachposten verschwunden war, hatte er mir noch aufgetragen, dass ich mich bei der Kommandantur für mein Vergehen melden sollte. Das Indianerkanu war perfekt gepackt, und ich tuckerte mit meinem 2-PS-Außenborderchen los. Das schmale Boot nahm mit Rückenwind dermaßen gut Fahrt auf, dass ich mich zur Flucht entschloss und pfeilgrad an der Kommandantur vorbeischipperte und Kurs auf Venedig nahm.
Der Lido Venedigs ist ein dünner Landstreifen, der sich im Grunde bis nach Chioggia hinzieht. Auf der einen Seite hat man das offene Meer, auf der Landseite die Lagune, die aussieht, als wäre es normales Meer in Küstennähe, doch die meisten Stellen sind nicht tiefer als einen Meter. Es gibt aber eine Fahrrinne, und in der fuhr ich an Palestrina vorbei. Links in der Ferne sah man die Fabrik-Ausdünstungen von Mestre. Nachdem ich trotz erheblichem Wellengang den Durchstich bei Malamocco, wo ein ausgebaggerter Kanal vom offenen Meer hohe Wellen und auch die Öltanker zum Industriegebiet Mestre trägt, hinter mich gebracht hatte, kamen kleine Inseln in Sicht.
Die erste zeigte sich mit Kirchturm und luxuriöser Anlegestelle aus kunstvoll behauenem Stein, von der eine breite Treppe nach oben führte. Ansonsten sah alles ziemlich verfallen aus. Die Neugierde ließ mich anlegen. Es war nun gegen Mittag, die Sonne stach. Ich zerrte meine Küchenkiste unter der vorderen Abdeckplane hervor und kochte Cafè alla turca – oder wie meine Oma immer den Kaffee gebrüht hatte: Pulver in die Kanne und kochendes Wasser drauf, umrühren, ziehen lassen. Dosenmilch hatte ich in einer Alutube – eine süße, dicke, sirupartige Sahneschmiere, die in mir die niedersten Fastfood-Instinkte weckte und herrlich nach Kindergeburtstag schmeckte. Nach dem Kaffee wurde zum Dessert immer noch extra an der Tube genuckelt. Die perversen Gelüste befriedigt zu haben versorgte mich mit genügend Glückshormonen, sodass ich freudig hüpfend begann, die Insel zu durchstöbern.
Als versierter Nautiker wusste ich, wo ich mich befand: auf Poveglia. Das Eiland liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Venedig und Chioggia. Hierher hatten sich schon im 5. Jahrhundert Schlauköpfe vor den germanischen Barbaren geflüchtet und es sich gemütlich gemacht. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts rückten einige Nobilitäten der venezianischen Gesellschaft nach, die am Mordkomplott gegen den Dogen Pietro Tradonico teilgenommen hatten. Hier auf Poveglia konnten sie schalten und walten, wie sie wollten. Eine eigene Regierung wurde installiert, man lebte völlig unabhängig. Bei den Venezianern am Canal Grande kam Neid auf. Sie schickten Haudraufs: Offensichtlich hatten sie von den Barbaren gelernt, wie man glückliche Leute unglücklich macht. Das frohe Völkchen wurde verjagt und in alle Winde zerstreut.
Poveglia erholte sich nie mehr richtig. Eine Werft und ein Ausrüstungskontor wurden errichtet, denn der Seehafen Malamocco befand sich ganz in der Nähe. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts baute man die Anlagen zu einem Krankenhaus um. Nach dem Krieg war dann endgültig finito. Was nicht niet- und nagelfest war, fiel Plünderern in die schmutzigen Hände. Trotzdem zeigte sich die schlossartige Anlage immer noch mit gewisser Grandezza im Nachmittagslicht. Wäre der riesige Palazzo in Schuss, hätte man es als schönstes Krankenhaus der Welt bezeichnen können. Bei meiner Erkundung der endlosen Flure des total demolierten Inneren stieß ich auf das markante Arrangement eines vorsintflutlichen Rollstuhls unter einem lädierten Madonnenbild. Das alles stimmte mich ziemlich nachdenklich, wenn nicht gar wehmütig.
Danach schlug ich mich ins rückwärtige Gebüsch, um die Insel weiter zu erkunden. Ausgetretene Pfade machten mir klar, dass hier nicht alles verlassen sein konnte. Ich roch Holzfeuer. Meine Nase wies mir den Weg, bald sah ich den Qualm. Ein schönes Gärtlein tat sich auf. An dessen Rand, neben einer hohen Mauer, hantierte gebückt ein Mann. Er war alt, das war selbst von hinten zu erkennen. Aus groben Brettern und vier Pfählen war ein Tisch zusammengenagelt, der an ein Stehpult erinnerte. So etwas hatte man im Garten, um Blumentöpfe mit Erde zu versorgen und sich Pikierarbeiten hinzugeben, ohne dass man allzu sehr buckeln musste. Rechts an der Mauer befand sich ein kleiner Holzschuppen, links zog sich ein tennisplatzgroßes Artischockenfeld hin. Wunderschöne, brusthohe Pflanzen mit Blättern wie Palmwedel, dazwischen jede Menge Carciofi mit lila-stacheligen Spitzen.
Im Inneren des ehemaligen Krankenhauses auf Poveglia – heute ein Luxushotel
Der Mann drehte sich nicht um, sondern hob bloß seinen Kopf etwas und sagte: «Lei è stato qui già da un ora.» – «Sie sind schon eine ganze Stunde hier.» Ich ging um ihn herum, damit er nicht glaubte, ich wolle ihm in den Rücken fallen. Er hatte Aluminiumfolie in ellenbreite Stücke gerissen und wickelte Artischocken darin ein. Jetzt schaute er mich an. Offenbar war er überzeugt, ich hätte ihn verstanden, er lächelte. Sein Gesicht erinnerte an eine verwitterte Felswand, aber die Augen schauten warm und verständnisvoll. Auf meine Verwirrtheit reagierte er, wie man einem ertappten Kind Güte und Verständnis anbietet. Er wies auf das nahe gelegene Gestrüpp: «Seitdem sind die Vögel still.» Ich verstand nur etwas wie «Vogel silentium». Der Alte sah nicht aus, als hätte er jemals viel Zeit mit Lesen und Schreiben verbracht. Doch er strahlte eine Weisheit aus, wie man sie manchmal bei alten Leuten auf dem Land antrifft, die trotz großer Intelligenz die Schule nicht besuchen durften, weil man ihre Arbeitskraft daheim in der Landwirtschaft benötigte. Solche Leute könnte man am treffendsten als Naturgelehrte bezeichnen. Außerhalb der technisierten Welt gibt es unglaublich viel zu lernen, sicherlich mehr als das Wissen aller Universitäten zusammen.
Zwei Artischocken hatte der Opa bereits eingewickelt. Er griff nach einem Messer mit abgenutztem Holzgriff und kurzer, schnabelartig nach unten gekrümmter Klinge aus grobem Eisen. Die Beine storchenartig hochhebend, stelzte er aufs Artischockenbeet zu. Einige Pflanzen wurden begutachtet und offensichtlich nicht für würdig erachtet. Schließlich wurde er fündig und schnitt eine Artischockenknospe ab. Sein Daumen lag am Stängel, das Messer von den übrigen Fingern umklammert auf der anderen Seite. Langsam, aber mit Nachdruck zog er schräg nach oben. Mit der anderen Hand fing er die fallende Artischocke, um sie gleich in der Jackentasche seines blauen Antons verschwinden zu lassen. Noch eine köpfte er mit derselben Artistik. Als er wieder auf mich zutaperte, begriff ich, dass er das Laufen vor einiger Zeit neu gelernt haben musste: Schlaganfall oder so. Er wickelte die neue Beute ebenfalls in Alufolie, griff sich einen Holzprügel und stocherte in der Mitte des Feuers ein großes Loch, worin er die Artischockenpäckchen versenkte. Dann schob er die glühenden Holzbrocken darüber, richtete sich auf und schniefte befriedigt.
Der Steherei überdrüssig, stammelte ich etwas von «Signore, grazie, sono alla mio barca!» Offensichtlich verstand er, ich wollte zum Boot. Er hob den Arm und stieß ein Wort hervor, das ich hier nie erwartet hätte: «Okay.» Nur «Okay» krächzte er, sonst nichts. Ich wandte mich zum Gehen, als er mich wie ein abfahrendes Taxi anhielt. «Stopp!», rief er, und: «Signore, torni fra dodici minuti!» Das Wörtchen «dodici» kannte ich von einem Restaurantbesuch in Verona, als das Restaurant «Dodici Apostoli» noch seinen guten Ruf verdiente. Ich ahnte, dass mir eine kulinarische Premiere bevorstand, rief meinerseits «Okay!».
An der Kaimauer brachte ich die Innereien meines Boots in Ordnung, kramte das Zelt heraus, bog die Stäbe und zog die Zeltfolie darüber. Die Luftmatratze wurde aufgeblasen. Hier wollte ich noch in Frieden die Nacht verbringen, bevor ich mich der von Wassertaxis aufgewühlten See des Giudecca-Kanals aussetzte. Wer jemals Venedig mit einem Hobbyboot zu kapern versucht hat, der weiß, mit welchem Jauchzen und Feixen die Macho-Capitani den friedlichen Kanuten aus seiner Nussschale kippen wollen. Da ist es besser, man wirft sich gut ausgeschlafen ins Getümmel. Ich richtete alles für den Abend her, und auch das wichtigste Utensil, zwei Flaschen Weißwein, stellte ich parat. Mit einer davon trabte ich zum Artischockenkoch hinüber.
Er grinste. Auf dem Tisch stand eine Sprudelflasche, aus der grüngelbes Olivenöl funkelte. Eine kleine Tüte mit Salz lehnte dran, und zwei einigermaßen sauber geriebene Blumentopf-Unterteller sollten wohl die Teller sein. Der Mann hatte Stil. Eine verrostete Blechdose stand auch da. Wozu die wohl dienen mochte? Ich befand mich in einem Elysium der Gastlichkeit und freute mich, die Weinflasche mitgenommen zu haben. Mächtig stolz präsentierte ich einen Pinot grigio. Nichts Edles, sondern an einer Tankstelle bei Padua zugeladen. Es war ein Wunder, dass ich bis dorthin keinen Strafzettel bekommen hatte, denn ich fuhr mit meinem Kanu auf dem Dach weit über den erlaubten hundert Kilometern pro Stunde, um nicht zu gestehen, immer so um die hundertachtzig.
Auf der Insel lebte es sich geruhsamer. Der Alte stocherte im verglühenden Holz, klemmte zwischen zwei Holzstecken einen schwarz verrußten Aluklumpen und balancierte ihn auf die Holzbretter vor mir. Ich entwand ihm mit hilfreicher Geste die krummen Äste und setzte die Schatzsuche in der Glut fort. Ein Päckchen ums andere kam auf den Tisch. Signor Poveglia stakte zum Holzschuppen und kam mit zwei Marmeladengläsern in der Hand zurück: Der Buongustaio trinkt nicht aus der Pulle. Mit etwas Zeitungspapier rieb er die beiden Gläser aus. Sie blieben matt und schillerten antik, als handelte es sich um einen altrömischen Nachlass.
«Sono Carlo!» Man kam sich näher. «Sono Vincenzo!» Um meine Begeisterung kundzutun, schnitt ich Grimassen der Wollust und verfluchte meine Faulheit, die mich am Italienischlernen gehindert hatte. Aus einer Plastiktüte war ein Kanten Brot gezaubert worden, und in die Blechdose goss Carlo fingerhoch Olivenöl. Ein Blatt ums andere zog ich aus der Frucht, tunkte es ins Öl, streute ein bisschen Salz drauf, schob das löffelartige Grünzeug in den Mund und zog mit zusammengedrückten Zähnen das Fruchtfleisch ab. Der Artischockenkoch hatte seine Sache gut gemacht, alle Zutaten waren von erster Güte. Für meinen Tankstellenwein schämte ich mich ein bisschen.
Bei einem Kochwettbewerb in Manhattan wäre Artischocken-Carlo sehr gut angekommen. Alle Gourmet-Zeitschriften, aber auch viele Soziologen besingen momentan als wichtigste Kriterien des Essens Echtheit und Exotik. «Essen muss authentisch sein, handwerklich hergestellt, nahe der Natur und ohne die Deformationen experimentierfreudiger Köche.» So oder ähnlich klingt das dann. Bill Bufords «Hitze» ist zu entnehmen, gutes Essen sei mit bestimmten Orten verbunden. Salz muss aus dem Himalaya kommen, das Öl aus einem ganz bestimmten Hain und das Fleisch von einer Kuh namens Martha. Davon wusste Carlo nicht das Geringste. Wir blickten schräg durch die Bäume, ein letztes Blinzeln der Sonne legt sich auf uns. Wir tranken und aßen still. Es begann zu dämmern, und unversehens hörte ich sie. Ja, es war geradezu lärmend: die Vögel sangen wieder.
Barrique im Remstal
Anfang der achtziger Jahre backte ich in meiner Küche im «Postillion» in Schwäbisch Gmünd unablässig aromaheftige Pasteten – eine Obsession, die bis heute angehalten hat. Für diese Krustenpasteten suchte ich einen Weißwein, der sich nicht beim ersten Schluck von der Pastetenscheibe begraben ließ. Kräftige, tanninreiche Weine waren damals jede Menge zu haben. Allerdings kamen die überwiegend aus Frankreich und Italien. In Deutschland hatte man Angst vor zu viel Säure und begegnete diesem Umstand gerne mit Zucker. Der herbe Nachhall, den Tannine und Gerbstoffe spenden, fand beim breiten Publikum kaum Gefallen. Dennoch benötigte die zusehends aufstrebende Küche zum Essen auch Weißweine mit dieser Art Widerstand und geschmacklicher Festigkeit. Ich beschloss, selbst solch einen Wein zu keltern, und suchte mir einen risikofreudigen Winzer dazu.
Alle meine Entscheidungen treffe ich bevorzugt mit meinem Instinkt. Neudeutsch nennt man das gerne Bauchgefühl, obwohl mein Bauch eigentlich gar nicht fühlt, sondern denkt. Ich glaube fest, dass mein Gehirn dort beheimatet ist. Naturwissenschaftlich beschlagene Leute und Anhänger des Darwinismus werden mir bestätigen, dass wir vom Einzeller abstammen. Dieser Vorfahr hatte sein Gehirn im Bauch. Damit ist er die letzten Millionen Jahre gut gefahren. Das Reich der alten Ägypter und das der Römer ist untergegangen, die Einzeller sind immer noch voll da. Und da mein Bauch ungefähr drei Millionen Mal größer ist als der Bauch dieser Tierchen, bin ich auch Millionen Mal besser beieinander.
Aus diesem Bauchgefühl heraus entschied ich mich also eines Tages anno 1983 beim Winzer Jürgen Ellwanger anzufragen. Ebenso wie ich stammt er aus dem Remstal, das von Osten kommend auf die Hauptstadt Stuttgart zuläuft. In diesem Tal leben «rechte Leut», was sie gerne auch unter Beweis stellen. Ellwanger ist von solchem Holz. Mit ihm wollte ich einen Barriquewein herstellen, also einen Wein aus dem Holzfass. Die Idee konnte eigentlich gar nicht schiefgehen, denn im französischen Wort Barrique steckt schon rein gefühlsmäßig genau die Knarzigkeit, die von diesem Winzer mit seinem wettergegerbten Gesicht ausgeht.
So zuckelte ich in meinem VW Variant von Schwäbisch Gmünd das Remstal hinab, um Ellwanger für meinen Plan zu gewinnen. Auf halbem Wege reckte sich der Turm des Klosters Lorch aus dem hohen Grün der Bäume. Jedes Mal, wenn mir dieses Gemäuer oberhalb der Ortschaft Lorch vors Auge kommt, summt es wohlig in meinem Inneren. Ich nahm die nächste Abfahrt, der Winzer konnte warten. Beherzt trieb ich den alten VW den Klosterberg hinauf. Oben angekommen, verstellte mir der Nachbau eines römischen Wachturms den Blick auf den Hohenstaufen, den Kaiserberg unweit des Tals. In meiner Kindheit hatte ich ihn auf dem täglichen Schulweg stets vor Augen gehabt. Erst als ich aus dem Schatten des Turms heraustrat, war die Sicht nach Süden frei, auch auf die beiden anderen Kaiserberge Rechberg und Stuifen. Gegen Osten konnte man fast bis Schwäbisch Gmünd sehen. Bei der Wahl des Baugrundes für die Abtei hatten die Altvordern offensichtlich ihren Sinn für magische Orte gepflegt: Ich stand auf einem Fleckchen Erde, das Kraft gibt. Und glaubt mir, Leute, ich bin kein Esoteriker. Schon die Römer wussten, warum sie gerade hier ihren Wachturm hinstellten.
Man befindet sich auf ehemals römischem Gebiet direkt unterhalb des Limes. Diese Demarkationslinie gibt mir immer wieder die schöne Illusion, mich nicht nur in südlichen Gefilden zu befinden, sondern mit meinen Vorfahren, den Hohenstaufen, sehr dem Italienischen verbunden zu sein. Lorch fungierte als Hauskloster der Staufer. Am Abhang zum Remstal ruhend, bewahrt eine gewaltige Mauer die Abtei davor, in die Tiefe zu rutschen. Diese Einfassung entlang zieht sich ein reich bestückter Klostergarten, der nichts vermissen lässt, was die mittelalterlichen Mönche an Kräutern benötigten. In kleinen Beeten findet man Rosmarin, Thymian, Fenchel, Anis und so weiter, also alles, was die Küche bis heute dermaßen befeuert, dass sich mancher Gang zum Arzt erübrigt. Denn Küche und Apotheke gehören von alters her zusammen, und beide äußern ihr Wissen durch Rezepte. So säumen sich an die Küchenkräuter, zu denen auch Liebstöckel, Schnittlauch oder Petersilie zählen, nahtlos die Heilkräuter, wie Wein- und Eberraute, Baldrian und Johanniskraut.
Über flache Steinstufen führt ein Kiesweg zur romanischen Kirche, in der Irene von Byzanz, die Schwiegertochter Kaiser Barbarossas und Patronin des Gartens, des Klosters und der Gegend, ihre letzte Ruhe gefunden hat. Diese Frau hat bis heute einen Fanclub. Dabei erlebte sie kein leichtes Dasein. In Konstantinopel als Tochter des byzantinischen Kaisers geboren, musste sie 1193 der Staatsräson wegen im Alter von nur vierzehn Jahren den sizilianischen Normannenkönig Roger III. ehelichen, der betrüblicherweise kurz nach der Heirat starb. Alsbald brachen die Staufer in die normannische Idylle ein und verschleppten die Frau als Gefangene auf die Burg Schweinhausen bei Biberach/Riss. Dort lernte sie Herzog Philipp von Schwaben kennen und lieben, den jüngsten Sohn des legendären Kaisers Friedrich Barbarossa. Es wurde geheiratet. Irene amtete nun als deutsche Königin und machte offensichtlich ihre Sache so gut, dass der Minnesänger Walther von der Vogelweide ihr Lobgesänge zueignete: «Anmutigste aller deutschen Königinnen», schwärmte der Poet in dem Gedicht «Rose ohne Dornen, Taube ohne Gallen».
Ungeachtet dessen, dass Tauben sowieso keine Galle haben (hier spricht der Koch), ging es um die Darstellung ihrer Sanftmut, die in diesen Kriegszeiten ungewöhnlich war. Der zehnjährige Bürgerkrieg zwischen Staufern und Welfen zog damals eine üble Blutspur durchs Deutsche Reich. Als das überstanden schien, fiel der Gemahl am 21. Juni 1208 in Bamberg einem Mord zum Opfer – der erste Königsmord auf deutschem Boden. Die hochschwangere Königin floh auf den Hohenstaufen. Der Rest ist schnell erzählt, Irenes lebenslange Pechsträhne kam zum Höhepunkt. Sie starb mit nur achtundzwanzig Jahren bei der Geburt ihres Kindes, und mit diesem vereint fand sie in der Klosterkirche Lorch ihre letzte Ruhe.
Es war Zeit zu gehen. Das Kloster hinter mir lassend, griff ich von einem windschiefen Apfelbaum eine rote Gewürzluike. Lange halte ich es nirgends aus, und Neugierde dürfte die stärkste Triebfeder dieser Unruhe sein. Kurzerhand schwang ich mich in mein Auto und steuerte unter dem Lärmen und hubschrauberartigen Pfeifen des luftgekühlten VW-Motors zur B 29 zurück. Auf diesem kurvenreichen Band strebte ich der Wärme des langsam tiefer und breiter sich weitenden Tals entgegen. Immer auf diesen Wegen kommt es mir vor, als hellte sich der Himmel auf. Es mag daran liegen, dass nun bald die Klimazone des Weinbaus beginnt. Keine Frage, wo Wein wächst, da kann man sich getrost niederlassen. Nichts gegen meine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd, die im oberen Tal, also dem kälteren Abschnitt siedelt. Sie hat mich wie nichts anderes geprägt, und einen Großteil meines frohen Wesens verdanke ich ihr. Aber hier im unteren Tal addiert sich zum Heimatgefühl noch etwas anderes: Die Landschaft ist lieblicher, und die Ergebnisse des Weinbaus sind für mich gelebter und wohlig einzuverleibender Humanismus.
Dort ist gut sein, und als ich schließlich in Winterbach beim Weingut Ellwanger eintraf, machte sich eine gewisse Euphorie breit. Meine Turnschuhe knirschten über den Hof. Der Winzer, ein echter schwäbischer Schaffer, begrüßte mich, wir kannten uns bereits. Als er mir die Hand gab, schrammte ich mir an seinen Pfoten fast meine küchendampfverwöhnten Hände auf. Ich hatte ihn bereits vorgewarnt, jetzt wurde ich konkret: «Jürgen, du machsch einen sauguten Wein. I denk, dass du dich mal an einem Barriquewein versuchen solltest.» Jürgen, in seiner bedächtigen Art, ließ sich viel Zeit mit der Antwort. Leise zögernd, ja fast im Rückwärtsgang erwiderte er: «Also, Vincent, des macht man eigentlich nur mit Rotwein. Allerdings, der Franz Keller hat jetzt auch beim Weißwein diese Franzosenmethode angewandt.» Keller, der berühmte Gastronom und Winzer vom «Schwarzen Adler» – eines meiner Vorbilder –, hatte als Erster deutsche Weine in Barriquefässer gelegt. Jürgen hielt inne und fuhr dann aber mit festerer Stimme fort: «Ha, wir könnten mal ein Fässle ausprobiere, auch wenn’s schiefgeht, wird das bestimmt kein Flurschaden.»
Ich war ja noch ein junger Spund und geriet in freudiges Hüpfen. «Also, wo kriegt man so ein Fass her?» Jürgen befahl mir, auf die Schwäbische Alb nach Mössingen zu fahren und dort beim Fassmacher Schanz so einen «Holzhurgel» zu holen. Nach vierzehn Tagen war das Fass aus schwäbischer Eiche zusammengesetzt. Ich lenkte meinen VW-Kombi wieder nach Mössingen und lud das Prachtstück ein, für das dem Fassmacher ungefähr dreihundert Mark in die Hand gedrückt wurden.