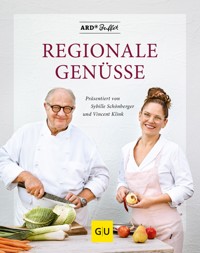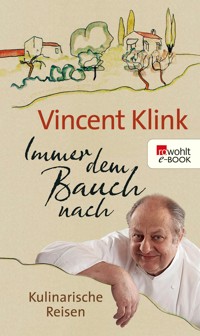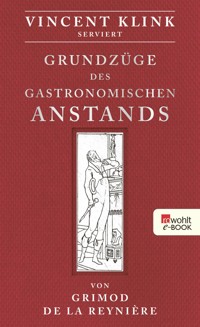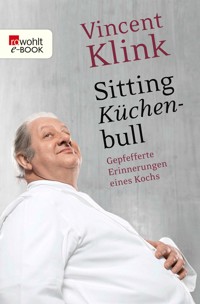
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie bringt man es zum Spitzenkoch? Und ist dessen Berufsalltag wirklich so glamourös? Vincent Klink erzählt von seinem Leben als einer Schule des Geschmacks, durch die er gegangen ist. Speisen und Gerüche einer schwäbischen Kindheit werden lebendig, wenn er von seinem Vater berichtet, einem Landtierarzt, der sich von den Bauern immer auch in Naturalien bezahlen ließ; oder von Hausschlachtungen und der Völlerei bei Familienfeiern. Er gibt Einblicke hinter die Kulissen deutscher Gourmetrestaurants, berichtet von seinen Lehrjahren bei despotischen Küchenchefs, von blasierten Kellnern, saufenden Köchen und Gästen mit gutsherrlicher Attitüde. Zugleich schildert Klink die Wandlungen der deutschen Esskultur, von der kargen Nachkriegskost über die «Schmerbauchära» bis zu den Kochmoden unserer Zeit. Sitting Küchenbull ist gleichermaßen lebenspralles Erinnerungsbuch wie launige Auseinandersetzung mit der hiesigen Küche. Klink schreibt sinnlich, humorvoll, wortgewaltig – und beweist: Der Künstler am Herd ist auch ein Meister der Feder. «Lebensfreude pur – ein Buch, das Tonnen literarischen Junks aufwiegt.» Denis Scheck «Der Mann schreibt so saftig und elegant, wie er seine Sterne-Küche zubereitet.» Spiegel online «Mehr davon – wir sind unersättlich!» NDR Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Vincent Klink
Sitting Küchenbull
Gepfefferte Erinnerungen eines Kochs
Sitting Küchenbull
I’m gonna sing: hey Zwiebelring,
auch du, my little chicken wing,
swing her zu mir, zu Mutter.
I wanna shout out Sauerkraut,
yeah, shout it loud and shout it proud:
Ich spare nicht mit Butter.
Cry me a river Spiegelei
auf einem Berg Kartoffelbrei
I do it mit Spinat.
Yes, I will croon the Freilandhuhn,
vom white wine ist es schon ganz duhn
und innendrin sehr zart.
Mein Lieblingsduft heißt Rotweinhauch
I’ll never need no Waschbrettbauch,
ich stemme keine Hantel.
Ich steh am Eigenherd und brat’,
I’m gonna fart the Zwiebeltarte
im coolen Schinkenmantel.
Hoch in der Gunst steht Bratendunst.
Was ist die wichtigere Kunst,
das Kochen oder’s Singen?
Dies ist mein erstes Menschenright:
I’m gonna fight for Essenszeit! - - -
Man mag den Nachtisch bringen.
Wiglaf Droste
Vorspiel
Neunzehnhundertneunundvierzig, in der Tat ein Spitzenjahrgang, und meine Geburt war auch ein Donnerschlag. Kaum war Mama auf den Beinen, wurden alle Freunde eingeladen, und eine Bowle sollte den neuen Erdenbürger angemessen feiern. Wein wurde mit Sprudel vermischt, und Zitronenscheiben dazugeworfen. Die erste Weinbuddel war okay, die anderen beiden Flaschen sahen genauso aus, aber sie enthielten Birnenschnaps. Wie mir berichtet wurde, geriet die Feier sehr temperamentvoll. Die Insassen des Narrenschiffs waren alle dermaßen blau, dass man das Baby vergaß. Ich lag mit vollen Windeln einsam in meinem Kinderzimmer und erbrütete mir den ersten Psychoschaden.
Landluft
Es roch nach Kuhstall. Überall lag der Geruch der Tiere in der Luft, eigentlich begleitete er meine ganze Jugend. Papa, von Beruf Tierarzt, roch auch so. Er war ein Riese und stolz darauf, wie ein Römer auszusehen: große Nase, festes Kinn, langer schmaler Riesenschädel. Und immer trug er kurze weiße Hemden. Nicht damit man seine Muskeln bewundern konnte, nein, seine Oberarme mussten frei sein, denn so richtig zu Hause waren sie tief im Unterleib der Kühe, denen er an den Eierstöcken herumspielte. «Künstliche Besamung ist prima, aber die Kuh muss trotzdem Lust verspüren!» Deshalb lehnte er Gummihandschuhe ab: «Mit dene Dinger han i koi Gfühl!» Seine Geburtenzahlen waren beim Oberveterinäramt legendär.
Papa war nicht rund und weich, sondern dick und fest. Für den abgemagerten Sohn geradezu ein Gigant. Immer wieder dachte ich, vor ihm hätte sogar Obelix Angst gekriegt. Wer schafft es schon, an einem neuen Mercedes Diesel den Schaltknüppel abzureißen? Ein andermal fehlte inmitten eines hektischen Verkehrsmanövers unversehens ein Stück des Lenkrads. Seine schwäbischen Bauern mochten das Ungestüme und auch seine direkte und praktische Art. So war der Tierarzt sogar bei den Bäuerinnen Hahn im Korb, denn nach den Schweinen und Kühen verarztete er sie gleich mit, half mit Salben gegen aufgerissene Hände und hatte selbst gegen schlimmere Malaisen immer ein Mittelchen parat.
Seine Schule des Lebens war der Krieg gewesen, betonte er immer wieder. Wenn er vom Krieg und seinen Bravourstückchen erzählte, konnte ich gar nicht begreifen, wie man den hatte verlieren können. «Da war sicher Beschiss im Spiel», dachte ich, besonders nach der Lektüre der Landser-Heftchen, die ich damals sehr liebte. Von heute aus gesehen schilderten sie bestenfalls romanhaften Soldatenscheiß, wenn nicht gar Lug und Trug. Manchmal erging ich mich lauthals über die von mir verehrten Panzerfahrer und sonstige Recken, und Papa hatte dem nichts zu entgegnen. Ich ahnte bereits, dass er sich nichts mehr wünschte, als dass ich mich auch einmal zu so einem hünenhaften Helden auswachsen würde.
Es war noch früh am Morgen. Ich war sieben Jahre alt, hatte Ferien und befand mich wie so häufig mit Papa auf Tournee. Er liebte es, einen Beifahrer an seiner Seite zu haben. Für mich war die Fahrt auf die Bauernhöfe immer ein kleines Abenteuer. Schon an der Hofauffahrt wurde das Starktonhorn, das ursprünglich von einem Sattelschlepper stammte, nachhaltig betätigt. Es machte infernalischen Lärm und sollte die Bauern vom Feld oder aus entlegenen Winkeln des Gehöfts herbeizitieren. Sofort war die Bäuerin zur Stelle. Der Veterinär schrie nach Seife– Wasser– Handtuch, und die Frau flitzte los, denn die künstliche Besamung war eine schnelle Verrichtung.
Aus einem Tiefkühlbehälter zog Papa ein Samenröhrchen und befestigte es am Ende eines langen Metallstabs. Dieses nahm er schützend in seine Faust und cremte sie, wie auch den ganzen rechten Arm, mit Vaseline ein. Dann versenkte er sie langsam, fast zärtlich mitsamt dem Stab ins Hinterteil der Kuh. Oft sagte er: «Weischt, eigentlich wird die Kuh um etwas Schönes betrogen, deshalb versuch ich, dem Tier so viel Spaß wie möglich zu geben, denn eindeutig, sie nimmt dann viel besser auf.»
Papa steckte bis zur Achsel in dem Vieh, der Metallstab reichte ihm fast bis an die Schulter. Er drehte den Arm, als wolle er tief im Inneren eine Schraube eindrehen. Diese Bewegung diente dazu, durch den Muttermund in die Gebärmutter zu gelangen. War das Ende des Stabs mit der Samenpatrone dort richtig platziert, zog er den Arm heraus, ließ den Stab jedoch drin. Nun drückte er fest auf dessen herausragendes Ende, wodurch in der Kuh die Samenpatrone aufplatzte – eine künstliche Ejakulation. Der Stab wurde nach dieser Verrichtung schnell aus dem Hinterteil der Kuh gezogen, und die Waschungen des Tierarztes begannen.
Dann kam der gemütliche Teil. Die Bäuerin ging voraus zur Küche und Vater mit wehendem weißem Arztkittel zügig hinterher. Die Nähe einer Küche beschleunigte stets seinen Puls. Im Haus angelangt, ließ er sich auf einen Stuhl krachen, und ich nahm mir ebenfalls einen. Die Lehne wurde von einem geschnitzten Steg zusammengehalten, auf dem als abgeschabtes Relief eine Sonne zu erkennen war. Alles wirkte etwas verschrammt, auch der ganze mit Ölfarbe gestrichene Raum, den in Augenhöhe ein Band dunkelgrüner Ziermalerei säumte. Hier war schon lange nicht mehr gestrichen worden, dafür aber exzessiv geschrubbt, sodass es weder an der Ecke zum Flur noch an Stuhl und Tisch mehr scharfe Kanten gab.
Papa war der Mittelpunkt des Geschehens. Sein beträchtlicher Ranzen stand vor wie ein Bergrücken, er hätte darauf bequem das Glas Most abstellen können, das die Bäuerin ihm reichte. «Net irgendein Moscht», erklärte sie. Papa hielt das ehemalige Senfglas gegen das Licht. Es war randvoll, kleine Bläschen stiegen auf. «Bieramoscht, der isch no ganz frisch ond bizzelt no!» Sie schrie fast, aber das war ich schon gewohnt. Die Bauern schrien andauernd. Es mochte davon kommen, dass sie zwar meist alles andere als reich waren, aber ein freies Leben ohne Nachbarn führten. Auf den Gehöften musste man sich oft um Ecken herum unterhalten, gegen das Kuhgebrüll ankämpfen oder auf weiten Wiesen und Feldern die Verbindung zueinander aufrechterhalten.
Viel zu hektisch setzte sich Papa das Glas an den Mund, und ein Schwall Most schwappte auf den Tisch. Mit dem Ärmel des Kittels wischte er die Lache auf und polierte, gedankenverloren hin und her rubbelnd, die Eichenplatte. Dann nippte er an der klaren Flüssigkeit, denn bei Birnenmost ist Vorsicht geboten, man kann sich Verätzungen zuziehen. Papa zog keine Grimasse wie so oft, war unversehens wieder voll da, und spreizte den Ellenbogen ab, als wolle er das Behältnis mit einem Militärgruß beehren. So war es aber nicht, er brachte sich lediglich in eine günstige Einschüttposition und sog den Most in sich hinein wie ein Verdurstender. Das leere Glas stellte er mit Wucht auf den Tisch zurück.
Die Bäuerin kannte den Veterinär allzu gut und schenkte mit dem Krug schon wieder hurtig nach. Mich hatte sie jetzt offensichtlich auch bemerkt, auf dem Weg zum Spülstein renkte sie den Kopf und rief über die Schulter: «Du magsch sicher einen Quittensaft.» Sie ging hinaus in den Flur und kam mit einer Weinflasche zurück, die mit einer roten Gummikappe verschlossen war. Sie zerrte daran, ohne den Verschluss abzukriegen. «Gib her», knurrte der Arzt. Er riss und zog, sein Gesicht lief rot an, und unter seinem starken Schnaufen zerbröselte die Gummikappe. «Sag mal, » ächzte er die Überreste an, «sag mal, isch ja ein steinaltes Cuvee, hat die Quitten noch der Hauptmann von Kapharnaum geerntet?»
Die Bäuerin guckte zu ihm herüber und dachte sicher: «Von was schwätzt der eigentlich?» Sie gab etwas Saft in ein weiteres Senfglas, drehte den Wasserhahn auf und verdünnte mit Wasser. Mir schmeckte das Gemisch, wenn auch nicht so gut wie Sinalco, diese neu erfundene Orangenlimonade, die bei Ausflügen manchmal spendiert wurde. Vielleicht war die Limo aber nur deshalb so toll, weil ich sie mit meinem älteren Bruder teilen musste. Werner war stärker und nahm sich immer mehr, als ihm zustand. Egal, jetzt war ich solo, und Quittensaft gab’s genügend. Die Bäuerin wagte nicht, sich zu dem Most trinkenden Koloss zu setzen. Sie schaute ihn an wie ein Blindenhund das Herrchen, während der mit seiner großen Nase tief im Glas steckte. Seine roten Backen hatten zu glühen begonnen, und sein Grübchen am Kinn teilte das Gesicht bedeutungsvoll.
Nun saßen wir entspannt auf unseren Stühlen. Der künstliche Besamer schob seinen Hut «auf Durst», wie er das nannte, also in den Nacken, und streckte der Bäuerin wieder sein Glas hin. Papa trug einen komischen Trachtenhut, den er nicht zu Unrecht Speckdeckel nannte. Auf Tournee zu den Bauern nahm er ihn nie ab, denn von den feuchten Balkendecken der Kuh- und Schweineställe segelte so allerhand herab.
Die Bäuerin war viel jünger als mein Vater und hatte ein langes Gesicht. Ihre Haare waren hochgesteckt, Strähnen ragten aus diesem Gewölle, als wolle es gerade explodieren. Auf mich wirkte sie so richtig energiegeladen: «Mit der möchte ich auch keinen Streit haben», dachte ich. Inzwischen hatte sie Blut- und Leberwürste auf ein Holzbrett gelegt, schenkte das Glas wieder voll und nahm einen riesigen Brotlaib in den Arm. Mit der linken Hand klemmte sie ihn unter den beträchtlichen Busen, mit der rechten säbelte sie in hohem Bogen hindurch. Oh. Es sah aus, als wolle sie sich ins Herz stechen. Die Brotscheibe war an der Rinde ungefähr einen Zentimeter dick, am anderen Ende lief sie flach aus. Mit einem Klack fiel sie auf den Tisch. Das Messer ruckte wieder in die Nähe des Herzens, und die gefährliche Übung wurde mit beiläufiger Behändigkeit wiederholt. Dann beugte sich die Frau über das Waschbecken und klopfte sich die Krümel von der gepunkteten Kittelschürze. Diese war sicher schon tausendmal gewaschen und oft geflickt worden, aber sauber und vom mehligen Blau eines fahlen Morgenhimmels.
Die Wurst roch verführerisch nach Majoran und ein klein wenig nach Verwesung, ein Hautgout, den man von Kutteln kennt oder dem Innenleben einer Sau. Dazu kamen das Aroma des Stalls von nebenan und eine gewisse Würze von Scheuerpulver. Die Bäuerin selbst wirkte wie mit frischer Luft abgerieben und so hell geschrubbt wie die Eichenbretter des Küchentischs. Vater schaute sich eine Blutwurstscheibe genau an. «Die Fettbröcklein habt ihr präzis geschnitten. Gut gewürzt, Kompliment. Am Piment habt ihr nicht gespart.» Die Bäuerin hantierte in der Küche, stellte einen großen Topf mit Wasser aufs Feuer. «Ja, die Gewürze, die mahlen wir in einer alten Kaffeemühle.» Sie deutete in Richtung eines Küchenregals. So eine Mühle hatten wir auch, «Zassenhaus» stand darauf, das weiß ich heute noch.
Der Vater wurde unruhig: «Fertig mit Vesper, Bub, wir müssen weiter.» Die Bäuerin hatte gerade einen großen Brocken Rindfleisch in der Hand, den sie im fast kochenden Wasser versenkte. «Siedfleisch will der Mann, wenn er vom Feld zurück isch!», und ohne Atem zu holen, schaute sie meinen Vater an: «Wie viel?» – «Gibsch mir einen Zehner und vier Würste.»
Während der Nachhausefahrt auf Schwäbisch Gmünd zu, wo wir als alteingesessene Familie sozusagen zu den Upper-Class-Aborigines gehörten, predigte Papa, wie er das von Opa gelernt hatte. Der war nämlich Lehrer. Von früh bis spät hatte ich meinen Altvordern geduldig zuzuhören, was mir schwer auf die Nerven ging. Die Stentorstimme von Papa Alfred drang sogar in meinen abgeschalteten Kopf und sickerte ins Unterbewusstsein. Deshalb kann ich immer noch genau nacherzählen, was ich des Tierarztes Siedfleisch-Vorlesung nennen möchte.
«Wenn es um gekochtes Fleisch geht, muss man sich zweierlei merken: Will man gute Brühe oder gutes Fleisch? Kocht man nur Knochen aus, dann möglichst die Brustkernknochen vom Rind, diese enthalten am meisten Geschmack, oft mehr als das Fleisch. Werden also die Knochen ausgekocht, werfen wir sie in kaltes Wasser, und mit dem Erwärmen der Flüssigkeit werden alle Inhaltsstoffe aus den Gebeinen gesogen. Beim Siedfleisch will man genau das nicht, dort soll die Kraft im Fleisch bleiben. Deshalb das Wasser zum Sieden bringen und erst dann das Fleisch dazu. Die Hitze des Wassers lässt das Eiweiß des äußeren Fleischs sofort gerinnen, und das dämmt das Austreten von Fleischsaft ein. Die Hitze dringt immer weiter vor, und alle Säfte des Fleischs, die ja großteils aus Eiweiß bestehen, verdichten sich, gerinnen und halten so den Fleischbrocken saftig. Wir geben nur wenig Salz ins Kochwasser, denn die Garzeit beträgt sicherlich an die zwei Stunden. Wasser verdunstet dabei, und es wird sowieso alles salziger. Nicht alles Eiweiß bleibt im Fleisch, es tritt auch aus und steigt als Schaum auf. Wenn davon nichts untersprudelt, wir also die Brühe nur sanft am Köcheln halten, uns die Flüssigkeit entgegenlächelt, dann können wir den Schaum mit einem Löffel abheben, und die Brühe bleibt klar. Unter einer Stunde läuft bei Siedfleisch eh nichts!
He! Hörst du mir überhaupt zu? Verdammt, da quassle ich mir die Seele aus dem Leib, und der Spitz schläft ein. Vinzle, soll ich dir was sage? Du kannsch’s dir raussuche: Dumm auf d’ Welt komme, nix dazug’lernt und d’ Hälfte vergessa! So läuft’s bei dir!»
Ich verharrte still, denn diese Beurteilung meiner Geisteskräfte hatte ich schon tausendmal gehört. Die Lamentos des Alten verursachten bei mir keinen Minderwertigkeitskomplex mehr. Ich wusste, Papa war ein fleischgewordener Vulkanausbruch, er entlud sich mit Wucht, und wenig später war er wieder ausgeglichen, und nichts erinnerte mehr daran. Die langsam verglühende und ewig warme Lava des Nachtragens und der Aufrechnung, die gab es bei ihm nicht. Wenn er mir eine reinhaute, konnte es sein, dass er nach fünf Minuten zornrot fragte, warum ich beleidigt sei. Sagte ich dann: «Ehhh, ich kriege eine Backpfeife und jede Menge Geschrei an den Schädel und soll auch noch applaudieren?», grunzte er nur: «Verdammt Büble, man wird ja noch gutgemeinte Hinweise geben dürfen.»
Zu Siedfleisch wusste er einiges zu berichten: «Die Österreicher, die haben’s richtig drauf. Die hält man gemeinhin für blöd, aber bei allen diffamierten Volksstämmen, den Ostfriesen, Sachsen, den dummen Hessen und bei den oft gehänselten Schwaben ist es gleich: allesamt topfit. Die Hochdeutschsprechenden sind nur neidisch. Egal wie, die Österreicher sind genial, na ja, nicht alle, Deppen gibt’s überall, aber was das Essen angeht, da sind sie konkurrenzlos. Die haben sicher dreißig bis vierzig Varianten von Siedfleisch. Weißt Bub, die sind faul, und nur wer faul ist, lässt sich etwas Fortschrittliches einfallen. Siedfeisch verspritzt die Küche nicht, keine Fettdünste, es dümpelt ohne Lärm und Aufsicht vor sich hin, gibt gutes Fleisch und prima Brühe. Kalt kann man es essen, wie Aufschnitt, warm oder halbwarm, sogar als Vorspeise oder als Fleischsalat.»
Ich dachte mir, dann sei Mama also auch faul, denn Siedfleisch gab es mindestens einmal in der Woche. Es war immer am Samstagmittag an der Reihe, denn der Sonntag war ohne Flädlesuppe oder Markklößchensuppe kaum denkbar. Überhaupt, kamen die kürzeren und kälteren Nächte, wurden die Tage mit immer mehr Suppe befeuert: Grünkernsuppe, Brennsuppe, die nur mit braungeröstetem Schweineschmalz gemacht wurde, oder Riebelessuppe, das waren kleine Fitzel aus Nudelteig, in Bouillon gekocht. Für alles brauchte man Fleischbrühe als Grundlage. Ohne gekochtes Fleisch kam man nicht durch die Woche und schon gar nicht durch das Jahr.
Vom Segen der Vertriebenen
Anfang der fünfziger Jahre beschränkte sich unser Wissen über exotisches Essen auf die Erzählungen meines Vaters, der weit gereist war. Er hatte kein Reisebüro beanspruchen müssen, um Abenteuer zu erleben. Sein größtes Erlebnis war die Zeit der Feldzüge im Namen des Führers. Er war in Finnland, später in Norwegen bei einer österreichischen Gebirgsjägereinheit stationiert gewesen. Der gelang es, selbst im totalen Krieg bis auf einige Partisanen keine Feinde zu finden. Dafür war die Truppe sensationell verfressen. Die Österreicher waren mitten im totalen Krieg eine Insel des Pazifismus.
Papa als Militärveterinär unterstanden einige tausend Pferde, obwohl er sein Studium noch gar nicht beendet hatte. Die vielen Panzer, mit denen damals in den Wochenschauen geprotzt wurde, schufen ein ziemlich falsches Bild. Im Grunde war man gegen Russland nicht viel besser ausgerüstet als einst Napoleon: Pferde, Mulis und Esel zogen die Kanonen. Papas Kompanie musste die Tiere aufpäppeln, um sie in Richtung Leningrad wieder in den Einsatz zu schicken. Die dicksten Viecher aber, die Österreicher sind ja nicht blöd, wurden der Feldküche überstellt und einer edleren Bestimmung zugeführt (es gibt nichts Besseres als fettes Eselsfleisch). Die Aufsicht über die Köche oblag ebenfalls Papa. Er war damals schon ein fanatischer Hobbykoch und blieb es sein Leben lang. Seine Geschichten waren eine endlose Perlenkette traumhafter Schlemmereien: Pferdefilet in Hennessy-Cognac-Soße, Eselsgulasch, Fohlenkotelett und Würste in der Art von Salami wurden fabriziert.
In Norwegen lagen riesige Nachschublager, mit denen man später über das Nordkap die Wehrmacht versorgen wollte, um Russland vom Polarkreis aus fertigzumachen. Das sollte alles gründlich schiefgehen, was den österreichischen Militärs damals schon klar war. Im Lager meines Vaters gab es so viel belgischen Schinken in Dosen, dass man damit hätte Barrikaden bauen können, französischen Cognac, ja selbst Champagner in rauen Mengen. Während des Rückzugs, der Krieg war so gut wie beendet, bestand ein Lagerverwalter auf der Dienstvorschrift und weigerte sich, Speck oder Schinken rauszurücken. «Den Deppen haben wir kurzerhand erschossen!», sagte Vater lapidar. Später erfuhr ich zu meiner Erleichterung, dass nicht er der Täter gewesen war. Im Übrigen erinnerten seine Erzählungen schwer an diejenigen des Barons Münchhausen. Bruder Werner und ich waren natürlich fasziniert.
Von solchen Exzessen abgesehen, waren die Kriegsjahre eine Zeit des Mangels und prägten die Generation meines Vaters fürs Leben. Deshalb wurde bei uns zu Hause die erste Wochenhälfte lang der Sonntagsschmaus immer wieder aufgewärmt. Wenn alles zum wiederholten Male rezykliert worden war, schlug die Stunde von Papas berühmtem Krautsbraten: Hackfleisch, oft aus Mikroskopierproben vom Schlachthof oder aus altem Braten zusammenkomponiert, wurde mit Gemüseresten zwangsvereinigt – das Gericht erübrigte eine Biotonne.
Alle Altlasten bekamen eine kräftige Ladung Pfeffer, Paprika und oft Majoran verabreicht. Es musste halt so viel Gewürz dran, dass niemand das Alter der Bestandteile schmeckte. Sauerkraut war neben den Gewürzen am besten geeignet, um das hartnäckige Müffeln zu vertreiben. Krautsbraten hätte ein Schmakofatz sein können, hätte man darauf verzichtet, das Gemenge auch noch mit dem übriggebliebenen Sonntagskäsekuchen, vertrockneten Wurstzipfeln und womöglich Käserinden zu erniedrigen. Vater schmunzelte selbst darüber und warb manchmal lauthals für seine «gesammten Werke».
Klein-Vincent war nicht besonders verschleckt, das konnte man sich damals gar nicht leisten. Doch wenn es ums Essen ging, lebte er schon immer nach der Devise: «So gut wie möglich!» Dazu musste man sich erst einmal Überblick verschaffen. Nach der Schule erkundigte er sich also, was es bei Muttern zu essen gab. Dabei ließ er es aber nicht bewenden: Auch die Nachbarn wurden ausspioniert. In meinem Elternhaus wohnten sogenannte Flüchtlinge, die aus Schlesien vertrieben worden waren. Hatte vor dem Krieg pro Stockwerk eine Familie residiert, hausten dort nun zwei und manchmal drei Mietparteien. Alle vertrugen sich, und unterm gemeinsamen Dach herrschte eine lebendige, lustige Stimmung. Neue Gerüche zogen durch die Flure. Papa sagte immer: «Wären die nicht gekommen, wir schwäbischen Inzüchtler wären vollends verblödet.» Er mochte die Flüchtlinge, denn sie hatten gute Rezepte im Gepäck, waren pfiffig, und vor allem brachten sie uns den Knoblauch, der im Schwäbischen bis dahin verpönt gewesen war.
Frau Dressler im dritten Stock befand sich oft in Hochform. Die schon ziemlich alte Frau, aschgrau gekleidet und die hängenden Backen immer von einem Kopftuch zusammengehalten, stammte, glaube ich, aus der Breslauer Gegend. Sie kochte eine hinreißende Pilzsuppe, und zwar das ganze Jahr über, denn sie konservierte ihre Beute aus dem Wald in Marmeladengläsern. Dazu drückte sie rohe, gehackte Pilze Schicht um Schicht, immer mit viel Salz und etwas gehackter Petersilie, fest in die Gläser und verschloss sie dicht mit einem Deckel. Suppe wurde daraus, indem sie heißes Wasser auf den Herd stellte, etwas Salzpilze beigab – und fertig. Im Schwabenland hatten Pilze bei fast allen Familien als giftig gegolten.
So kam durch die Kriegsfolgen wirklich neues Küchendenken zu uns, wie später die Reisewelle die Eintönigkeit der deutschen Hausmannskost gewaltig aufmischte. Die regional geprägten Küchen der Vertriebenen hatten eine gewisse Exotik und brachten die ersten Importrezepte nach Westdeutschland. Beispielsweise «Schlesisches Himmelreich»: geräucherter Schweinebauch mit Backobst, außerdem war noch Zitronenschale drin. Es duftete nach Zimt und wurde wegen des Schweinebauchs nur im Winter gekocht. Dazu gab es Kließla, also schlesische Kartoffelklöße. Apfelstreuselkuchen lernte meine Mutter von einer Frau Wontka im dritten Stock, die auch von irgendwoher jenseits des Eisernen Vorhangs stammte.
Im Gegensatz zur fast großbürgerlichen Familie des Stadtoberveterinärs hatten unsere Mitbewohner so gut wie keine Habe. Trotzdem waren sie nicht arm, und den Lohn ihrer täglichen Arbeit steckten sie hauptsächlich in gutes Essen. Ihre Küche war für damalige Verhältnisse zwar nicht üppig, aber ideenreich. Die meisten Schwaben mochten davon freilich nicht profitieren. Bis heute gilt die Melodie: «Was der Schwabe nicht kennt, das frisst er nicht!» Die aus dem Osten Zugewanderten waren zuerst einmal Fremde, Eindringlinge, alles in allem suspekt, wenn sie nicht gar neidvoll beäugt wurden, weil sie staatliche Unterstützung bekamen.
Mit Scham erinnere ich mich an meinen Freund Karle. Er wohnte mit seinen Eltern im Haus gegenüber. Dort hatte ich die Wonnen von Gulasch (Suppe) und Perkölt (was wir üblicherweise Gulasch nennen) erschmeckt. Die Eltern waren nämlich Banater Schwaben, stammten aus der Gegend von Szegedin. Hmm, Szegedin! Karles Mama kochte das mit Sauerkraut vermengte Gulasch, für mich heute noch die schönste Verheiratung von Gemüse und Fleischeskraft.
Auf dem Schulhof wurde Karle von jungen Schwabenbengeln gefragt, ob er Kümmel möge. In kulinarischen Dingen waren die Flüchtlinge den Nachkriegsschwaben wie gesagt haushoch überlegen. Und so antwortete Karle unbekümmert, Kümmel sei sein Lieblingsgewürz. Sofort fielen saudumme Bemerkungen wie: «Bist du jetzt Ungarnflüchtling oder ein Kümmeltürke?» Ich war zu feige, um ihm beizustehen. Dabei war Kümmel in unserem eigenen Haushalt ein ständiger Begleiter zu Kohlgemüse, Schweinebraten und erst recht zum Backsteinkäse, wie man bei uns den Romadurkäse nennt.
Hausschlachtung
Nach meinem Bruder und mir brachte meine Mutter noch vier Mädchen auf die Welt, weshalb sie bestrebt war, uns beide zu ihren Schwiegereltern abzuschieben, die in der Nähe wohnten. Mein Opa stand mit den alten Griechen und Römern auf vertrautem Fuße: Er war Altphilologe und ein großer Denker vor dem Herrn. Generationen von Pennälern hatte der alte Vinz, wie er von seinen Schülern genannt wurde, in Schrecken versetzt, und er tat als Pauker weiterhin Dienst, indem er gebetsmühlenhaft auf den Enkel und dessen außergewöhnliche Dummheit schimpfte: «Fauler Spitz» oder «Grandackel» lauteten im Haus des Schulmeisters meine Vornamen. Im Krieg hatte er einen Stammtisch regiert, an dem nur lateinisch geredet wurde. So konnten die Feindsender diskutiert werden, ohne dass das gemeine Denunziantenvolk, ja nicht einmal der ebenfalls im «Adler» in Straßdorf sitzende Gauleiter ahnte, was die vermeintlichen Trottel am Stammtisch alles so verzapften.
Darüber hinaus war Opa ein echter Schwabe, obrigkeitsunwillig und sparsam. Die heutigen Ernährungslehren nahm er vorweg. Ihm schmeckte zwar alles, wenn dabei die Natur nicht verhunzt wurde. Doch als Anhänger der griechischen Philosophie war ihm Maßhalten ein zentrales Anliegen. Wichtiger als das Genießen waren ihm daher die Übersicht und die Fähigkeit, im richtigen Moment aufzuhören. Man könnte ihn einen feinschmeckerischen Asketen nennen. Vor dem Ersten Weltkrieg war er Hauslehrer in Montpellier gewesen; deshalb hatte er zeit seines Lebens immer Châteauneuf du Pape im Keller und Roquefort im Kühlschrank. Den scharfen Schimmelkäse gab er sich in mikroskopischer Dosis aufs Brot, und am Abend trank er dann, ebenso in homöopathischer Manier, ein Achtele Rhônewein dazu. Meinem Papa gegenüber war er, wenn’s ums Essen ging, wesentlich spendabler – mit Worten: «Verfressener Unsohn, es ist nicht mehr weit bis zum Antichrist, Fressen, Saufen und Dummheiten, das alles passt gut zusammen!» Der Sohn wurde vom herrischen Senior selbst dann noch saftig zusammengeschissen, als ich bereits bei der Bundeswehr diente.
Damals in den fünfziger Jahren brach ein Nitritsalzskandal über die Republik herein und machte Betrügereien im Metzgerhandwerk offenbar. Doch Opa wäre nie auf die Idee gekommen, von solchen «Profitle» eine Wurst zu kaufen. Seit er einem eigenen Haushalt vorstand, wurde jedes Jahr eine Sau geschlachtet.
Am Schlachttag herrschte allergrößte Konfusion. Frühmorgens um fünf ging’s los. Der Hausmetzger, der Tone (gesprochen «dr Done»), was so viel wie Anton bedeutet, war wie immer schlechter Laune. Die buschigen Augenbrauen gerefft und schwarz wie der Auspuff des Diesels, entstieg er seinem ockerdreckfarbenen Mercedes. Er war ein alter Mann, klein und gedrungen; die Kraft, die in ihm steckte, sah man ihm nicht an. Seinen Riesenschädel trug er schwer gebückt wie Atlas die Weltkugel, und wenn er sprach, richtete er sich nicht auf, sondern blinzelte skeptisch aus der Froschperspektive gegen den Rest der Welt.
Kaum hatte sich der o-beinige Tone am Treppengeländer zur Waschküche hinuntergehangelt, war der Teufel los. Als kleiner Pimpf lugte ich von oben durchs Geländer und hörte ihn auf die Weiber schimpfen: Das Feuer im Ofen glomm kaum, und das Wasser im Kessel war erst lauwarm. Ohne kochendes Wasser kann man doch keine Sau brühen! Mein Opa geriet außer sich und sah bereits das Vesper gefährdet. Tone war aber auch ein Mann mit Erfahrung und nach erleichterndem Abfluchen von ausgeglichenem Wesen, gewieft im Umgang mit schwieriger Kundschaft. Seiner Unentbehrlichkeit bewusst, fühlte er sich als Held des Tages, stand er doch sozusagen als Medizinmann und Häuptling einer Hinrichtung vor. Er war noch vom alten Handwerkerschlag, entschuldigte sich beim Tier fürs Töten und berichtete uns von allerlei Aberglauben: So habe sein Vater den Schweinen vor dem Abstechen ein Tuch um die Augen gebunden und sich bekreuzigt. Auch dürfe das Tier kein Mitleid spüren, sonst gebe es zu wenig Blut. Er selbst murmelte dem Schwein, unbeteiligt wie ein segnender Priester, noch zu, er handle um der Nahrung willen, nicht aus Hass.
Hartleibige Vegetarier bezeichnen Tierschlachten als Mord. Davon wusste man damals nichts, es gab noch nicht täglich Schnitzel dubioser Herkunft und üble Massentierhaltung. Die Tiere wuchsen unter guten Bedingungen auf, deshalb kannte man auch keine Sentimentalität gegenüber dem Schlachtvieh. Es war die Zeit ungehemmter und dankbarer Fleischeslust. Vor der Mahlzeit wurde ein Gebet gesprochen: Essen, egal was, war Kulthandlung, man wusste ums Opferlamm, die Geschenke der Natur und den Dank dafür. Ursprünglich hatten am Schlachttag die Kinder schulfrei, und der Lehrer und Pfarrer bekam das sogenannte Pfarrerstückchen, das mit dem Druidenstück (sic!) identisch war. Dass ein Schwein unrein sei, dass Milch gerinne, wenn ein Schwein am Eimer rieche, dass es der Sitz unreiner Geister sei, stammt übrigens nicht aus deutscher Überlieferung, sondern entspringt alttestamentarischen Ursprüngen, ja, geht zurück auf den Kult um Adonis, der der Sage nach von einem Eber tödlich verletzt wurde.
Die Sau hatte man am Vortag bei einem Bauern des Vertrauens gekauft, und der hatte sie auch antransportiert. Hinterm Haus grunzte sie behaglich und vertrug sich nichts ahnend und bei frohem Gemüt mit den Hühnern. Sie war ein Prachtexemplar, eine «Habersau», mit geschrotetem Hafer gemästet, nicht mit irgendwelchen Küchenabfällen erniedrigt oder gar mit der Universalmischung aus dem Raiffeisenlagerhaus auf schnelles Gewicht gebracht.
In der Waschküche prasselte dank reichlichem Blasen, Pusten und Husten endlich das Feuer. Den großen Zuber hatte Agathe geschrubbt und vorbereitet. Agathe war die Haushälterin und seit vierzig Jahren in aufopfernden Diensten meines Opas, in die sie mit sechzehn Jahren getreten war. Eine echte Respektsperson, und in all den Jahren hatte sie vom Alten reichlich gelernt. Sie beherrschte Küchenlatein, kannte sich in der Kunst leidlich aus und war auch mit Geisteswissenschaften ordentlich imprägniert worden. Bei Tisch oder beim Sonntagstee wurde permanent über griechische Geschichte, über Giorgione, Voltaire und so weiter doziert. Oft rede ich von der Küche der Großmutter, aber eigentlich war es die Haushälterin Agathe, die mich immer wieder ins Haus der Großeltern lockte. Sie war ein Genie in der Küche, und der ganze Tagesablauf hatte irgendwie mit der Nahrungsbeschaffung und der Kocherei zu tun. Offensichtlich hatte ich als Kind schon eine Veranlagung, um dafür sensibilisiert zu sein. Agathes Küche hat mich bis heute geprägt, man könnte sie mit dem Motto «Vom einfachen das Beste!» überschreiben.
Nicht Oma, sondern Agathe war die eigentliche Chefin des Hauses und die Einzige, die dem strengen Opa Paroli bieten konnte. Auf seine mürrisch-ungeduldige Frage – die mehr ein Kläffen war–, wann endlich geschlachtet werde, wies sie ihm jetzt die Tür: «Wenn Se schon nicht mitschaffen, dann warten Se gefälligst oben, bis die ersten Würst ’ zum Vesper fertig sind, Herr Doktr.» Er ging mit einer Miene, als dürste er nach einem Duell, doch er schwieg.
Das Wasser kochte. Hinter dem Haus erscholl ein Schuss– Tone und Oma beendeten das Leben der Sau. Sie hatte das Schafott also hinter sich, war mit dem Bolzenschussapparat niedergestreckt und abgestochen worden. Kein schöner Tod, falls es so etwas überhaupt gibt. Für Oma war das kein Problem und nicht im Geringsten eine Mutprobe. Sie hatte ihr Gottvertrauen oder vielleicht auch Fatalismus bereits Ende des Krieges unter Beweis gestellt, als sie einen Leiterwagen die zwanzig Kilometer nach Voggenberg-Sägmühle hinter sich herzog, um Eier und Mehl zu organisieren. Unter ständigem Gebetsmurmeln ignorierte sie die amerikanischen Tiefflieger und wich nicht vom Wege.
Nun rührte Oma wie irr das Blut im Eimer, um das Gerinnen zu verhindern. Metzgers-Tone hatte das Vieh auf einen plattfüßigen Schubkarren gewuchtet. Es saß drin wie ein Dickbauchbuddha in der Rikscha. Mit der schweren Last, die immer umzukippen drohte, stürzte Tone mehr, als dass er wankte. Die schmalen Schnellmastschweine waren damals völlig unbekannt. Eine Sau war annähernd doppelt so schwer wie die EG-Schweine unserer Zeit, die aussehen, als hätten sie im Windkanal trainiert. Schmalz musste ein Schwein liefern, es war das wichtigste Speisefett überhaupt und wurde überall verwendet außer zu Salat.
Tone ächzte schnaufend vor sich hin; an den Rosenhecken vorbei, die den Herbstschnitt schon hinter sich hatten, hielt er im groben Kies mühsam die Spur zur anderen Seite des Hauses. Von dort war die Waschküche ebenerdig zu erreichen. Zuerst wurde gebrüht, die Sau mit kochendem Wasser übergossen. So wurde die Schwarte weich, und harte Flüche waren dabei obligat. Agathe kämpfte mit äußerstem Einsatz und murmelte Stoßgebete. Harz wurde auf die Seiten des Delinquenten gestreut, die gröbsten Borsten konnten durch das Einweichen leicht abgekratzt werden. Tone zog dazu eine Kette unter dem Leib durch, schrappte damit hin und her, um die Borsten und die oberste Hautschicht abzuschaben. Daraufhin wurde unter dauerndem Messerwetzen rasiert. Mit fast zeremoniellem Ernst betrieb man die Nassrasur, entfernte die letzten Härchen und goss dabei immer wieder frisches Wasser über die zunehmend blankere Haut. Endlich lag die Sau in Frieden da, hell und rein wie neugeboren.