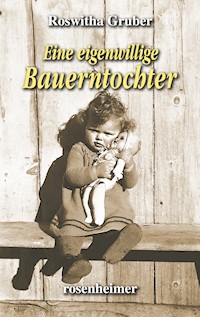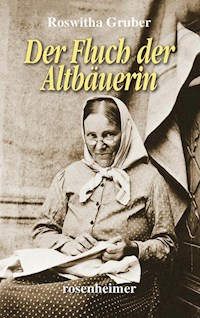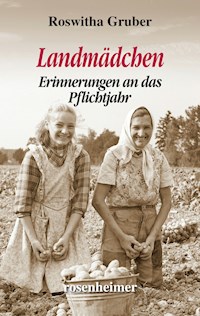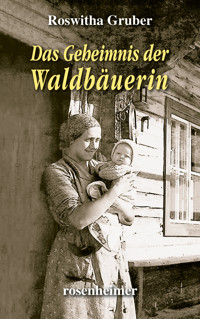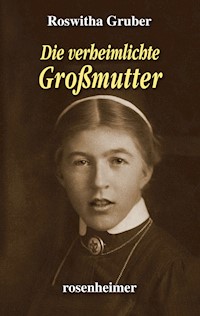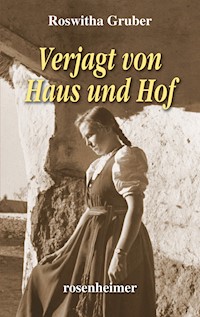16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ergreifend und einfühlsam erzählt Roswitha Gruber Geschichten aus dem Leben der Berghebamme Marianne, die in ihren 35 Berufsjahren über 3.000 Kindern geholfen hat, das Licht der Welt zu erblicken. Bei Wind und Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit war Marianne zur Stelle, wenn es darum ging, Mutter und Kind die Geburt zu erleichtern. Die bewegenden und außergewöhnlichen Erlebnisse, bei denen Freud und Leid oft dicht beieinander lagen, werden von der erfolgreichen Autorin detailgetreu und liebevoll geschildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus
erschienenen Originalausgabe 2011
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: getty images, Fox Photos
Lektorat und Bearbeitung: Ulrike Nikel, Herrsching am Ammersee
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54320-3 (epub)
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Mein Leben als Berghebamme
Ergreifend und einfühlsam erzählt Roswitha Gruber Geschichten aus dem Leben der Berghebamme Marianne, die in ihren 35 Berufsjahren über 3.000 Kindern geholfen hat, das Licht der Welt zu erblicken. Bei Wind und Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit war Marianne zur Stelle, wenn es darum ging, Mutter und Kind die Geburt zu erleichtern. Die bewegenden und außergewöhnlichen Erlebnisse, bei denen Freud und Leid oft dicht beieinander lagen, werden von der erfolgreichen Autorin detailgetreu und liebevoll geschildert.
Inhaltsverzeichnis
Gefährliche Aufklärung
Der Entschluss
In der Hebammenschule
Die Feuertaufe
In der Dachkammer
Lawinen
Alle Heiligen
Gewissensentscheidung
Ein nächtliches Abenteuer
Mannsbilder
Unsteril
Schandmäuler
Wettlauf mit dem Klapperstorch
Eine Aschenputtelgeschichte
Der Kinobesuch
Am laufenden Band
Der schiefe Turm
Die Pistenraupe
Die doppelte Taufe
Das verschenkte Kind
Das Kuckuckskind
Doppeltes Glück
Der schönste Beruf der Welt
Gefährliche Aufklärung
Es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich einmal Hebamme werden würde, denn bei meiner Geburt schien mein Weg in groben Zügen festgelegt. Als erstes Kind eines Bergbauern geboren, gab es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder würde ich eines Tages einen Bauern heiraten und mich auf einem mehr oder weniger großen Hof mit Schwiegereltern und einer Schar eigener Kinder abplagen, oder ich würde mich als ledige Tante auf dem elterlichen Hof um Haushalt und Kinder des ältesten Bruders kümmern – falls ein Sohn nachkam, wovon man in der Regel jedoch angesichts des reichen Kindersegens ausgehen konnte. Vorbilder für einen solchen Lebensweg gab es in der Familie genug, sowohl auf väterlicher als auch auf mütterlicher Seite.
Zwei Jahre später kam der erhoffte Hoferbe, und es sollte, wie erwartet, nicht bei dem einen Sohn bleiben. Weitere Brüder und Schwestern folgten, und so ging die Kathi, unsere Storchentante, wie die Hebamme von uns Kindern genannt wurde, mit schöner Regelmäßigkeit bei uns aus und ein. Da ich die Älteste in der Geschwisterreihe war, nahm ich die Besuche der Kathi ziemlich genau wahr, wenngleich ich natürlich über die konkreten Aufgaben einer Hebamme zunächst nicht wirklich Bescheid wusste.
Immerhin stellte ich sehr schnell fest, dass jedes Mal, wenn sie bei uns auftauchte und in der Schlafkammer verschwand, wo sie dann stundenlang mit der Mutter blieb, am Ende ein neues Kind in der Wiege lag. Bald vermutete ich einen gewissen Zusammenhang zwischen dieser Tatsache und ihren Besuchen, wobei ich mir jedoch eine merkwürdige Erklärung zusammenreimte. Da sie immer eine große braune Ledertasche bei sich trug, keimte in mir nämlich der Verdacht auf, dass sie darin die Kinder mitbrachte.
Weiter dachte ich zunächst nicht – woher sie die vielen Kinder nahm, darüber machte ich mir keine Gedanken. Viel stärker beschäftigte mich die Frage, warum sie die Kinder nicht selbst behielt und vor allem, wenn sie sie schon los sein wollte, warum sie sie immer zu uns brachte. Nach ein paar Jahren war ich nämlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir allmählich wirklich mehr als genug hatten. Auch wunderte es mich, dass sie die Kinder ausgerechnet dann brachte, wenn meine Mutter krank im Bett lag und sich nicht um uns kümmern konnte, geschweige denn um einen hilflosen Säugling. Eines hielt ich der Hebamme jedoch zugute – sie besaß wenigstens Anstand genug, noch einige Tage lang bei uns hereinzuschauen, um das Neugeborene zu versorgen, weil unsere Mutter dazu ja nicht in der Lage war.
Einige Monate nach meinem fünften Geburtstag sah ich wieder einmal die Kathi mit ihrer großen Tasche im elterlichen Schlafzimmer verschwinden. Uns Kinder scheuchte man wie immer in die Küche, wo uns die Großmutter beaufsichtigte, die scheinbar rein zufällig am Vortag bei uns hereingeschneit war. Während wir gerade am Mittagstisch saßen, streckte die Hebamme gut gelaunt ihren Kopf zur Tür herein: »Ich gratuliere, Hausbacherin, ihr habt wieder einen Buben.«
»Dank dir schön, Kathi«, rief ihr die Großmutter nach, als die Storchentante schon fast an der Haustür war. Wie ein Wiesel flitzte ich hinterher, denn jetzt wollte ich es endlich genau wissen. Das war doch kein Zufall: die Ankunft der Kathi, die große Tasche, und bei ihrem Weggang ein neuer Schreihals im Haus! Bis zum Hoftor trippelte ich neben ihr her und drängte: »Sag mal, Kathi, immer wenn du bei uns warst, haben wir ein neues Kind.«
»Ja, das stimmt«, war ihre knappe Antwort, die mich jedoch keineswegs zufriedenstellte, denn von dieser Tatsache konnte ich mich schließlich mit meinen eigenen Augen überzeugen.
Aber ich ließ nicht locker – ich wollte und musste es wissen, was es auf sich hatte mit den Kindern. »Gell, du bringst die kleinen Kinder in deiner Tasche?«, flüsterte ich verschwörerisch.
Die Kathi schaute mich ein wenig verwundert an. »Genau, das stimmt«, antwortete sie schmunzelnd. Da sie mir das Wichtigste noch immer nicht verraten hatte, forschte ich weiter: »Und wo kriegst du die Kinder her?«
Sie schien einen Moment zu überlegen und erklärte dann: »Weißt, Nanni, der Storch bringt sie von weit her und legt sie mir vor die Haustür. Da brauch ich sie nur aufzuheben. Manchmal lässt er aber auch eines, wenn er sich gerade einen Frosch fangen will, in den Bach fallen. Wenn dann so ein Kleines angeschwommen kommt, fische ich es heraus.«
So, jetzt wusste ich wenigstens Bescheid. Dankbar verabschiedete ich mich von der Kathi und kehrte an meinen Teller zurück.
In den folgenden Tagen trieb es mich, sobald ich meinen kleinen häuslichen Pflichten entkommen konnte, hinunter zum Bach, der unweit unseres Hofes entlang floss. Dort hockte ich mich hin und starrte angestrengt in das plätschernde Wasser. Wenn die Kathi hier immer wieder ein kleines Kind fand, dann sollte mir das doch auch gelingen, dachte ich. Meine Chancen mussten sogar erheblich größer sein als die ihren, denn ehe der Bach bei ihrem Haus ankam, floss er bei uns vorbei. Wenn die Kathi das Kind herausfischte und es ohnehin zu uns brachte, dann konnte ich das doch gleich selbst erledigen. Ich wollte es der Mutter aber nicht bringen, solange sie krank im Bett lag, sondern warten, bis sie gesund war.
Es gab da eine bevorzugte Stelle, wo ich besonders gern saß. Sie war ganz nah am Wehr, an dem man einen Teil des Baches zur Mühle ableiten konnte. Eines Tages wurden mir das lange Sitzen und das sture ins Wasser-Starren zu langweilig. Ich stand auf, balancierte auf dem Wehr herum und beobachtete von dort aus das vorbeirauschende Wasser. Bald darauf wurde wirklich ein Kind aus dem Bach gefischt. Aber nicht von mir und auch nicht von der Hebamme, sondern von der Nachbarin.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem eigenen Bett. Über mir sah ich das besorgte Gesicht meiner Großmutter. »Aber Dirndl, was machst du für Sachen?« Ein milder Vorwurf, vor allem aber Erleichterung war aus ihrer Stimme zu hören.
»Ich wollte doch nur nachschauen, ob im Bach ein Kind schwimmt«, antwortete ich kleinlaut.
»Ja, da ist eins geschwommen. Aber das warst du.«
Da dämmerte es mir: Ich war vom Wehr abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben.
»Du wärst jetzt tot«, fuhr meine Großmutter fort, »wenn die Nachbarin nicht zufällig aus dem Haus gekommen wäre und deinen Schrei gehört hätte. Da ist sie beherzt hinzugesprungen. Sie konnte dich grad noch rausziehen, bevor du in den Strudel geraten bist.«
Oh mein Gott, der Strudel! Dort wäre ich unrettbar verloren gewesen.
»Ich wollte doch nur sehen, ob ich nicht auch so ein ganz kleines Kind im Bach finde«, führte ich zu meiner Verteidigung an.
»Wie kommst du denn auf solchen Blödsinn?«, wollte die Großmutter wissen.
»Die Kathi hat’s mir erzählt. Sie fischt manchmal eins aus dem Bach, wenn der Storch es hat reinfallen lassen.«
»Wie kann die Kathi nur solch einen Schwachsinn verzapfen«, empörte sich die Großmutter. »Der werde ich was erzählen, wenn ich sie das nächste Mal sehe.«
»Wo hat die Kathi die Kinder denn sonst her, wenn nicht aus dem Bach?«, versuchte ich endlich die Wahrheit zu erfahren. Verlegen schaute die alte Frau eine Weile geradeaus, bevor sie etwas unwirsch antwortete: »Was weiß ich, wo sie die Kinder hernimmt. Jedenfalls nicht aus dem Bach.«
»Ja, aber woher denn dann?«, fragte ich ungeduldig und enttäuscht, dass ich schon wieder abgewimmelt werden sollte.
»Das wirst du noch früh genug erfahren.«
Von Stunde an ließ mich das Thema Kinderkriegen nicht mehr los. Wo immer es möglich war, versuchte ich, mich auf diesem Gebiet schlau zu machen, aber der Informationsfluss war nur äußerst spärlich.
Die Hebamme kam noch oft zu uns ins Haus, bis wir zehn Geschwister waren und es endlich andere Abnehmer für die Kinder der Kathi zu geben schien. Obwohl mich diese ganzen undurchsichtigen Geschichten nach wie vor brennend interessierten, machte ich seit meinem wenig heldenhaften Erlebnis am Bach einen großen Bogen um die Storchentante, der ich es irgendwie übel nahm, weil sie sich so offensichtlich über mich lustig gemacht und solch dumme Antworten gegeben hatte. Ich wagte es nie wieder, sie etwas zu fragen, denn dass man mich für dumm verkaufte, das konnte ich nicht leiden.
Aber so war es halt damals. Selbst die Erwachsenen redeten oft nur verschämt über manche Dinge – wie sollten sie da in der Lage sein, offen mit ihren Kindern zu sprechen, vor allem wenn es um sexuelle Aufklärung ging. Nicht wenige Frauen sind nur halbherzig aufgeklärt in die Ehe gegangen, und viele andere wurden zu »gefallenen Mädchen«, weil sie keine Ahnung hatten, wie sich das verhielt mit Schwangerschaft und Kinderkriegen.
Man könnte nun annehmen, ich sei Hebamme geworden, um endlich hinter das Geheimnis des Lebens zu kommen. Weit gefehlt, denn trotz meines ausgeprägten Interesses an allem, was mit Schwangerschaft und Geburt und den Aufgaben einer Hebamme zu tun hatte, dachte ich nicht im Entferntesten daran, selbst eine zu werden. Meine Ambitionen gingen traditionsgemäß in eine andere Richtung. Nähen wollte ich lernen und Haushaltführung, damit ich irgendwann heiraten und eine Familie gründen konnte. So war das damals nach dem Krieg noch in unseren recht einsamen Tälern des Salzburger Landes.
Der Entschluss
Zunächst schien auch alles auf dem vorgezeichneten Weg zu laufen, wenn man davon absieht, dass ich nicht in einen Bauernhof einheiratete, sondern zur Enttäuschung meiner Eltern einen Bahnangestellten zum Mann nahm, den sie abfällig als »Hungerleider« bezeichneten. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, arglos und im übertragenen Sinn blauäugig. Wie damals die meisten Mädchen glaubte ich, damit bis ans Ende meiner Tage versorgt zu sein. Die Rollenverteilung war für uns klar: Der Mann ging zur Arbeit, um Geld herbeizuschaffen, die Frau bereitete ihm ein behagliches Heim, bekam einige Kinder und zog sie groß. Doch nach einigen Jahren sollte ich aus meinem Wolkenkuckucksheim unsanft auf dem Boden der Wirklichkeit landen.
Zunächst bekam ich jedoch wie üblich nach einem Jahr das erste Kind, wunschgemäß einen Buben, und nach anderthalb Jahren folgte ebenso wunschgemäß ein niedliches Mädchen. Damit hätte mein Glück vollkommen sein können, zumal beide Kinder gesund waren und sich prächtig entwickelten. Über Beschäftigungsmangel konnte ich nicht klagen, denn zur Entlastung der Haushaltskasse zog ich in einem kleinen Nutzgarten alles, was wir so brauchten an Gemüse, Obst und Salaten. Außerdem machte der Haushalt, obgleich die Wohnung winzig war, viel Arbeit. Noch hatte die Technik mit ihren vielen Erleichterungen zumindest in den normalen Haushalten nicht Einzug gehalten – das war nur etwas für Großverdiener, während die kleinen Leute alles noch in anstrengender, zeitraubender Handarbeit erledigen mussten.
Auch Wegwerfwindeln gab es nicht, jedenfalls nicht für mich. Meine Kinder wurden noch in den guten alten Mullwindeln groß, die in einem Kessel auf dem Kohlenherd zunächst gekocht und anschließend von Hand gerubbelt und in kaltem Wasser geschwenkt werden mussten. Bei zwei Kleinkindern kam da am Tag einiges zusammen. Oft habe ich sehnsüchtig gedacht, wie schön es wäre, wenn wir uns das eine oder andere Gerät, die eine oder andere Maschine zur Erleichterung der Hausarbeit leisten könnten, doch nie war genug Geld da.
Wenn du einen Beruf hättest, ging es mir immer wieder durch den Kopf, dann könntest du etwas dazuverdienen, dann kämen wir besser über die Runden. Was aber konnte man schon tun als ungelernte Kraft? Und wohin mit zwei Kindern im Krabbelalter?
Als meine Tochter drei Jahre alt war und der Sohn viereinhalb, tat sich mir plötzlich eine Möglichkeit auf, denn im Sägewerk eines Nachbardorfes wurde eine Arbeitskraft gesucht. Obwohl mir klar war, dass man dort an einen Mann dachte, beschloss ich, mich um diese Stelle zu bewerben. Ich konnte immerhin mit einschlägigen Kenntnissen aufwarten, denn daheim auf unserem Hof hatte ich wie ein Holzknecht arbeiten müssen. Seit ich zwölf war, hatte mich der Vater mit in den Wald genommen, wo ich ihm bei allen anfallenden Arbeiten helfen musste. Da war keine Rücksicht darauf genommen worden, dass ich ein Mädchen war.
Mutig bewarb ich mich um die freie Stelle, aber nicht mit einem säuberlich aufgesetzten Schreiben. Nein, ich ging gleich persönlich hin. Mit zur Seite gelegtem Kopf musterte mich der Besitzer von oben bis unten, bis sich ihm schließlich folgender Satz entrang: »So, jetzt möchten die Weiberleut schon im Sägewerk arbeiten?«
Da ich auf diese Feststellung hin nur nickte, quälte er sich einen weiteren Satz ab: »Das ist ja eine ganz neue Mode. Das ist doch Männerarbeit, und dafür such ich ein Mannsbild.«
»Bis jetzt hast aber keins gefunden«, konterte ich selbstbewusst.
»Stimmt. Also, wenn ich bis nächste Woche noch immer keins hab, kannst es probieren.«
Ich probierte es wirklich. Da meine Kinder mittlerweile aus dem Gröbsten heraus waren, zeigte meine Mutter sich bereit, sie tagsüber zu betreuen. Morgens vor der Arbeit konnte ich sie bei ihr abliefern und abends wieder einsammeln.
Nach einigen Tagen, mein wortkarger Chef hatte mir eine Weile auf die Finger geschaut, brummte er: »Du bist zwar eine Frau, aber schaffen tust wie ein Mann. Das hätt ich dir nie zugetraut.«
Obwohl diese anerkennenden Worte mich freuten, wollte ich auf dieser Stelle nicht alt werden, denn die Schlepperei und das Stapeln des schweren Holzes waren kraftraubend. Wenn wenigstens der Verdienst entsprechend gewesen wäre! Weil ich mich aber mit einem Hungerlohn begnügen musste, der mir für die harte Arbeit ganz und gar unangemessen schien, kündigte ich nach einem halben Jahr. Mein Chef war maßlos enttäuscht.
»Wieso willst denn schon wieder gehen? Du bist doch unser bester Mann!«, sagte er mit seinem merkwürdigen Humor, doch ich ließ mich nicht umstimmen. Allerdings nannte ich nicht die wahren Gründe für meine Kündigung, sondern schob meine Kinder vor. Die Betreuung durch die Großmutter klappe nicht so, wie erhofft, erklärte ich ihm, und deshalb müsse ich mich selbst wieder um sie kümmern.
Inzwischen war ich achtundzwanzig Jahre alt und saß wieder zu Hause, mit zwei kleinen Kindern, ohne Geld, ohne Beruf, ohne Selbstwertgefühl und ohne Perspektive. Als ich so mitten in einem Stimmungstief steckte und mir die Decke auf den Kopf fiel, beschloss ich, eine Freundin zu besuchen, die in ein Nachbartal geheiratet hatte. Ich brauchte Tapetenwechsel und einen Menschen, mit dem ich reden konnte. Kurz entschlossen übergab ich die Kinder an einem Wochenende der Obhut ihres Vaters und machte mich auf den Weg.
Das kleine Schwätzchen mit der Schulfreundin tat mir wirklich gut und lenkte mich ein bisschen von meinen Alltagssorgen ab. Beiläufig erwähnte Annemarie, dass die alte Hebamme, bei der sie ihre beiden Kinder bekommen hatte, vor einigen Wochen gestorben sei und die Gemeinde nach einem Ersatz Ausschau halte.
Das wäre etwas für mich! Dieser Gedanke durchzuckte mich wie ein Blitz.
Was die Freundin sonst noch erzählte, nahm ich gar nicht mehr zur Kenntnis. Vor meinem geistigen Auge tauchte die Hebamme auf, die mich zweimal entbunden hatte. Eine sympathische Person, so zwischen fünfzig und sechzig, weder groß noch klein, weder dick noch dünn, mit streng zurückgekämmten Haar, das im Nacken zu einem Knoten zusammengesteckt war. Ihre Art hatte mir gefallen, wie sie fachkundig, selbstbewusst und sicher mit mir und den anderen werdenden Müttern umgegangen war.
Meine erste Begegnung mit ihr fand in den Morgenstunden eines heißen Augusttages statt. Ganz in der Frühe hatten bei mir die Wehen eingesetzt, die ich zunächst jedoch nicht als solche erkannte. Zwar war ich durch meine vielen jüngeren Geschwister in der Säuglingspflege ziemlich perfekt, doch meine Aufklärung hinsichtlich Geburt und Schwangerschaft war eher minimal gewesen. Immerhin bekam ich mit, dass ich schwanger war, als die Regel ausblieb. Diesen Zusammenhang hatten mir noch während der Schulzeit Mitschülerinnen hinter vorgehaltener Hand zugewispert. Irgendwo hatte ich ebenfalls aufgeschnappt, dass man vor einer Geburt Wehen hatte, es jedoch noch sehr lange dauern konnte, bis das Kind kam. Das war dann auch schon alles.
Als die Wehen heftiger wurden, beschlich mich der Verdacht, das könnte irgendwie darauf hindeuten, dass mein Kind bald auf die Welt wollte. Trotzdem fuhr ich unbeirrt mit meiner Hausarbeit fort und bereitete für meinen Mann einen Topf Suppe sowie eine große Portion Semmelknödel vor, denn schließlich sollte er wenigstens für die ersten Tage meiner Abwesenheit etwas zu essen haben. Doch irgendwann konnte selbst ich die warnenden Zeichen nicht mehr übersehen. Da mein Mann erst am späten Nachmittag nach Hause kommen würde, musste ich handeln. Also holte ich vom Kleiderschrank die alte Reisetasche, die aus meinem Elterhaus stammte, und begann zu packen.
Da inzwischen die Wehenpausen zunehmend kürzer wurden, warf ich nur das Notwendigste hinein und machte mich auf den Weg in Richtung Altenheim, wo die Gemeindehebamme ein Entbindungszimmer unterhielt. Das war ein Angebot für solche Frauen, die zu Hause nicht entbinden konnten oder wollten, weil die nötigen Voraussetzungen fehlten. Wenn sie bei jemandem fehlten, dann bei uns. Unsere Wohnung bestand aus zwei winzigen Räumen ohne fließendes Wasser, ohne Toilette. Außerdem hätte es niemanden gegeben, der mich und den Säugling anschließend gepflegt hätte. Also war das Altenheim für mich genau das Richtige.
Kaum war ich auf dem Weg, setzte wieder eine starke Wehe ein. Halt suchend lehnte ich mich an einen Baumstamm und atmete ganz instinktiv kräftig durch, denn gesagt hatte mir das niemand. Und als ich wenig später merkte, dass zwischen den Beinen eine Flüssigkeit herunterlief, hatte ich ebenfalls keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Ich war nur erleichtert, dass es kein Blut war.
Was sollte ich tun? Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit zusammengepressten Oberschenkeln weiterzumarschieren. Die Minuten wurden zu einer Ewigkeit.
Total erschöpft – von der Hitze, von den Schmerzen, von der unnatürlichen Art des Gehens – kam ich an der Pforte des Altenheimes an. Der Schwester dort musste ich nicht erklären, dass ich zum Entbindungszimmer wollte und dass ich die Hebamme brauchte. Ein Blick auf meinen Zustand hatte ihr genügt.
»Da hast Glück. Die Hebamme kommt ohnehin gleich, weil sie nach einer Wöchnerin schauen muss.«
Sie nahm meine Personalien auf und führte mich in ein weiß getünchtes Zimmer, in dem ein Metallbett stand, das von allen Seiten zugänglich war. Die Gitterstäbe waren weiß lackiert und die Kissen mit blütenweißer Wäsche bezogen. Alles wirkte sehr sauber, aber gleichzeitig schrecklich kalt und kahl. Ermattet ließ ich mich auf den einzigen Stuhl, den ich im Raum entdecken konnte, fallen und kam mir gottverlassen vor – trotz der Augusthitze begann ich bis ins Innerste zu frösteln.
Der Abstand zwischen den Wehen wurde immer kürzer und jede Wehe immer stärker als die vorangegangene. Bedeutete das, dass die Geburt unmittelbar bevorstand? Ich fühlte mich allein mit meiner Frage, und Angst stieg in mir hoch. Was, wenn die Hebamme nicht rechtzeitig kam?
Um mich abzulenken, schaute ich mich weiter im Zimmer um. An der dem Bett gegenüberliegenden Wand standen fünf Babykörbchen – zu gern hätte ich hineingeschaut, um zu sehen, ob Säuglinge darin lagen. Aber aus Sorge, mein Kind könnte auf den Boden fallen, blieb ich sitzen. An der Wand neben der Tür stand eine Kommode mit einer weichen Auflage, offensichtlich zum Wickeln der Säuglinge. Daneben erkannte ich eine Babybadewanne, eine Babywaage, einen Stoß Windeln und einige Frotteetücher. Ehe ich dazu kam, die anderen Gerätschaften zu identifizieren, öffnete sich die Tür, und schnellen Schrittes trat jemand ein.
»Grüß Gott, ich bin die Traudl, deine Hebamme«, stellte sie sich vor, reichte mir die Hand und angelte sich dann den Kittel, der am Türhaken hing. Bei ihrem Anblick fiel mir eine Zentnerlast vom Herzen, und aufgeregt erzählte ich ihr von der verlorenen Flüssigkeit.
»Das war nur Fruchtwasser«, beruhigte sie mich. »Dann schauen wir mal, wie weit wir sind.«
Die Art, wie sie das sagte, wie sie mir beim Ablegen der Kleidung half, wie sie mir mein Nachthemd überstreifte und mir in das hohe Entbindungsbett half, tat mir unendlich gut – sie wirkte so ruhig und strömte etwas Beruhigendes aus. Auch bei allem, was sie während und nach der Untersuchung sagte und tat, war sie dermaßen fürsorglich und behutsam, dass ich mich geborgen fühlte wie noch nie in meinem Leben.
Nachdem innerhalb kurzer Zeit ein hübscher, kräftiger Junge ans Licht der Welt gekommen war, brachte sie mich in das sogenannte Wochenzimmer, wo bereits eine andere junge Frau lag. Ich genoss die zehn Tage in der Annehmlichkeit dieses Raumes und ließ mich gern ein wenig verwöhnen und umsorgen. Und als ich schließlich mit meinem kleinen Bündel im Arm das Heim verlassen musste, schwor ich mir, dass ich nie irgendwo anders als in diesem Haus und bei dieser Hebamme entbinden wollte.
Anderthalb Jahre später war es wieder so weit. Abermals stand ich allein auf weiter Flur, als bei mir die Wehen einsetzten. Es war in den ersten Februartagen, und Eisblumen blühten in märchenhafter Pracht an den kleinen Fenstern unserer Wohnung, sodass ich nicht hinausschauen konnte. Gott sei Dank hatte es in der Nacht keinen Neuschnee mehr gegeben, doch der Schnee von gestern reichte völlig aus, um mir den Weg bis zur Bushaltestelle beschwerlich zu machen.
Es war ein Glück, dass ich diesmal meine Vorbereitungen besser getroffen hatte. Den Buben hatte ich vorsichtshalber schon vor einer Woche zu meiner Mutter gebracht, und meine Reisetasche stand gepackt neben der Wohnungstür. Bereits die erste Wehe war so stark, dass ich nicht mehr auf die Idee kam, Suppe oder Knödel zuzubereiten.
Ich zog meinen Mantel über, schlüpfte in meine Schnürschuhe und griff nach der Reisetasche. Dann watete ich durch den Schnee, der mir bis zur halben Wade reichte, zur Bushaltestelle. Als ich dort nach wenigen Minuten ankam, hatte die Nässe meine handgestrickten, schafwollenen Strümpfe völlig durchdrungen. Zum Glück kam bald der Bus und brachte mich ans Ziel, sodass mir die Mühsal eines langen Fußmarsches diesmal erspart blieb.
Wieder saß dieselbe Schwester an der Pforte wie vor anderthalb Jahren. Sie erkannte mich gleich. »Du hast Glück! Die Hebamme ist gerade im Entbindungszimmer.«
»Ja, Nanni, du schon wieder«, begrüßte die Traudl mich erfreut. »Seit wann hast denn Wehen?«
»Seit einer guten Stunde etwa«, gab ich Auskunft.
»Du kannst so lang hier warten, ich bin gleich fertig.« Dabei wies sie auf den einzigen Stuhl, der im Raum stand, und wickelte seelenruhig ihren Säugling zu Ende. Dann nahm sie den nächsten aus seinem Körbchen, untersuchte den Inhalt seiner Windel, säuberte ihn und zog ihm in aller Gemütsruhe saubere Sachen an. Zwischendurch warf sie mir die Frage zu: »Hast Wehen?«
»Ja, schon«, gab ich zu und hielt mir den Bauch vor Schmerzen. Sie aber wickelte und wickelte. Plötzlich spürte ich einen Druck auf der Blase und stöhnte auf: »Ich glaube, ich muss aufs Klo.«
Die Traudl warf mir einen prüfenden Blick zu, und plötzlich kam Leben in sie. Jetzt ließ sie Säugling Säugling sein und packte mich energisch am Arm. »Komm, sofort ins Bett!«, sagte sie, zerrte mich zu dem hohen Bett und warf mich darauf. Die Zeit, mich auszuziehen, blieb nicht mehr, denn schon kam das Kind. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich insgesamt nicht mehr als fünf Wehen gehabt.
»Das war aber knapp«, stellte die Traudl aufatmend fest, nachdem sie meine Tochter abgenabelt hatte. Sie packte mich in das letzte freie Bett im Wochenzimmer und meinte: »Jetzt darf aber keine mehr kommen. Das Haus ist voll.«
Damals war mir noch nicht im Entferntesten der Gedanke gekommen, ich könnte eines Tages in Traudls Fußstapfen treten. Erst als meine Freundin Annemarie bei unserem Sonntagsschwatz erwähnte, dass die Gemeinde eine neue Hebamme suche, war die Zeit reif. Deutlich spürte ich mit einem Mal, dass dies ein Beruf sein müsste, der mir eine tiefe innere Befriedigung verschaffen würde. Es musste schön sein, jungen Frauen in den schweren Stunden der Geburt fachkundig beistehen zu können und ihnen Trost und Zuspruch zu geben. Doch obwohl ich mir sicher war, meine Berufung gefunden zu haben, erzählte ich zunächst niemandem von meinem Plan, denn bevor ich als Hebamme arbeiten konnte, musste ich eine harte Ausbildung durchlaufen. Und sollte ich diese nicht schaffen, brauchte niemand von dem fehlgeschlagenen Versuch zu wissen.
Zunächst hatte ich wieder einmal nicht die geringste Ahnung. Wie wurde man überhaupt Hebamme? Wie sah die Ausbildung aus, und an wen hatte man sich zuwenden? Alles musste wohl durchdacht sein, denn immerhin war ich verheiratet und Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Traudl fiel mir ein – zu ihr würde ich gehen, denn sie konnte alle meine Fragen bestimmt beantworten und mir raten. Von ihr erhoffte ich mir nicht nur Aufklärung darüber, wie man Hebamme wurde, sondern ich erwartete, dass sie mir kompetent ab- oder zuraten konnte. Ich setzte so viel Vertrauen in sie, dass ich es ganz von ihrer Meinung abhängig machen wollte, ob ich diese Ausbildung beginnen würde oder nicht. Niemand war besser geeignet als sie.
Bereits am nächsten Tag stand ich bei ihr vor der Tür, noch bevor ich mit irgendjemandem aus meiner Familie darüber geredet hatte.
»Ja, Nanni«, rief sie überrascht aus und tastete mit routiniertem Blick meinen Bauch ab. »Was willst denn du bei mir? Es sieht nicht so aus, als ob ich bald was für dich tun könnte.«
»Das sieht nur so aus«, ging ich auf ihren scherzenden Ton ein. »Du kannst gewiss was für mich tun.«
»Da bin ich aber gespannt.«
Bei einer Tasse Kaffee am Küchentisch fiel ich mit der Tür ins Haus: »Wie wird man Hebamme?«
Sie ließ die Tasse, die sie gerade zum Mund führen wollte, sinken. Statt mir eine Antwort zu geben, stellte sie eine Gegenfrage: »Ja, möchtest du etwa Hebamme werden?«
Ich nickte nur.
»Wie kommst du denn auf die Idee?«
Als ich ihr von dem Besuch bei meiner Freundin erzählte und dass mich deren Erzählung auf die Idee gebracht hatte, seufzte sie: »Ja, ja, die Rosa, die gute Seele. Jetzt hat der Herr sie heimgeholt. Ich hab davon gehört. Und jetzt möchtest du ihre Stelle einnehmen?«
Ich nickte eifrig und mit leuchtenden Augen.
»Ja, wie willst denn das machen mit zwei kleinen Kindern? Und warum?«
»Ja, weißt, mein Mann verdient recht wenig, und von dem Wenigen trägt er auch noch einen Teil ins Wirtshaus. Da bleibt für die Kinder und mich zu wenig zum Leben.« Ich erzählte ihr von meinem ersten Versuch, dies zu ändern, nämlich von meiner Arbeit im Sägewerk.
»Als Hebamme in den Bergen wirst auch nicht reich«, versuchte sie meinen Optimismus zu dämpfen. »Auch hier kriegen die Leute immer weniger Kinder, und zudem wandern mehr und mehr Frauen zur Entbindung in die Kliniken ab.«
»Das ist mir bekannt. Trotzdem, wenn ich mich umschaue, es gibt doch noch eine ganze Reihe von Frauen, die ihre Kinder daheim kriegen. Das tät mir langen. Reich zu werden, erhoff ich mir ohnehin nicht. Nur ein bisschen dazuverdienen, damit ich mit meinen Kindern über die Runden komme.«
»Wenn’s dir nur ums Verdienen geht, muss ich dir dringend abraten. Da gibt’s genug andere Berufe, in denen du wesentlich mehr verdienst und dich wesentlich weniger abplagen musst.«
»Mir geht’s ja nicht nur ums Verdienen«, beteuerte ich. »Mir geht es auch darum, eine sinnvolle, eine befriedigende Tätigkeit zu haben. Es muss wunderschön sein, immer wieder neuen Menschenkindern ins Leben zu helfen und die strahlenden Augen der Mütter zu sehen, wenn man ihnen das Neugeborene in den Arm legt.«
»Freilich, das ist sehr schön. Aber es gibt auch andere Momente. Denk an die ledigen Mütter, die oft gar nicht glücklich sind, wenn man ihnen ihr Kind überreicht. Überleg auch, ob du die Kraft hast, einer Mutter sagen zu müssen, dass das Kind tot oder in irgendeiner Weise behindert ist.«
Die Worte der erfahrenen Hebamme gaben mir zu denken. Eine Weile schwieg ich betreten, doch dann gewann mein Optimismus erneut die Oberhand. »Ich glaube, ich schaffe das. Von vornhinein die Flinte ins Korn zu werfen, ist nicht meine Art. Du musst zugeben, die erfreulichen Fälle überwiegen und gleichen leicht die traurigen Erlebnisse aus.«
Sie gab mir Recht, hatte jedoch gleich einen weiteren Einwand parat: »Bedenk aber, dass der Beruf einer Hebamme in den Bergen kein Zuckerschlecken ist. Er erfordert viel Kraft und Opferbereitschaft. Oft musst du mitten in der Nacht raus – egal, ob Sommer oder Winter, egal, ob Glatteis ist oder meterhoher Schnee liegt. Deshalb solltest du dich, wenn du schon unbedingt Hebamme werden willst, um eine Anstellung in einem Krankenhaus bemühen. Da hast du geregelte Arbeitszeiten und bist nicht den Launen der Witterung ausgesetzt.«
»Nein, Traudl, genau das will ich nicht. Ich will nicht Hebamme in einem Krankenhaus werden. Dort sind mir die Menschen zu anonym, da verliere ich sie nach dem Wochenbett gleich wieder aus den Augen. Ich möchte eine Berghebamme sein, die zu den Müttern in die Häuser geht, die ihre Nöte und Probleme kennt, die den Kontakt zu ihnen behält, wenn die Wochenpflege längst zu Ende ist. Ich möchte Müttern beistehen, die mich immer wieder rufen, möchte die Entwicklung der Familie beobachten und verfolgen, was aus ›meinen‹ Kindern wird. Sag doch selbst, das ist es doch auch, was dich in den Bergen gehalten hat.«
»Gewiss, das stimmt. Bei mir ist es allerdings ein wenig einfacher als drüben in Kirchfeld, wo die Ansiedlungen teilweise sehr weit auseinander liegen und wo du auch ganz schön in die Berge hinauf musst.«
»Du weißt, dass ich ein Kind der Berge bin. Nirgendwo würde ich mich wohler fühlen als dort. Das Kirchfelder Tal sieht dem unseren so ähnlich, dass ich bestimmt kein Heimweh bekommen werde. Müsste ich dagegen in der Stadt leben, würde ich vor Sehnsucht nach den Bergen sterben.«
»Wenn du das so siehst, will ich dir nicht abraten. Aber du sollst wissen, es gehört viel Idealismus dazu. Wenn du den hast und dazu viel Courage und Opferbereitschaft, dann wirst du deinen Weg machen.«
Nachdem diese grundsätzlichen Dinge geklärt waren, konnten wir die praktische Seite angehen. Ich erfuhr, dass ich, um mein Berufsziel zu erreichen, auf eine sogenannte Hebammenlehranstalt gehen müsse, wo ich in einer achtzehnmonatigen Ausbildung praktisch und theoretisch auf meine zukünftigen Aufgaben vorbereitet würde.
»Am besten gehst du nach Salzburg. Da befindet sich nicht nur die am nächsten gelegene Schule, sondern sie genießt überdies einen ausgezeichneten Ruf.«
»Ja, und was muss ich da tun, damit die mich annehmen?«
»Das ist ganz einfach. Du brauchst dich nämlich gar nicht selbst dort zu bewerben. Am besten sprichst du bei der zuständigen Gemeindeverwaltung vor, die dir in jedem Fall weiterhelfen wird.«
Bereits am nächsten Tag wurde ich im Kirchfelder Rathaus vorstellig und erlebte die große Überraschung meines Lebens. Hatte ich mich ursprünglich in der Rolle der Bittstellerin gesehen, so wurde ich, kaum dass ich mein Anliegen vorgetragen hatte, eines Besseren belehrt, denn alle hofierten mich und nannten mich überschwänglich gar ein Geschenk des Himmels. Man ermunterte mich, die Ausbildung so bald wie möglich zu beginnen, und sicherte mir sogar einen Zuschuss zu den Ausbildungskosten zu.
Welch ein Glück, dachte ich, denn dass die Ausbildung etwas kostete, das war ein Punkt, den ich bei meiner euphorischen Planung überhaupt nicht berücksichtigt hatte. Mit dem Zuschuss aber würde ich so einigermaßen über die Runden kommen, wenn ich meine Ersparnisse aus der Sägewerkszeit dazulegte. Eine finanzielle Unterstützung vonseiten meines Mannes war dagegen nicht zu erwarten. Ich verließ das Rathaus mit der festen Zusicherung, dass ich mich um nichts zu kümmern brauche. Alle notwendigen Anrufe und Schreiben würden von amtlicher Seite erledigt. Ich müsse nur zu gegebener Zeit in Salzburg zur Aufnahmeprüfung erscheinen.
Mein Gott, eine Aufnahmeprüfung! Das Herz rutschte mir bis in die Knie. Auch daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Was man da wohl von mir wissen wollte? Ob es irgendeine Möglichkeit gab, sich ein wenig vorzubereiten? Plötzlich bekam ich Angst vor meiner eigenen Courage und hätte die Bewerbung am liebsten wieder zurückgezogen. Doch dann fielen mir die Worte des Bürgermeisters ein, der mir zugesichert hatte, mich nach dem Examen sofort zu übernehmen. Wenn es für ihn selbstverständlich war, dass ich das Abschlussexamen bestand, welchen Grund hatte dann ich, an mir wegen einer lächerlichen Aufnahmeprüfung zu zweifeln?
Nachdem sich alles so schnell und positiv entwickelt hatte, war es an der Zeit, meine Familie zu informieren. Die Reaktionen auf meine Mitteilung waren sehr unterschiedlich.
Mein Mann knurrte vor sich hin: »Eine verrückte Idee ist das, ganz eine verrückte. Wenn du dir das in den Kopf gesetzt hast, dann mach’s halt. Aber glaub nicht, dass ich dir in irgendeiner Weise helfe.« Noch ehe ich etwas darauf entgegnen konnte, fuhr er fort: »Von mir brauchst mit keinerlei Unterstützung zu rechnen, weder in finanzieller Hinsicht, noch was den Haushalt und die Kinder betrifft.«
Da ich so etwas Ähnliches erwartet hatte, fiel ich nicht gerade aus allen Wolken, denn ich wusste, dass ich eine von meinem Mann unabhängige Lösung finden musste. Dabei hoffte ich sehr auf die Unterstützung meiner Mutter, von der ich erwartete, dass sie zumindest eines meiner Kinder für die Ausbildungsdauer aufnehmen würde. Das andere würde ich mit Sicherheit bei ihrer ledigen Schwester, meiner Patentante, unterbringen können.
»Stell dir das nur nicht zu leicht vor«, war der besorgte Einwand meiner Mutter. »Damit meine ich nicht nur das Lernen und die Schule. Das wirst du schaffen. Ich rede von der Zeit danach, wenn du zu jeder Tages- und Nachtzeit raus musst, bei Wind und Wetter. Du weißt auch nicht immer, wer vor der Tür steht, und trotzdem musst du mit jedem mitgehen.«
»Ich weiß, Mutter, aber davor hab ich keine Angst.«
»Und außerdem«, fuhr sie in ihren Vorhaltungen fort, »eine Hebamme trägt eine große Verantwortung. Wie leicht kannst du da mit dem Gesetz in Konflikt kommen.«
»Wenn ich alles richtig mache, kann mir nichts passieren.«
»Das hat schon manch eine gedacht, und hernach hat sie den Ärger gehabt.«
»Mutter, wenn alle Frauen solche Bedenken hätten, wer würde dann noch Hebamme werden wollen? Dann gäbe es ja niemanden, der den Müttern in ihrer schweren Stunde beisteht.«
»Da hast auch Recht. Also, in Gottes Namen, dann geh halt den Weg, den du gehen musst.«
Mein Vater dagegen reagierte völlig anders. Als er von meinem Vorhaben hörte, rastete er völlig aus. »Was fällt dir ein?«, schrie er. » Du bist ja verrückt geworden! Das ist ein Hirngespinst! Du solltest lieber arbeiten, als solch einen Blödsinn zu machen.«
Meinen Einwand, das sei doch auch eine Arbeit, ließ er überhaupt nicht gelten. Für ihn war Arbeit nur das, was man auf dem Feld, im Wald oder im Stall tat. Zusätzlich hielt er mir noch vor, ich sei viel zu blöd für diesen Beruf, dazu brauche man Gescheitere als mich. Damit hatte er bei mir allerdings einen sehr wunden Punkt getroffen, und ich warf ihm jetzt alles vor, was ich ihm gern schon längst einmal gesagt hätte.
»Dass ich nur eine mangelhafte Schulbildung hab, das brauchst du mir nicht vorzuwerfen, und das hat auch rein gar nichts mit meiner Intelligenz zu tun. Dass ich nicht mehr kann und weiß, daran hast du Schuld. Du vor allem hast verhindert, dass ich in den Sommermonaten eine Schule von innen gesehen hab. Du warst es doch, der mich im Sommer immer hat freistellen lassen, weil du mich für die Feldarbeit brauchtest. Darüber will ich mich nicht beklagen. Ich sehe ein, dass es notwendig war. Deswegen hast du aber noch lang nicht das Recht, mir Dummheit vorzuwerfen. Es ist doch viel eher so, dass du grundsätzlich der Meinung bist, ein Mädchen brauche nichts zu lernen. Aber ich werde meinen Weg schon machen, du wirst es sehen. Alles, was ich wissen muss, kann man lernen.«
Daraufhin war er still. Später jedoch sollte er derjenige sein, der fast vor Stolz platzte und überall mit seiner Tochter angab, die ihr Hebammenexamen bestanden hatte.
Als Letzte suchte ich meine Patentante auf, die nicht nur den Vorzug hatte, eine äußerst liebenswürdige Person zu sein, sondern praktischerweise in Kirchfeld wohnte, auf jenem Bergbauernhof, von dem meine Mutter stammte. Das würde mir später bestimmt sehr nützlich sein.
»Was? Hebamme möchtest werden?«, fragte sie mit verklärtem Blick. »Das wäre auch mein Traum gewesen.
Aber als ich das daheim auszusprechen wagte, hieß es: ›Schlag dir den Blödsinn aus dem Kopf. Auf dem Hof gibt’s genug Arbeit für dich.‹ Arbeit hat es wirklich genug für mich gegeben, tagaus, tagein. So hab ich mich auf dem Hof verschleißen lassen, erst von meinen Eltern, später von meinem Bruder. Ein eigenes Leben hab ich nie führen dürfen. Jetzt, wo ich für die schwere Arbeit nicht mehr tauge, kann ich froh sein, dass mir noch das Gnadenbrot bleibt.«
Eine so lange Rede hatte ich bei dieser stillen, bescheidenen Tante noch nie erlebt. Völlig überrascht sagte ich zu ihr: »Das hab ich ja gar nicht gewusst, dass du hast Hebamme werden wollen.«
»Nein, außer meinen Eltern hat das niemand gewusst. Mit der Zeit hab ich gelernt, meinen Wunsch zu begraben. Aber grad eben, wo du gesagt hast, du willst Hebamme werden, kam’s mir vor, als wärst du eine verjüngte Ausgabe von mir. Mir ist, als wärst dazu berufen, meinen Traum zu verwirklichen. Deshalb helf ich dir dabei, wo ich nur kann. Jetzt nehm ich erst mal dein Dirndl für die anderthalb Jahre, und nachher, wenn du fertig bist, kannst jederzeit auf mich zählen.«
Ich hätte mir keine wertvollere Unterstützung wünschen können.
In der Hebammenschule
Der Stein war ins Rollen gekommen. Ich war froh, dass alles ohne mein weiteres Zutun lief, aber meine Aufregung wuchs von Tag zu Tag. Als ich dann ein Schreiben von der Hebammenlehranstalt erhielt, öffnete ich es mit zitternden Händen. Darin wurde ich aufgefordert, mich zu dem angegebenen Datum zur Aufnahmeprüfung einzufinden.
Es war ein schöner Maitag, als ich in Salzburg ankam. Ich war noch nie dort gewesen, aber an diesem besonderen Tag hatte ich auch keine Augen für die Schönheiten dieser Stadt. Für mich gab es nur ein Ziel: die Hebammenlehranstalt, und überpünktlich traf ich dort ein. Als ich mich zwischen all den jungen Dingern, die gerade der Schule entwachsen waren, wiederfand, kam ich mir mit meinen mehr als achtundzwanzig Jahren schon ein bisschen fehl am Platze vor und war erleichtert, schließlich auch noch einige Frauen zu entdecken, die etwa in meinem Alter sein mussten.
Wir wurden in einen großen Saal geführt und einzeln an Tische gesetzt. Wieder überfiel mich heftiges Herzklopfen. Auf was hatte ich mich da nur eingelassen, fragte ich mich, doch gottlob wurden meine Gedanken bald auf andere Dinge gelenkt, auf den Fragebogen nämlich. Erneut fiel mir ein Stein vom Herzen, als ich entdeckte, dass die Aufgaben bei Weitem nicht so schwer waren, wie ich mir das ausgemalt hatte. Es wurde Wissen in den üblichen Schulfächern wie Geschichte, Geografie und Biologie abgefragt; wir mussten einen Aufsatz schreiben, um unsere Ausdrucksfähigkeit zu prüfen, und ein paar Mathematikaufgaben lösen, und das war’s auch schon.
Bangen Herzens wartete ich das Ergebnis ab, und als nach sechs Wochen der ersehnte Brief kam, konnte ich es kaum glauben, dass ich wirklich und wahrhaftig angenommen war. Der Lehrgang würde Mitte Juli beginnen.
Am Vortag des Kursbeginns reiste ich mit meinem Köfferchen an, das fast alles enthielt, was ich an Kleidung außer den Sachen, die ich auf dem Leib trug, besaß: zwei Kleider, zwei Nachthemden, ein bisschen Unterwäsche, ein Paar Hausschuhe, zwei Paar Strümpfe, ein Paar Schuhe und dazu zwei Frotteetücher. Bitter wenig für die nächsten anderthalb Jahre! Ich räumte meine bescheidenen Habseligkeiten in den schmalen Kleiderschrank in dem kleinen Zimmer, das man mir im Internat zugewiesen hatte und das ich mit einer Mitschülerin teilte. Alle Kursteilnehmerinnen wohnten hier, das war obligatorisch selbst für jene Mädchen, die aus der Umgebung stammten.
Doch die meisten kamen ohnehin aus ganz anderen Ecken des Landes, und ich wertete dies als Zeichen, dass die Salzburger Anstalt wirklich einen sehr guten Ruf genießen musste. Um die Konzentration der Schüler auf den Lehrplan zu erhöhen, bestand für die ersten drei Monate eine Reisesperre. Keine von uns durfte nach Hause, was ich zunächst meiner Kinder wegen nur schwer akzeptieren konnte, doch bald erkannte ich, dass es eine sinnvolle und berechtigte Vorschrift war, die sowohl die Lernergebnisse als auch das Gemeinschaftsgefühl steigerte.
Der Kurs wurde offiziell eröffnet durch den Leiter der Schule, zugleich Chefarzt oder, wie es in Österreich heißt, Primarius der Frauenklinik, der einen kurzen Begrüßungsvortrag hielt, in dem er auf die Bedeutung unseres Berufes und auf die enorme Verantwortung hinwies, die in unsere Hände gelegt werden würde.
Anschließend ging es gleich zur Sache, denn die Schulhebamme erteilte uns theoretischen Unterricht. Schon am ersten Tag schwirrte es in meinem Kopf nur so von Fremdwörtern, die mir doch sehr zu schaffen machten – in dieser Hinsicht hatte ich eine deutlich schlechtere Ausgangsposition als meine Mitschülerinnen, die zum großen Teil das Gymnasium besucht hatten. Mit meiner unvollständigen Volksschulbildung kam ich dagegen ganz schön ins Schleudern. Erneut überfielen mich Bedenken, ob ich das alles wirklich packen würde.
Nur nicht den Kopf hängen lassen, machte ich mir selbst Mut und nahm mir nach dem Unterricht entschlossen mein Lehrbuch vor. Ich wollte es allen beweisen, dass so eine »Alte« wie ich, die zudem nur eine mehr als lückenhafte Schulbildung besaß, durchaus mithalten konnte. Meine Mitschülerinnen und Lehrer sollten es merken, meinem Vater wollte ich beweisen, was in mir steckte, und nicht zuletzt mir selbst. Ich kannte nur noch das eine Ziel: Ich wollte, ich musste Hebamme werden.
In den ersten vier Wochen hatten wir nur theoretischen Unterricht und bekamen keinen Kreißsaal von innen zu sehen. Mit der Zeit machte mir das Lernen immer mehr Spaß, und bereits nach einem Monat hatte ich meine jüngeren Kurskolleginnen überflügelt, was zu einem guten Teil daran gelegen haben mag, dass viele der jungen Mädchen, im Unterschied zu mir, nicht nur Lernen im Kopf hatten. Sie hatten sich zumeist, nach Absprache mit den Eltern, für den Hebammenberuf als eine Möglichkeit unter vielen entschieden – Berufung aber war es bei ihnen nicht, noch nicht zumindest.
Überhaupt hatte ich aufgrund meiner Vorgeschichte eine ganze Reihe Vorteile. Ich war bereits an selbständiges Arbeiten gewöhnt, hatte Erfahrung im Haushalt und mit Kindern – und ich konnte nähen. Dieser Umstand kam mir sehr zugute, als uns einfach Stoff in die Hände gedrückt wurde, aus dem wir uns unsere Ausstattung nähen mussten: Kittel, Schürzen und Hauben. Macht mal, hieß es einfach.
Überhaupt mussten wir alles in eigener Regie und nach einem streng geregelten Arbeitsplan erledigen, was in den Zimmern und Gemeinschaftsräumen so anfiel. Lediglich um das Essen brauchten wir uns nicht zu kümmern, weil das von der Krankenhausküche geliefert wurde.
Nach vier Wochen stiegen wir in die Praxis ein. Die vierzehn Kursteilnehmerinnen wurden aufgeteilt auf fünf Bereiche: Kreißsaal, Säuglingsstation, Wochenstation, Operationssaal und Gynäkologie, wobei wir in letzterer allerdings die kürzeste Zeit verbrachten. Mit Absicht, denn dort gehörten Schwangerschaftsabbrüche zum Alltag, obwohl es so etwas offiziell nicht gab. Es wurden jedoch immer wieder junge Frauen und Mädchen mit mysteriösen Blutungen eingeliefert, die entweder selbst an sich herumgepfuscht oder sich in die Hände einer sogenannten Engelmacherin begeben hatten. In der Klinik blieb dann nichts anderes übrig, als fachmännisch eine Ausschabung vorzunehmen, um noch größeren gesundheitlichen Schaden zu verhindern.
Allerdings war der Leiter dieser Abteilung der Ansicht, die Hebammenschülerinnen sollten nicht zu viel von diesen Leben zerstörenden Dingen mitbekommen.
Unser Berufsbild sei schließlich darauf ausgerichtet, neuem Leben den Weg in die Welt zu bahnen, es zu erhalten und zu schützen. Andererseits hielt er es jedoch für wichtig, dass wir auch diese Seite menschlichen Lebens kennenlernten.
»Denn«, so dozierte er, »es wird einer jeden von euch passieren, dass an sie ein solches Ansinnen gestellt wird. Man wird euch bitten, kaum begonnenes Leben zu vernichten. Dann heißt es, stark zu sein.« Außerdem wies er uns gern immer wieder darauf hin, mit welchen Argumenten man die werdende Mutter zum Austragen des Kindes bewegen und welche konkreten Hilfen man den verzweifelten Frauen anbieten könne.
Besonders beliebt und spannend war natürlich der Dienst im Kreißsaal – auch für mich, denn jetzt erlebte ich die Ereignisse dort von der anderen Seite. Vier von uns waren jeweils den verschiedenen Hebammen zugeteilt und hatten im ersten halben Jahr im Wesentlichen nichts anderes zu tun, als aufmerksam zuzuschauen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Irgendwann aber kam für jede von uns die Stunde der Wahrheit, denn nun hieß es, die erste Entbindung selbstständig vorzunehmen.
Dazu gehörten die Erledigung des Papierkrams und das Zuweisen eines Entbindungsbettes ebenso wie die Untersuchung der Schwangeren, das Abhorchen der kindlichen Herztöne und die hygienische Geburtsvorbereitung. Die Lehrhebamme stand daneben und schaute zu, ob man alles richtig machte und den Ablauf gewissenhaft dokumentierte.
Manchmal lag nur eine Frau im Kreißsaal, meist aber waren es zwei. Die Betten waren nur durch Paravents voneinander abgeteilt, sodass die Gebärenden theoretisch alles mitbekommen konnten, was sich beim Nachbarbett abspielte, doch vermutlich war jede zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf etwas anderes zu achten.
Ich war froh, dass es sich bei meiner ersten Entbindung nicht um eine Erstgebärende, sondern, wie es im Fachjargon so schön heißt, um eine Mehrgebärende handelte, die bereits über eine reiche Erfahrung verfügte und sich demzufolge kaum aus der Ruhe bringen lassen würde. So war es dann auch. Die Presswehen kamen Schlag auf Schlag, und alles ging zügig und glatt vonstatten. Die werdende Mutter atmete perfekt nach Lehrbuch, hechelte wenn nötig und presste, als es an der Zeit war. Mir blieb eigentlich nur die Aufgabe, den Dammschutz zu machen und das Kind aufzufangen. Es war ein runder, gesunder Bub, den ich der glücklichen Mutter präsentieren konnte. Ich wunderte mich über mich selbst, wie ruhig ich gewesen war – bei meinem anschließenden ersten Nabelverband war ich wesentlich nervöser, obwohl ich ihn zur Zufriedenheit meiner Lehrhebamme hinbekam.
Noch heute bin ich davon überzeugt, dass man uns gerade in dieser Salzburger Anstalt eine sehr gute Ausbildung mit auf den Weg gab – nicht nur in fachlicher, sondern ebenso in menschlicher Hinsicht. Dazu gehörte auch eine strenge Erziehung zu Disziplin, Ordnung und Gewissenhaftigkeit – preußische Tugenden in Österreich, möchte man fast sagen. Wie auch immer, ohne Beachtung solcher Spielregeln ist es undenkbar, als Hebamme zu arbeiten, denn in diesem Beruf muss man zur Stelle sein, wenn man gefordert ist. Kinder lassen sich auf ihrem Weg in die Welt nicht vertrösten!
Als ich nach drei Monaten zum ersten Mal heim durfte, erlebte ich eine böse Überraschung. Es war am Vortag von Allerheiligen, es war Abend, und es war dunkel, als ich vor meinem Wohnhaus ankam. Zu meiner Verwunderung stellte ich fest, dass in unserer Wohnung kein Licht brannte. Mein Mann war wohl über seiner Zeitung eingeschlafen, dachte ich mir, denn Fernsehen gab es damals in unserem Tal noch nicht. Da er aber weder auf der Couch noch in seinem Sessel oder im Bett zu finden war, nahm ich an, er sei ins Wirtshaus gegangen, um sich etwas Abwechslung zu verschaffen.
Irgendetwas stimmte jedoch nicht, denn es war kalt und ungemütlich in der Wohnung. Komisch, dachte ich, alles wirkte irgendwie unbewohnt. Ich öffnete den Kleiderschrank und sah gähnende Leere. Nicht nur meine Sachen und die der Kinder waren weg, sondern auch seine Garderobe fehlte. Was hatte das zu bedeuten? Hatte mein Mann mich verlassen? War das der Preis, den ich für mein eigenmächtiges Handeln zahlen musste?
Ich drehte mich auf dem Absatz um, um meine Eltern aufzusuchen und bei dieser Gelegenheit gleich meinen Sohn nach so langer Zeit wiederzusehen. Dort angekommen, erlebte ich die nächste Überraschung, denn wer saß da, zufrieden in seiner Zeitung blätternd, auf dem Kanapee? Mein Angetrauter! Ich erfuhr, dass er kurz nach meiner Abreise daheim die Zelte abgebrochen hatte und zu meinen Eltern übergesiedelt war.
»Was sollte ich allein daheim rumsitzen? Warum sollte ich mir selbst etwas zu essen machen? Hier wird bestens für mich gesorgt«, meinte er. Er hatte wirklich Glück, denn meine Mutter war eine Seele von Mensch. In ihren ohnehin großen Haushalt nahm sie ohne Klage ihren Schwiegersohn zusätzlich auf. Dass ich unter diesen Umständen ebenfalls für ein paar Tage in meinem Elternhaus blieb, war selbstverständlich.
Praktisch wie ich veranlagt war, sagte ich, um dieses Thema zu einem Abschluss zu bringen: »Wenn ohnehin keiner mehr in unserer Wohnung wohnt, wozu sollen wir dann noch Miete zahlen? Also lösen wir sie auf.«
»Und wo sollen wir wohnen, wenn du wieder zurück bist?«
»In Kirchfeld. Wenn ich dort arbeite, muss ich auch dort leben. Außerdem ist die alte Wohnung für uns schon lange zu klein.«
Die Möbel stellten wir bei meinen Eltern in der Scheune unter, und ich machte mich auf den Weg nach Kirchberg, wo ja meine Tochter untergebracht war. Bei dieser Gelegenheit bat ich meine Tante sowie meine Freundin, der ich ebenfalls einen Besuch abstattete, sich für mich nach einer neuen Wohnung umzusehen. Aber die Sache ließ sich gar nicht gut an.
In den Weihnachtsfeiertagen erfuhr ich nämlich, dass es um die Wohnungssituation in meinem zukünftigen Wirkungskreis schlecht bestellt sei. An Ostern gab es noch immer nichts Neues. Das war zwar nicht tragisch, weil wir ja noch ein Dreivierteljahr Zeit hatten, aber es war trotzdem nicht gerade ermutigend. Einige Wochen später jedoch erhielt ich einen Brief von meiner Freundin Annemarie, in dem sie von einem kleinen Holzhaus nah am Wildbach berichtete.
Ich musste mich bis zu den Sommerferien gedulden, bis ich es mir anschauen konnte. Es lag wirklich idyllisch, war zwar nicht riesig, verfügte aber immerhin über drei Zimmer, eine Küche und eine Abstellkammer. Das Häusl mit dem Herz in der Tür befand sich draußen auf dem großen Grundstück. Die Miete war erschwinglich, und schon wollte ich den Vertrag unterschreiben.
»Damit du diesen Schritt nicht bereust, muss ich dir noch was sagen«, stoppte die Besitzerin des Anwesens meinen Enthusiasmus.
»Und das wäre?«, fragte ich mit einer Mischung aus Neugier und Bangen.
»Bisher hat meine Schwiegertochter hier gewohnt. Im Mai ist sie dann Hals über Kopf davon.«
»Ja, um Gottes Willen, warum denn?«
»Als die große Schneeschmelze kam und es zudem Tag und Nacht geregnet hat, konnte der Bach die Wassermassen nicht mehr fassen. Er ist über die Ufer getreten, und das Wasser hat das Haus total eingeschlossen. Da ist meine Schwiegertochter in Panik geraten.«
Erleichtert atmete ich auf. Wenn es weiter nichts war! »Das ist anständig von dir, dass du mir das nicht verschwiegen hast. Wie oft kommt denn so was vor?«
»Das lässt sich nicht genau sagen. Das kann in zehn Jahren wieder so weit sein, es kann aber auch zwanzig Jahre dauern. Heuer hatten wir halt extrem viel Schnee, und dazu der viele Regen.«
»Dann nehme ich das Haus.«
Diesen Entschluss sollte ich nie bereuen, denn bereits nach einem Jahr wurde das Bachbett vertieft und das Ufer so befestigt, dass Überschwemmungen so gut wie ausgeschlossen waren. Bevor ich wieder nach Salzburg zurückkehrte, renovierten wir das Häuschen und richteten es ein. Jetzt konnte ich dem Ende meiner Ausbildung gelassen entgegensehen – wir hatten wieder eine Bleibe und noch dazu in meinem künftigen Wirkungskreis.
Die Feuertaufe
Eine Woche vor Weihnachten war der große Tag gekommen. Nachdem wir die Abschlussprüfung bestanden hatten, wurde uns in einer offiziellen Feierstunde unser Diplom überreicht, und wir wurden mit vielen guten Wünschen in den Alltag entlassen. Bei den meisten stand nun das Problem an, Bewerbungen zu schreiben oder auf Ämtern und in Krankenhäusern anzufragen, ob eine Hebamme gebraucht würde. Gott sei Dank, das hatte ich nicht nötig, denn ich wurde ja bereits in meinem künftigen Wirkungskreis sehnsüchtig erwartet. Berghebammen gab es eben nicht mehr allzu viele!
Auf der Heimfahrt am folgenden Tag, als der Zug mich durch die verschneite Landschaft meinem neuen Zuhause entgegen trug, stürzten die verschiedensten Gedanken auf mich ein: Da kommst du als Neuling von der Hebammenschule und wirst gleich auf die Menschheit losgelassen. Du bist vollgestopft mit theoretischem Wissen, aber die Realität, Entbindungen nämlich, hast du nur im geschützten Raum des Krankenhauses und unter der Aufsicht einer Lehrhebamme erlebt. Immer stand ein ganzer Trupp von Fachkräften hinter dir, der im Ernstfall zum Einspringen bereitstand. Jetzt aber würde bald der Tag kommen, an dem ich ganz allein am Bett einer Schwangeren stehen und mir niemand mehr die Verantwortung abnehmen würde. Plötzlich stürzten mir Tränen aus den Augen, denn mit einem Mal hatte ich Angst, mir zu viel vorgenommen zu haben. Selbst heute noch, wenn ich an diese Situation zurückdenke, muss ich mit den Tränen kämpfen.
Gewiss, ich hatte es nicht anders gewollt, sondern mich vollkommen freiwillig in das Abenteuer »Hebamme« gestürzt, sogar gegen viele Warnungen. Mir selbst und auch allen anderen hatte ich es beweisen wollen, dass ich dazu in der Lage war, die Ausbildung durchzustehen.
Vor allem aber hatte ich mir den Wunsch nach meinem Traumberuf erfüllen wollen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich geglaubt, mein Ziel wäre erreicht, sobald ich das Diplom in Händen hielt. Nun wurde ich mir dessen bewusst, dass ich erst am Anfang stand – das Diplom besagte alles und nichts. Vermutlich war man in diesem Beruf nie am Ziel, denn jede Geburt war anders, würde ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Ich konnte mir nie sicher sein, durfte nie in Routine erstarren. Jedes Mal würde ich von neuem vor eine Aufgabe gestellt, die ich ganz allein bewältigen musste. Sicher, es gab den Gemeindearzt oder andere niedergelassene Ärzte, die ich in kritischen Fällen hinzuziehen konnte oder sogar musste. Es gab Kliniken, wenn ich mit meinem Latein am Ende war. Aber in jedem einzelnen Fall lag es an mir, eine Entscheidung zu treffen.
Mein Stimmungstief verschwand angesichts der herzlichen Begrüßung durch den Bürgermeister des Ortes, dem ich stolz mein Diplom präsentierte. Der gute Mann strahlte übers ganze Gesicht und gratulierte mir mit den Worten: »Meine besten Glückwünsche im Namen der ganzen Gemeinde. Wie schön, dass wir wieder eine eigene Hebamme haben. Wir freuen uns auch, dass wir uns in dir nicht getäuscht haben.«
Seine Worte gingen mir runter wie Honig, und ich war stolz und gerührt in einem, als er in meinem Beisein seine Unterschrift auf den vorbereiteten Vertrag setzte, der Anfang Januar in Kraft treten würde. Er enthielt außer den üblichen vertraglichen Regelungen die Klausel, dass ich, sollte in einem Jahr nicht eine gewisse Anzahl von Geburten anfallen, einen finanziellen Ausgleich erhalten würde.
Dann kam eine große Überraschung. Sie zeigte mir, wie wichtig den Gemeindevertretern die neue Hebamme war und welche Wertschätzung man mir entgegenbrachte. Der Bürgermeister öffnete einen Schrank, entnahm ihm ein großes, in Packpapier eingeschlagenes Paket und stellte es vor mich auf den Schreibtisch.
»Mit den besten Wünschen von der Gemeinde«, sagte er feierlich, »damit du immer alles zur Hand hast, was du für die kleinen neuen Mitbürger brauchst.«
Weil ich noch zögernd dastand, ermunterte er mich, das Paket aufzumachen. Ich war überwältigt, denn vor mir stand ein funkelnagelneuer Hebammenkoffer aus braunem Leder mit Schnappverschluss, so wie ich ihn von der Hebamme aus meiner Kindheit kannte. So ein Ding kostete ein Vermögen! Wie oft hatte ich in Salzburg vor dem Schaufenster des Sanitätshauses gestanden und mir diese Koffer angeschaut. Immer wieder hatte ich überlegt, wie viele Monate ich wohl daran abzahlen müsste, und nun stand ein solches Prachtstück vor mir! Ein Blick ins Innere überzeugte mich davon, dass die Gemeinderäte nicht gespart hatten, denn die Tasche war wirklich mit dem Neuesten und Besten ausgestattet, was es an Instrumenten zur damaligen Zeit gab.
Bevor ich mich zum Gehen anschickte, zog mich der Gemeindevorsteher vor eine Gebietskarte, die an der Wand hing und in der sämtliche Ortsteile, Weiler und Höfe eingezeichnet waren. »Hier hast du einen Überblick über deinen künftigen Wirkungskreis«, erläuterte er. »Damit du weißt, was auf dich zukommt.«
Aufmerksam studierte ich die Karte, und er gab mir einige zusätzliche Erklärungen. Kirchfeld lag in einem relativ engen Tal, in dem sich mehrere Dörfer wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten. Die drei nördlichsten Dörfer bildeten den Sprengel, für den ich ab Januar zuständig war. Sie lagen auf einer Meereshöhe von zwischen neunhundert und elfhundert Metern. Kirchfeld, mein Wohnort, war der mittlere der drei Orte. Bergauf lag Oberach am Ende des Tales, das hier einen Kessel bildete, und Unterach war das unterste der drei Dörfer, und von hier ging es weiter abwärts zu der engen Klamm, die den einzigen Ausgang aus dem Tal bildete und die sich die Ache in vielen Jahrtausenden gegraben hatte.
In jedem Dorf zweigten Seitentäler ab, die ebenfalls vor Urzeiten durch Wildwasser entstanden waren. Auf der Suche nach Siedlungsraum hatten sich unsere Vorfahren sehr weit in diese Täler hineingewagt, und somit gehörten zu meinem Einzugsbereich viele versprengte Siedlungen und schwer zugängliche Einzelgehöfte.
Von meinem heimatlichen Tal, das ähnlich strukturiert war, wusste ich, dass ich beachtlichen klimatischen Unterschieden ausgesetzt sein konnte. Wenn im untersten Dorf längst der Frühling eingezogen war, konnte in den oberen Seitentälern noch tiefster Winter herrschen – darauf würde ich mich einstellen müssen, hinsichtlich meiner Kleidung und meiner Fortbewegungsmittel.
Überglücklich eilte ich mit meinem Hebammenkoffer in unser neues Zuhause. Mit den Worten: »Da, schau her«, stellte ich ihn vor meinen Mann hin und hielt ihm mit stolzgeschwellter Brust meinen Vertrag unter die Nase.
»Na, dann viel Glück«, knurrte er nur.
Wenn er auch meine künftige Berufstätigkeit missbilligte, so gelang es mir doch, ihm das Versprechen abzuringen, dass er meine Patentante verständigen würde, sollte ich unerwartet zu einer Entbindung gerufen werden, ohne für die Kinder selbst noch entsprechende Vorkehrungen treffen zu können.
Im Dorf sprach es sich offenbar schnell herum, dass wieder eine Hebamme da war, denn bereits am nächsten Tag stand ein fremder Mann vor meiner Tür, der sich als Schreinermeister vorstellte und mir mit besten Wünschen ein in Zeitungspapier eingewickeltes Etwas überreichte. Neugierig packte ich es aus und entdeckte ein helles Holzschild, auf dem in akkuraten Lettern das Wort »Hebamme« eingebrannt war. Als ich mich herzlich dafür bedankte, wehrte er verlegen ab: »Ach, nicht der Rede wert. Wir alle freuen uns, dass wir wieder eine Hebamme haben. Damit dich auch jeder findet, hab ich das Schild gemacht.«
»Das ist aber sehr aufmerksam von dir, dass du so an deine Mitbürger denkst.«
»Na ja, ein bisschen Eigennutz ist auch dabei. Ich wollte einen guten Eindruck bei dir machen. Ich bin frisch verheiratet, und es kann sein, dass wir dich irgendwann mal brauchen.«
Ich musste lachen über die entwaffnende Ehrlichkeit des freundlichen Schreinermeisters und bat ihn gleich noch darum, das Schild anzubringen. »Könntest du mir das Schild gleich aufhängen? Mein Mann macht das bestimmt nicht. Und mit Hammer und Nagel kann ich nicht so gut umgehen.«
»Aber das macht man doch nicht mit Hammer und Nagel«, belehrte er mich. »Das macht man mit Schrauben.« Dabei zog er, als ob er auf diesen Auftrag nur gewartet hätte, zwei Schrauben nebst Schraubenzieher aus seiner Hosentasche und befestigte das Schild direkt neben meiner Haustür.
So begann ich meine Hebammenlaufbahn mit nichts als einem Diplom, einem Schild und einer Hebammentasche. Ich besaß weder ein Telefon noch ein Auto; lediglich ein altersschwaches Fahrrad nannte ich mein Eigen, das mich zu meinen Einsätzen bringen sollte.
Zunächst aber standen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, die ersten im neuen Heim, und ich war glücklich, sie mit meinen Kindern verbringen zu können, die sich sichtlich freuten, dass ihre Mama wieder zu Hause war. Je näher es jedoch auf den ersten Januar zuging, desto mulmiger wurde mir zumute. Einerseits konnte ich es nicht erwarten, zu meiner ersten Entbindung gerufen zu werden, um mein erlerntes Wissen endlich unter Beweis stellen zu können, andererseits hatte ich eine panische Angst davor, plötzlich ganz allein eine so große Verantwortung zu tragen.
Jeden Morgen, den der Herrgott kommen ließ, dachte ich zitternd: Hoffentlich heute noch nicht. So reihte sich ein Tag an den anderen, und nichts geschah. Weil mir das wiederum auch nicht recht war, betete ich abends: »Lieber Gott, schick mir bald eine Entbindung«, um dann am nächsten Morgen erneut in meine alte Zauderei zu verfallen: »Lieber Gott, heute noch nicht«, flehte ich, weil ich mich aufs Neue unsicher fühlte.
Solch widersprüchliche Gebete müssen selbst den Herrgott verwirrt haben, denn der ganze Januar verging, ohne dass etwas geschah. Ich saß tatenlos herum, beruflich gesehen, und starrte mein Diplom an, das sorgfältig eingerahmt im Wohnzimmer an der Wand hing und