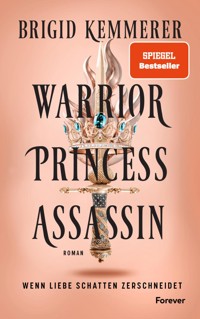13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Emberfall-Reihe
- Sprache: Deutsch
Einst war Emberfall ein mächtiges Königreich. Dann lud der junge Prinz Rhen einen schrecklichen Fluch auf sich. Seither muss er innerhalb eines Jahres ein Mädchen finden, das ihn auf ewig liebt. Gelingt es ihm nicht, verwandelt er sich in eine Bestie, und das Mädchen muss sterben. Jahr für Jahr. Bis er Harper auserwählt, ein Mädchen aus dem heutigen Washington D.C., das schon mit ganz anderen Kerlen fertiggeworden ist. Zornig und mutig bekämpft sie ihn – bis sie den wahren Rhen erkennt. Aber wird ihre Liebe reichen, um sie beide vor dem Tod zu bewahren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
»Harper, bitte – bitte glaub mir. Ich habe alles Erdenkliche versucht, um diesen Fluch zu brechen. Ich habe sogar versucht, mich selbst zu zerstören.« Sie mustert mich. Und dann, weil das Schicksal mich in dieser Jahreszeit anscheinend gern überrascht, macht sie einen Schritt auf mich zu, presst ihr Gesicht an meine Brust und schlingt die Arme um meine Taille.
Gerade war Harper noch in Washington D.C. und sorgte sich um ihre kranke Mutter und um ihren Bruder, der Geschäfte mit den falschen Leuten gemacht hat. Im nächsten Moment findet sie sich im magischen Reich von Emberfall wieder, in einem prächtigen Schloss. Der junge Herrscher Rhen hat sie entführen lassen. Sie soll ihn von einem gefährlichen Fluch erlösen. Doch die selbstbewusste Harper hat wenig Lust, die Märchenprinzessin zu spielen, sie will wieder nach Hause, um ihrer Familie zu helfen. Rhen muss erkennen, dass es mehr als Glitzer und Reichtum braucht, um Harpers Meinung zu ändern. Aber wenn er ihr Herz nicht erobern kann, sind seine Untertanen verloren – und auch Harper muss sterben …
Die Autorin
Brigid Kemmerer ist eine New-York-Times-Bestsellerautorin. Sie hat bereits mehrere Jugendbücher veröffentlicht. »Ein Fluch so kalt und ewig« ist der Auftakt zu ihrer neuen Bestseller-Trilogie aus der magischen Welt von Emberfall. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren vier Jungen in der Gegend um Baltimore.
Brigid Kemmerer
Roman
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel A Curse so Dark and Lonely bei Bloomsbury YA, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte sind vorbehalten. Printed in Germany
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung des Designs von © Jeanette Levy und der Illustration von © Shane Rebenschied
Karte: © Andreas Hancock
Vignetten: © Shutterstock (Thoom, ElenaShow)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Abiling
ISBN: 978-3-641-24576-4V002
Für meine neue Familie bei Stone Forge CrossFit.
Danke, dass ihr mir gezeigt habt, wie viel stärker ich sein kann.
1 RHEN
Da ist Blut unter meinen Fingernägeln. Ich frage mich, wie viele von meinen Leuten ich dieses Mal getötet habe.
Entschlossen tauche ich die Hände in das Fass neben den Ställen. Das eiskalte Wasser beißt in meine Haut, aber das Blut geht nicht ab. Das bräuchte mich nicht zu kümmern, weil es in einer Stunde sowieso weg sein wird, aber ich hasse es. Das Blut. Die Ungewissheit.
Irgendwo hinter mir sind Hufschläge auf dem Kopfsteinpflaster zu hören, begleitet vom Klirren eines Zaumzeugs.
Ich muss nicht hinsehen. Mein Wachkommandant folgt mir immer in sicherer Entfernung, bis die Verwandlung abgeschlossen ist.
Wachkommandant. Als ob Grey noch Männer zum Kommandieren hätte.
Als ob ihm der Titel nicht mangels Konkurrenz selbst zugefallen wäre.
Ich streife das Wasser von meinen Händen und drehe mich um. Grey steht ein paar Meter entfernt und hält Ironheart, das schnellste Pferd im Stall, am Zügel. Das Tier atmet schwer, Brust und Flanken sind trotz der frühmorgendlichen Kühle schweißnass.
Obwohl wir hier schon lange festsitzen, ist Greys Erscheinung trotzdem eine fortwährende Überraschung: Er sieht noch genauso jung aus wie an dem Tag, als er einen Posten in der elitären Königsgarde erhalten hat. Sein dunkles Haar ist leicht zerzaust, sein Gesicht faltenlos. Die Uniform passt ihm immer noch gut, jede Schnalle, jeder Riemen sitzt perfekt, jede Waffe glänzt in der Dämmerung.
Einst trug er Feuereifer im Blick, glitzerndes Verlangen nach Abenteuer und Herausforderung.
Das alles ist längst verschwunden – aber das ist schon das Einzige an ihm, was der Fluch nicht immer wieder aufs Neue herstellt.
Ich frage mich, ob mein unverändertes Aussehen ihn auch erschreckt.
»Wie viele?«, frage ich.
»Keiner. Alle Eure Leute sind für diesmal in Sicherheit.«
Für diesmal. Ich sollte erleichtert sein und bin es nicht. Die Menschen werden schon bald wieder in Gefahr sein. »Und das Mädchen?«
»Weg. Wie immer.«
Ich schaue erneut auf meine blutbefleckten Hände, und eine vertraute Enge schnürt mir den Brustkorb zu. Dann trete ich noch mal an das Fass und tauche meine Hände ins Wasser. Es ist so kalt, dass es mir beinahe den Atem verschlägt.
»Ich bin über und über mit Blut besudelt, Kommandant.« Eine schwache Regung von Zorn breitet sich in mir aus. »Ich muss irgendwas getötet haben.«
Als würde es die Gefahr spüren, stampft und tänzelt sein Pferd am Zügel. Grey streckt die Hand aus, um das Tier zu beruhigen.
Früher wäre ein Stallbursche herbeigeeilt, um das Pferd zu übernehmen. Einst gab es ein Schloss voller Höflinge und Geschichtsschreiber und Ratgeber, die für ein bisschen Klatsch und Tratsch über Prinz Rhen, den Thronerben von Emberfall, sogar bezahlt hätten. Früher gab es eine Königsfamilie, die über meine Eskapaden die Stirn gerunzelt hätte.
Doch jetzt gibt es nur noch mich und Grey.
»Ich habe eine Spur Menschenblut auf dem Pfad hinterlassen, der aus dem Wald führt«, sagt er, ungerührt von meinem gereizten Ton, der ihm bereits vertraut ist. »Das Pferd hat eine sinnlose Verfolgungsjagd angeführt, bis Ihr im südlichsten Teil Eures Territoriums auf eine Herde Hirsche gestoßen seid. Von den Dörfern haben wir uns ferngehalten.«
Das erklärt den Zustand des Pferds. Wir haben heute Nacht eine weite Strecke zurückgelegt.
»Ich übernehme das Pferd«, sage ich. »Die Sonne wird bald aufgehen.«
Grey gibt mir die Zügel. Diese letzte Stunde ist immer die schwerste. Voller Bedauern über mein erneutes Scheitern. Wie immer wünsche ich mir nur noch, es wäre vorbei.
»Irgendwelche besonderen Wünsche, Mylord?«
Ganz am Anfang war ich leichtfertig genug, darauf mit Ja zu antworten. Ich habe mir Blonde oder Brünette gewünscht. Große Brüste, lange Beine oder eine schmale Taille. Ich habe ihnen Wein eingeschenkt und umwarb sie, und wenn sie mich nicht geliebt haben, war rasch eine andere gefunden. Anfangs war mir der Fluch noch wie ein Spiel erschienen.
Such mir eine, die dir gefällt, Grey, pflegte ich lachend zu sagen, als wäre es ein Privileg, Frauen für seinen Prinzen zu finden.
Dann veränderte ich mich, und das Ungeheuer wütete im Schloss und hinterließ ein Blutbad.
Als all das aber von vorne begann, hatte ich keine Familie mehr. Keine Dienerschaft. Nur noch sechs Wachen, zwei davon schwer verletzt.
Beim dritten Versuch war mir nur noch einer geblieben.
Grey wartet auf eine Antwort. Ich sehe ihm in die Augen. »Nein, Kommandant. Jede ist recht.« Seufzend führe ich das Pferd in Richtung der Stallungen, doch dann bleibe ich noch mal stehen und drehe mich um. »Wessen Blut war das auf dem Pfad?«
Grey hebt einen Arm und schiebt den Ärmel zurück. Aus einer langen Schnittwunde tropft immer noch Blut auf seine Hand. Ein dünnes dunkelrotes Rinnsal.
Ich gebe ihm die Anweisung, sich zu verbinden, aber in einer Stunde, wenn die Sonne aufgegangen ist, wird die Wunde ohnehin verschwunden sein.
Genauso wie das Blut an meinen Händen und der Schweiß auf den Flanken des Pferds. Das Kopfsteinpflaster wird sich von den Strahlen der Morgensonne erwärmen und mein Atem nicht mehr als Wölkchen zu sehen sein.
Grey wird ein neues Mädchen bringen, und das alles wird erneut beginnen.
Es wird wieder Herbst sein. Die Jahreszeit wird von Neuem anfangen – der Beginn eines neuen Versuchs.
Ich werde wieder achtzehn.
Zum 327. Mal.
2 Harper
Washington, D. C., ist so kalt, dass es verboten gehört.
Bibbernd ziehe ich mir die Kapuze meines Sweatshirts über den Kopf, aber der Stoff ist so fadenscheinig, dass es nicht viel nützt. Ich hasse es, hier draußen Wache zu schieben, aber mein Bruder muss den schlimmeren Job erledigen, also will ich mich nicht beschweren.
Irgendwo die Straße runter schreit ein Mann, und ein Auto hupt. Ich unterdrücke ein Schaudern und drücke mich noch tiefer in den Schatten. Ich habe vorhin einen alten Hebel zum Reifenmontieren im Rinnstein gefunden. Wer auch immer den verloren hat, scheint weit weg zu sein, also umklammern jetzt meine Finger das rostige Metall.
Ein Blick auf den Timer von Jakes Handy sagt mir, dass ihm noch dreizehn Minuten bleiben. Dreizehn Minuten, dann ist er fertig, und wir können uns einen Kaffee kaufen.
Eigentlich haben wir kein Geld dafür übrig, aber Jake braucht immer Zeit zum Runterkommen, und er meint, Kaffee würde da helfen. Mich dagegen putscht er so auf, dass ich nicht schlafen kann, bis vier Uhr morgens wach liege und dann die Schule verpasse. Aber ich habe in meinem letzten Jahr an der Highschool schon so viele Tage verpasst, dass es darauf wahrscheinlich auch nicht mehr ankommt. Jedenfalls habe ich keine Freunde, die mich vermissen werden.
Jake und ich werden also in einer Ecknische des Diners sitzen, das die ganze Nacht über offen hat. Ein paar Minuten lang werden seine Hände, mit denen er den Kaffeebecher hält, zittern. Dann wird er mir erzählen, was er tun musste. Und das ist nie etwas Gutes.
Ich musste drohen, ihm den Arm zu brechen. Ich hab ihn ihm auf den Rücken gedreht. Ich glaube, ich hab ihn beinahe ausgekugelt. Seine Kinder waren da. Es war schrecklich.
Ich musste ihn schlagen. Hab ihm gesagt, dass ich ihm auch einen Zahn ausschlagen würde. Er hat das Geld dann echt schnell gefunden.
Der Typ war ein Musiker. Ich hab ihm gedroht, einen seiner Finger zu zerquetschen.
Ich will nicht hören, wie er die Leute schüttelt, bis Bargeld rausfällt. Mein Bruder ist groß und gebaut wie ein Linebacker beim Football. Aber er war immer sanftmütig, leise und freundlich. Als Mom zum ersten Mal krank wurde und Dad sich mit Lawrence und seinen Männern eingelassen hat, da passte Jake auf mich auf. Er ließ mich in seinem Zimmer schlafen oder schmuggelte mich für ein Eis aus dem Haus. Damals war Dad noch da und wurde selbst von Lawrence’ Geldeintreibern bedroht, die an unserer Tür aufgetaucht sind, um das Geld zurückzuverlangen, das Dad sich geliehen hatte.
Inzwischen ist Dad nicht mehr da. Und Jake spielt den Geldeintreiber nur, um uns die Kerle vom Hals zu halten.
Schuldgefühle nagen an mir. Wenn es nur für mich wäre, würde ich ihn das nicht tun lassen.
Aber er macht es nicht nur für mich. Sondern auch für Mom.
Jake denkt, er könne bei Lawrence mehr bewirken. Uns einen Aufschub verschaffen. Aber das würde bedeuten, dass er die Dinge wirklich tun müsste, die er bisher nur androht. Dass er Leute tatsächlich verletzen müsste.
Das würde ihm das Herz brechen. Ich sehe schon, wie ihn selbst all das jetzt verändert. Manchmal wünsche ich mir, er würde seinen Kaffee schweigend trinken.
Als ich das einmal zu ihm gesagt habe, wurde er sauer. »Du denkst, es sei hart, dir das anzuhören? Ich muss es machen.« Seine Stimme klang dabei so hart und angespannt und brach fast. »Du hast Glück, Harper. Du hast Glück, dass du es dir nur anhören musst.«
Yeah. Ich fühle mich wie ein echter Glückspilz.
Aber dann komme ich mir egoistisch vor, weil er ja recht hat. Ich bin weder schnell noch stark. Wacheschieben ist die einzige Hilfe, die er mir erlaubt. Wenn er jetzt über diese angedrohten Gemeinheiten reden muss, halte ich die Klappe. Ich kann zwar nicht zuschlagen, aber zuhören.
Noch ein Blick auf das Handy. Zwölf Minuten. Wenn seine Zeit abgelaufen ist, bevor er wieder hier ist, bedeutet das, der Job ist schiefgegangen und ich soll loslaufen, Mom holen und mich mit ihr verstecken.
Manchmal bleiben uns nur noch drei Minuten. Oder zwei. Aber er taucht immer auf, keuchend und manchmal blutbespritzt.
Ich mache mir daher noch keine Sorgen.
Rost blättert unter meinen Fingern ab, während ich das eiskalte Werkzeug umklammere. Die Sonne müsste bald aufgehen, aber wahrscheinlich bin ich bis dahin schon zu durchgefroren, um das überhaupt zu merken.
Da erklingt in der Nähe das helle Lachen einer Frau, und ich spähe aus dem Hauseingang. Zwei Leute stehen allein an einer Ecke, am Rand des Lichtkreises, den eine Straßenlaterne wirft. Das Haar des Mädchens schimmert wie in einer Shampoowerbung und schwingt, als sie einen etwas unbeholfenen Schritt zur Seite macht. Um drei Uhr morgens sind alle Bars geschlossen, aber das kümmert sie eindeutig nicht. Ihr Mikro-Minirock und die offene Jeansjacke geben mir das Gefühl, mein Sweatshirt sei ein dicker Anorak.
Der Mann ist eher passend zum Wetter gekleidet, in dunklen Klamotten und einem langen Mantel. Ich versuche zu erkennen, ob er ein Cop ist, der eine Nutte hochnimmt oder ein Freier auf der Suche nach einem Date, als der Kerl plötzlich den Kopf dreht. Ich ducke mich zurück in den Hauseingang.
Wieder hallt ihr Lachen durch die Straße. Entweder ist er urkomisch oder dieses Mädchen betrunken.
Mit einem Keuchen verstummt das Lachen. Als hätte jemand einen Stecker gezogen.
Ich halte den Atem an. Die Stille kommt so plötzlich und umschließt alles.
Ich kann nicht riskieren hinzusehen.
Ich kann aber auch nicht riskieren, nicht hinzusehen.
Jake wäre so sauer, schließlich habe ich hier einen Job zu erledigen. Ich stelle mir vor, wie er schreit: Misch dich nicht ein, Harper! Du bist sowieso schon so leicht angreifbar!
Da hat er recht, aber die Zerebralparese beeinträchtigt meine Neugier nicht. Ich spähe aus dem Hauseingang hervor.
Die Blondine ist wie eine Marionette in die Arme des Mannes gefallen, ihr Kopf hängt zur Seite. Er schiebt einen Arm unter ihre Kniekehlen und blickt immer wieder die Straße hinauf und hinunter.
Jake wird ausrasten, wenn ich die Cops rufe. Schließlich ist das, was er tut, auch nicht legal. Wenn die Polizei auftaucht, ist Jake in Gefahr. Bin ich in Gefahr. Ist Mom in Gefahr.
Ich starre weiter auf die blonde Haarflut und den schlaffen Arm, der den Boden streift. Er könnte ein Dealer sein. Sie könnte tot sein – oder nah dran. Ich kann nicht einfach nichts tun.
Zuerst schlüpfe ich aus meinen Sneakern, damit mein blöder linker Fuß kein Schleifgeräusch auf dem Asphalt macht. Ich kann schnell sein, wenn ich will – aber leise zu sein, das fällt mir echt schwer. Jetzt stürme ich los und hebe das Eisenwerkzeug, das ich vorhin gefunden habe.
Er dreht sich in der letzten Sekunde um, was ihm wahrscheinlich das Leben rettet. So trifft ihn das Werkzeug statt auf den Kopf nur an den Schultern. Grunzend taumelt er nach vorn. Das Mädchen fällt der Länge nach aufs Pflaster.
Ich hole mit dem Teil aus, um ihn noch mal zu treffen, aber der Mann fängt sich schneller. Er blockiert meinen Schlag, rammt mir einen Ellbogen in den Brustkorb und zieht mir mit seinem Bein den Fuß weg. Ich falle, bevor es mir richtig bewusst wird. Dann kracht mein Körper auf den Asphalt.
Plötzlich ist er über mir. Ich hole aus, erwische aber nicht seinen Kopf, nur seine Hüfte. Danach seine Rippen.
Er packt mein Handgelenk und schlägt meinen Arm aufs Pflaster. Ich schreie auf und will mich wegdrehen, aber es fühlt sich an, als würde er auf meinem rechten Oberschenkel knien. Sein freier Arm drückt gegen meine Brust. Das tut weh. Sehr sogar.
»Lass die Waffe fallen.« Er spricht mit einem Akzent, den ich nicht zuordnen kann. Und jetzt, wo sein Gesicht direkt über mir ist, merke ich, wie jung er ist, nicht viel älter als Jake.
Ich umklammere den Eisenhebel nur noch fester. Mein Atem erzeugt riesige, zitternde Wolken zwischen uns, die hin und her zucken, als ob sie selbst in Panik wären. Mit meiner freien Hand schlage ich auf ihn ein, aber ich könnte genauso gut eine Statue hauen. Er umklammert mein Handgelenk inzwischen so fest, dass ich zu spüren glaube, unsere Knochen würden sich aufeinander reiben.
Ein Wimmern dringt aus meiner Kehle, doch ich beiße die Zähne zusammen und gebe nicht nach.
»Lass es los«, sagt er hörbar zornig.
»Jake!«, schreie ich in der Hoffnung, inzwischen sei schon so viel Zeit vergangen, dass er sich auf dem Rückweg befinden muss. Das Pflaster sticht eisige Dolche in meinen Rücken. Jeder Muskel schmerzt, aber ich kämpfe weiter. »Jake! Hilfe!«
Ich versuche, mit den Fingernägeln seine Augen zu erwischen, aber als Reaktion wird sein Griff nur noch fester. Unsere Blicke begegnen sich, und ich sehe kein Zögern in seinen Augen. Er wird mir das Handgelenk brechen.
Irgendwo in der Nähe ertönt eine Sirene, aber das wird zu spät sein. Ich versuche noch mal, ihm das Gesicht zu zerkratzen, erwische aber stattdessen seinen Hals. Blut wird unter meinen Nägeln sichtbar, und sein Blick wirkt mörderisch. Hinter ihm wird der Himmel heller, färbt sich rosa mit orangefarbenen Schlieren.
Er hebt seine freie Hand, und ich weiß nicht, ob er mich schlagen, erwürgen oder mir das Genick brechen will. Es spielt auch keine Rolle. Das war’s. Mein letzter Blick wird der auf einen prächtigen Sonnenaufgang sein.
Aber da irre ich mich. Seine Hand schlägt niemals zu.
Stattdessen verschwindet der ganze Himmel.
3 Rhen
Sonnenstrahlen vergolden das Mobiliar meines Wohnraums und werfen Schatten auf die handgefertigten Tapisserien und die Samtsessel, in denen meine Eltern einst saßen. Manchmal, wenn ich lange genug hier sitze, kann ich mir ihre Anwesenheit einbilden. Dann höre ich die schroffe Stimme meines Vaters, voller Tadel und Vorhaltungen, und die leise Missbilligung meiner Mutter.
Ich erinnere mich auch an meine eigene Arroganz.
Am liebsten möchte ich aus dem Schloss laufen und mich von einer Klippe stürzen. Doch das funktioniert nicht. Ich habe es versucht. Mehr als einmal.
Ich wache immer hier auf, in diesem Raum, wo ich im Sonnenschein warte. Das Feuer brennt stets nur noch wenig, so wie auch jetzt. Die Flammen bilden ein vertrautes Muster. Der Steinboden wirkt frisch gewischt, Wein und Trinkpokale stehen auf einem Tischchen bereit. Greys Waffen hängen am Sessel gegenüber und warten auf seine Rückkehr.
Alles ist immer gleich.
Bis auf die Toten. Sie kehren niemals zurück.
Das Feuer knackt, und ein Stück Kleinholz rutscht in der Feuerstelle nach unten. So geschieht das jedes Mal, immer ganz pünktlich. Grey wird also bald erscheinen.
Ich seufze. Die eingeübten Worte liegen mir schon auf der Zunge, obwohl die Mädchen manchmal eine Weile brauchen, um wieder wach zu werden, nachdem Grey sie mit Äther betäubt hat. Anfangs haben sie immer Angst, aber ich habe gelernt, wie man ihnen ihre Furcht nimmt, sie umgarnt und dazu bringt, mir zu vertrauen.
Nur um dieses Vertrauen wieder zu zerstören, wenn aus dem Herbst Winter wird. Wenn sie sehen, wie ich mich verwandle.
Ich spüre einen Luftzug und richte mich gerade auf. So sehr ich den Fluch und die niemals endende Wiederholung meines Lebens hier hasse, die Mädchen sind die einzige Abwechslung. Unwillkürlich bin ich neugierig darauf, was für eine reglose Schönheit heute in Greys Armen hängt.
Doch als Grey erscheint, ringt er ein Mädchen zu Boden.
Sie ist keine reglose Schönheit. Sie ist mager, barfuß und schlägt ihre Fingernägel in seinen Hals.
Grey schlägt fluchend ihre Hand weg. Blut läuft in Rinnsalen über seine Haut.
Ich erhebe mich aus meinem Sessel und bin von der schieren Neuartigkeit der Situation einen Moment lang verwirrt.
»Kommandant! Lass sie los!«
Er springt auf und dann ein Stück zurück. Das Mädchen krabbelt von ihm weg, umklammert dabei aber irgendein rostiges Werkzeug. Ihre Bewegungen sind mühsam und ungeschickt.
»Was soll das hier?« Sie tastet mit einer Hand nach der Wand und kommt schwankend zum Stehen. »Was hast du gemacht?«
Grey packt sein Schwert vom Sessel und reißt es so entschlossen aus der Scheide, wie ich das bei ihm seit … einer Ewigkeit nicht gesehen habe. »Keine Sorge, Mylord. Das könnte der kürzeste Versuch von allen werden.«
Das Mädchen hebt ihr rostiges Eisen, als böte es auch nur die geringste Verteidigung gegen einen ausgebildeten Schwertkämpfer. Dunkle Locken quellen unter ihrer Kapuze hervor, und ihr Gesicht sieht müde, gezeichnet und staubig aus. Ich frage mich, ob Grey sie verletzt hat, weil sie ihr linkes Bein so deutlich entlastet.
»Versuch’s ruhig.« Sie blickt zwischen ihm und mir hin und her. »Ich kenne eine gute Stelle, an der ich dich damit noch nicht getroffen habe.«
»Das werde ich.« Grey hebt seine Waffe und geht auf sie zu. »Ich kenne auch eine gute Stelle, an der ich dich damit noch nicht getroffen habe.«
»Genug.« Ich habe Grey noch nie eines der Mädchen attackieren sehen, aber als er keine Anzeichen macht aufzuhören, schlage ich einen schärferen Ton an. »Das ist ein Befehl, Kommandant.«
Er bleibt stehen, behält aber das Schwert in der Hand und lässt das Mädchen nicht aus den Augen. »Denk bloß nicht«, sagt er mit finsterer Stimme zu ihr, »dass du mich noch einmal angreifen kannst.«
»Keine Sorge«, erwidert sie schnippisch. »Ich warte einfach auf meine Chance.«
»Sie hat dich angegriffen?« Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Grey. Sie ist nur halb so groß wie du.«
»Das gleicht sie mit ihrem Temperament aus. Und sie war keineswegs meine erste Wahl.«
»Wo bin ich hier?« Der Blick des Mädchens springt von mir zu ihm zu dem Schwert in seiner Hand – und dann zur Tür hinter uns. Ihre Fingergelenke werden weiß, so fest umklammert sie die Eisenstange. »Was hast du gemacht?«
Ich werfe Grey einen Blick zu und senke die Stimme. »Tu dein Schwert weg. Du machst ihr Angst.«
Die Königliche Garde ist dazu ausgebildet, ohne Zögern zu gehorchen, und Grey ist da keine Ausnahme. Er schiebt die Waffe zurück in die Scheide, schnallt sich allerdings den Schwertgurt um die Taille.
Ich kann mich nicht erinnern, wann er zuletzt am ersten Tag eines neuen Versuchs voll bewaffnet war. Wahrscheinlich nicht mehr, seit es keine Männer mehr zu befehligen und keine Gefahren abzuwehren gab.
Aber nachdem er sein Schwert weggesteckt hat, hat die Anspannung im Raum etwas nachgelassen. Ich strecke eine Hand aus und spreche mit sanfter Stimme, wie ich sie im Stall bei scheuen Pferden benutze: »Ihr seid hier in Sicherheit. Darf ich Eure Waffe haben?«
Ihre Augen gehen zu Grey, dessen Hand auf dem Schwertknauf ruht. »Niemals.«
»Fürchtet Ihr Grey? Das haben wir gleich.« Ich sehe ihn an. »Kommandant. Du hast den Befehl, diesem Mädchen kein Leid anzutun.«
Er weicht einen Schritt zurück und verschränkt die Arme.
Das Mädchen beobachtet uns, holt dann tief Luft, macht einen zaghaften Schritt nach vorn und hält das Werkzeug vor sich ausgestreckt.
Wenigstens ist sie so leicht zu zähmen wie die anderen. Ich strecke meine Hand aus und sehe sie aufmunternd an.
Sie macht einen weiteren Schritt – aber dann verändert sich ihr Ausdruck, ihre Augen werden dunkel, und sie holt aus.
Harter Stahl kracht direkt unter dem Brustkorb gegen meine Taille. Zur Hölle noch mal, das tut weh. Ich krümme mich und habe kaum Zeit zu reagieren, als sie auf meinen Kopf zielt.
Zum Glück bin ich fast so gut ausgebildet wie Grey. Ich ducke mich und erwische das Eisen, bevor es mich trifft.
Jetzt verstehe ich, warum Grey sofort nach seinem Schwert gegriffen hat.
Ihre Augen glühen vor Trotz. Ich mache einen Satz nach vorn, um ihr das Werkzeug zu entwinden.
Doch sie lässt los, sodass ich zurücktaumele. Dann stolpert sie zur Tür und humpelt keuchend auf den Flur hinaus.
Ich lasse sie fliehen. Die Eisenstange fällt auf den Teppich, und ich presse eine Hand gegen meine Seite.
Grey hat sich nicht gerührt. Er steht immer noch mit verschränkten Armen da. »Wünscht Ihr immer noch, dass ich ihr kein Leid antue?«
Es gab einmal eine Zeit, da hätte er so eine Frage nicht gewagt.
Und es gab einmal eine Zeit, da hätte mich das vielleicht gekümmert.
Jetzt seufze ich nur und zucke zusammen, als meine Lunge sich dehnt und dabei die Prellung an meiner Seite berührt. Was als Neuigkeit begann, tut einfach nur noch weh. Wenn sie jetzt schon so entschlossen kämpft, um zu fliehen, gibt es wenig Hoffnung für später.
Die Schatten sind ein Stückchen weiter gewandert und folgen ihrem vertrauten Weg. Ich habe sie schon Hunderte Male dabei beobachtet.
Wenn dieser Versuch mit einem Scheitern endet, werde ich sie erneut beobachten.
»Sie ist verletzt«, sagt Grey. »Da kann sie nicht weit kommen.«
Er hat recht. Ich vergeude Zeit.
Als hätte ich die nicht in Massen.
»Geh«, sage ich. »Hol sie zurück.«
4 Harper
Ich renne einen langen Flur hinunter, mein Atem brüllt mir in den Ohren. Das hier muss ein Museum oder sonst ein historisches Gebäude sein. Meine Socken finden keinen echten Halt auf dem samtigen Teppich, der über dem Marmorboden liegt. Die Wände sind holzvertäfelt, reichen gemauert aber zu einem hohen Deckengewölbe hinauf. Schwere Holztüren mit schmiedeeisernen Klinken reihen sich in unregelmäßigen Abständen auf dem Flur aneinander, doch keine davon steht offen.
Aber ich halte nicht an, um es bei einer zu versuchen. Ich muss jemand finden, der mir hilft, oder hier alleine rauskommen.
Als ich um eine Kurve biege, stoße ich auf eine weit ausladende Freitreppe, die in eine prachtvolle Eingangshalle führt. Der Raum ist so groß wie die Turnhalle meiner Highschool, aber mit dunklem Schieferboden, massiven Buntglasfenstern und einer eisernen doppelflügeligen Tür. An den Wänden hängen Tapisserien, in denen violettes, grünes und rotes Garn verwebt sind, die aber auch von schimmernden Gold- und Silberfäden durchwirkt sind. An einer Seite stehen Tische beladen mit Torten und Gebäck und Dutzenden Champagnergläsern. Ein halbes Dutzend weißer Stühle mit Vergoldungen steht in einer Ecke, davor liegen Musikinstrumente bereit.
Alles sieht aus wie für eine Hochzeit. Oder für ein anderes Fest. Nichts deutet auf eine Entführung hin.
Ich bin total verwirrt – aber immerhin habe ich eine Tür nach draußen gefunden.
Plötzlich durchdringt ein schrilles Piepen die Stille.
Jakes Timer.
Ich wühle das Handy aus meiner Tasche und starre auf die blinkenden Nullen. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich weiß nicht, ob er es rechtzeitig geschafft hat.
Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich stehe hier wie eine Zielscheibe, und Tränen werden mir nur das Gesicht nass machen. Sobald ich irgendwo in Sicherheit bin, kann ich den Notruf 911 verständigen.
Ich umklammere das Geländer und laufe die Stufen hinunter. Mein linkes Bein ist plump und gibt beinahe unter mir nach, aber ich drohe ihm im Geiste, es abzuschneiden, wenn es mich nicht hier rausbringt. Es hört auf mich.
Als ich an der Ecke vorbeikomme, heben sich die Instrumente gleichzeitig von den Stühlen.
Erschrocken ducke ich mich, weil ich fürchte, dass eines auf mich zu fliegen wird. Doch dann beginnen sie ohne Vorwarnung zu spielen. Klassische Musik erfüllt die Halle. Ein schöner, voller Klang, mit Flöten, Trompeten und Geigen.
Das muss ein Trick sein. Eine optische Täuschung. Wie in einem Vergnügungspark. Das alles muss irgendwie durch meine Bewegung ausgelöst worden sein.
Ich strecke die Hand aus und schnappe mir eine Flöte. Eigentlich rechne ich damit, dass sie mit dünnen Drähten oder durchsichtigem Plastik irgendwo befestigt ist.
Aber das ist sie nicht. Meine Hände schließen sich um das Metall, als würde ich sie aus einem Regal nehmen. Das Silber vibriert, als würde jemand darauf spielen. Sie wiegt auch nicht viel – es stecken also keine Batterien drin. Kein Lautsprecher. Nichts.
Als ich sie an mein Ohr halte, kommen die Töne aus dem Inneren.
Ich trete einen Schritt zurück und werfe sie von mir.
Da bewegt sich die Flöte sofort wieder an ihren alten Platz über dem Stuhl, als würde dort ein unsichtbarer Musiker stehen und auf ihr spielen. Die Klappen schließen und öffnen sich.
Ich schlucke schwer. Das ist ein Traum. Ich stehe unter Drogen. Irgend so etwas.
Aber ich vergeude meine Zeit. Ich muss hier raus.
Als ich zur Tür hetze, rechne ich damit, sie verschlossen vorzufinden – doch das ist sie nicht. Ich stolpere nach draußen auf einen Vorplatz aus Marmor, von dem Stufen zu einem kopfsteingepflasterten Weg führen. Gestutzte Rasenflächen so weit mein Auge reicht. Dazwischen vereinzelte Bäume und Blumenbeete. Aus einem wuchtigen Springbrunnen spritzt Wasser in die Luft. In der Ferne steht ein dichter Wald mit kräftig grünem Laub.
Nirgends kann ich eine asphaltierte Straße sehen.
Hinter mir schließt sich die Tür, und statt der Musik herrscht nun Stille. Hier gibt es kein Treppengeländer, deshalb bewege ich mich vorsichtig die Stufen hinunter und auf das Kopfsteinpflaster. Das Gebäude ragt turmhoch hinter mir auf. Große cremefarbene Ziegel wechseln sich mit Marmor und Kalkstein ab.
Das ist kein Museum. Es ist ein Schloss. Und zwar ein großes.
Und immer noch ist kein Mensch zu sehen. Niemand, nirgends, obwohl ich kilometerweit schauen kann. Die Stille ist überwältigend. Keine Autos, keine summenden Stromleitungen. Keine Flugzeuge.
Ich zerre das Handy aus meiner Tasche und wähle die 911.
Das Telefon protestiert piepend. Kein Netz.
Ich schüttle es, als würde das irgendwas nützen. Dabei ist oben im Display alles grau.
Kein Mobilfunkmast, kein W-LAN, kein Bluetooth.
Ein Wimmern kommt aus meiner Brust.
Diese Instrumente haben von allein gespielt.
Ich kann mir das nicht erklären. Mein Verstand ist schon mit den sehr realen Sorgen um meinen Bruder ausgelastet.
Da kommt mir ein neuer Gedanke und belastet mich mit einer noch schwereren Sorge. Wenn Jake etwas passiert ist, dann ist niemand da, um Mom zu helfen. Ich male mir aus, wie sie im Bett liegt und wegen des Krebses, der ihre Lunge befallen hat, schrecklich hustet. Wie sie Essen braucht. Und Medizin. Jemand, der sie zur Toilette führt.
Auf einmal verschwimmt alles vor meinen Augen. Ich wische mir über die Wangen und zwinge meine Beine loszulaufen. Schweiß sammelt sich in meinem Sweatshirt.
Moment mal. Schwitzen. Es ist warm.
In D. C. war es eiskalt.
Plötzlich fühlt sich der Schweiß kalt an.
Heb dir die Panik für später auf. Ich muss weiter.
Ein großes Nebengebäude steht direkt hinter dem Schloss, gleich jenseits eines geräumigen Hofs, der mit Kopfsteinen gepflastert ist. Überall blühen Blumen. An Holzspalieren, in großen Trögen, entlang von Hecken und in Beeten. Immer noch keine Menschenseele.
Meine Muskeln sind verspannt und erschöpft, Schweiß rinnt mir die Schläfen hinunter. Ich bete, dass das hier so eine Art Garage ist, denn ich werde bald eine andere Art der Fortbewegung nutzen müssen. Ewig kann ich nicht laufen. Mit dem Rücken lehne ich mich an die Schlossmauer, schwer atmend warte und lausche ich.
Als ich nichts höre, steuere ich direkt auf das Gebäude jenseits des Schlosshofs zu, wobei mein linker Fuß hinkt und um eine Pause fleht. Ich stolpere durch die Tür und rutsche in meinen feuchten Socken ein bisschen.
Wow. Keine Garage, sondern ein Stall.
Das ist fast noch besser. Ich weiß nämlich nicht, wie man ein Auto kurzschließt, aber ich kann reiten.
Damals, bevor es mit unserem Leben bergab ging, als Dad noch einen Job und einen guten Ruf hatte, war ich oft reiten. Nach all den Operationen wegen der Zerebralparese hatte ich damit als therapeutische Aktivität begonnen, doch dann wurde eine Leidenschaft daraus. Es bedeutete Freiheit für mich, weil Pferdebeine mir Kraft verliehen. Jahrelang jobbte ich in den Ställen, um mir Zeit zum Reiten zu verdienen, bis wir in die Stadt umziehen mussten.
Von allem, was ich aufgeben musste, vermisse ich die Pferde am meisten.
Dreißig Boxen befinden sich jeweils links und rechts von einem Mittelgang, alle aus nachgedunkeltem Holz bis auf halbe Raumhöhe und oben mit Eisengittern versehen. Gut gepflegte Pferde stehen mit schimmerndem Fell im Sonnenlicht, das durch die Dachluken hereinfällt. Zaumzeug hängt in gleichmäßigen Abständen an der Wand, die Gebisse und Schnallen strahlen, das Leder wirkt gut gefettet und poliert. Kein Büschel Heu liegt auf dem Gang, und kein Fliegenschwarm ist zu sehen. Jeder Quadratzentimeter dieses Stalls ist perfekt.
Ein Falbe streckt seine Nase heraus und schnaubt in meine Hand. Er ist in seiner Box an einen Ring gebunden und bereits gesattelt. Als ich in den Mittelgang geschlittert kam, ist er nicht einmal zusammengezuckt und betrachtet mich auch jetzt gelassen. Er ist groß und kräftig, mit hellbrauner Decke, schwarzer Mähne und schwarzem Schweif. Auf einem gehämmerten, goldfarbenen Schild an seiner Box steht Ironwill.
Ich streichle mit einer Hand seinen hellen Kopf. »Ich werde dich einfach Will nennen.«
In einer kleinen Kammer neben der Tür seiner Box befinden sich Stiefel, Umhänge – und ein Dolch, der an einem Gürtel befestigt ist.
Eine richtige Waffe. Ja.
Ich lege mir den Gürtel um die Taille und zurre ihn fest. Die Stiefel sind zu groß, aber sie reichen mir fast bis zu den Knien, was meinen Knöcheln etwas mehr Halt gibt.
Ich schlüpfe in die Box und verriegle die Tür hinter mir. Will akzeptiert die Trense bereitwillig, obwohl meine zitternden Hände ein bisschen an seinem Maul zerren, als ich die Schnallen schließen muss.
»Sorry«, flüstere ich und streichle seine Wange. »Bin aus der Übung.«
Dann höre ich Schritte, das Geräusch von Stiefeln auf Stein.
Erst erstarre ich, dann ducke ich mich hinter dem Pferd und ziehe es in die dunkelste Ecke der Box. Die Zügel sind in meiner Handfläche glitschig und feucht, aber ich umklammere sie fest, damit Will mich verdeckt.
Jemand schnalzt auf seinem Weg durch den Stall bei jedem Pferd. Ein freundliches Wort hier, ein Klaps da. Einen Moment lang folgt Stille, dann höre ich wieder Schritte.
Wer auch immer das ist, er kontrolliert den Stall.
Ein hölzernes Regal ist an dieser Seite der Box entlang angebracht. Wahrscheinlich für Heu oder anderes Futter. Ich klettere hinauf und kauere mich dann auf Hände und Knie. Es ist eine seltsame Position, um aufzusteigen, aber vom Boden aus schaffe ich es nie. Ich muss mich sehr konzentrieren, um den Fuß in den Steigbügel zu bekommen. Schweiß rinnt mir inzwischen über den Rücken, aber ich klammere mich am Sattel fest.
Ich muss all meine Kraft zusammennehmen, um nicht zu wimmern. Das ist wirklich das geduldigste Tier der Welt, denn es steht völlig still da, während ich mich auf seinen Rücken wuchte.
Aber jetzt bin ich oben. Ich sitze drauf.
Allerdings könnte ich vor Erschöpfung losheulen. Nein. Ich heule ja schon. Tränen rollen über meine Wangen. Ich muss hier raus. Ich muss einfach.
Schritte, dann ein erstauntes Luftschnappen. Der Riegel wird zurückgerissen. Ich sehe dunkles Haar und blitzenden Stahl, als der Mann sein Schwert zieht. Die Tür der Box schwingt auf.
Da ramme ich Will meine Fersen in die Flanken und schreie vor Wut, so laut ich kann. Das Pferd erschrickt – zu Recht. Ich bin selbst erschrocken. Aber Will macht einen Satz nach vorn, stößt die Tür weiter auf und rennt den bewaffneten Mann über den Haufen.
»Lauf!«, schreie ich. »Bitte, Will! Lauf!« Wieder bohre ich meine Fersen in seine Seiten.
Will springt durch den Mittelgang, findet Halt und galoppiert los.
Tränen lassen meinen Blick verschwimmen, aber bessere Sicht würde mir sowieso nicht helfen, mich oben zu halten. Ich habe bereits beide Steigbügel verloren, und wir schlittern über das Kopfsteinpflaster. Die Finger meiner linken Hand krallen sich in Wills Mähne, die andere Hand habe ich um seinen Hals geschlungen. Als wir den Rasen erreichen, sprintet das Pferd richtig los. Bei jedem Satz fliege ich aus dem Sattel und knalle dann wieder zurück.
Hinter uns ertönt ein scharfer Pfiff, gefolgt von drei kurzen Zwitscherlauten.
Will stemmt die Hufe in den Rasen, kommt schlitternd zum Stehen und wirbelt herum. Ich habe keine Chance und fliege über seine Schulter, um auf dem Rasen zu landen.
Einen Moment lang weiß ich nicht, wo oben und unten ist. In meinem Kopf dreht sich alles.
Dabei war ich so nah dran. So nah.
Die beiden Männer verfolgen mich. Im Sonnenschein sehe ich sie nur verschwommen, vielleicht wegen meiner Tränen oder wegen einer Kopfverletzung. Ich muss auf die Beine kommen. Ich muss weglaufen.
Zwar schaffe ich es, mich aufzurichten, aber meine Beine wollen nicht schnell genug funktionieren. Der blonde Mann ist schon da und streckt die Hand nach mir aus. Der Dunkelhaarige mit dem Schwert kommt direkt hinter ihm.
»Nein!« Ein leises Quieken kommt aus meiner Brust. Ich taumele von ihm weg und zücke den Dolch.
Da zieht auch der mit dem Schwert seine Waffe.
Ich torkele weiter zurück, falle über meine eigenen Füße und lande hart auf dem Gras.
»Kommandant, halt!«, sagt der Blonde. Er hebt seine Hände. »Beruhigt Euch. Ich werde Euch nichts tun.«
»Ihr habt mich gejagt.«
»Das machen wir mit Pferdedieben so«, sagt der mit dem Schwert.
»Grey.« Der blonde Mann wirft dem anderen einen tadelnden Blick zu, dann streckt er mir wieder die Hand hin. »Du hast nichts zu befürchten.«
Das muss ein Witz sein.
Vorher habe ich ihn mir nicht so genau angesehen, aber das tue ich jetzt. Sein Profil ist beeindruckend, mit hohen Wangenknochen und einem kantigen Kinn. Warme braune Augen. Keine Sommersprossen, aber genug Sonnenbräune, um nicht blass zu sein. Er trägt ein weißes Hemd unter einer blauen Jacke mit hohem Kragen, Lederbesatz und aufwendiger Goldstickerei. Auf Brusthöhe befinden sich goldene Schnallen, und um die Hüften trägt er einen Gürtel, in dem ein Dolch steckt.
Er blickt auf mich herab, als hätte er es tagtäglich mit halb verrückten Mädchen zu tun.
Ich fuchtele weiter mit meinem Dolch herum. »Sag mir, wo ich hier bin.«
»Ihr seid auf dem Schloss Ironrose, im Herzen von Emberfall.«
Ich überlege krampfhaft, ob es irgendwelche Attraktionen mit solchen Namen in vernünftiger Entfernung zu D. C. gibt. Dieses Schloss ist riesig. Ich müsste schon davon gehört haben. Und Jakes Timer, der sich vorhin gemeldet hat, war das Einzige, was mir hier noch irgendwie normal vorkam. Es gibt tatsächlich keinen Ort, an den mich der Typ mit dem Schwert so schnell hätte bringen können. Ich lecke mir über die Lippen. »Wie heißt die nächste Stadt?«
»Silvermoon Harbour.« Er zögert und kommt noch einen Schritt näher. »Ihr seid verwirrt. Bitte – lasst mich Euch helfen.«
»Nein.« Ich schwinge den Dolch in seine Richtung, und er bleibt stehen. »Ich werde von hier verschwinden. Ich gehe nach Hause.«
»Ihr könnt den Weg nach Hause von hier nicht finden.«
Wütend funkele ich den bewaffneten Mann hinter ihm an. »Er hat mich hergebracht. Da muss es ja auch einen Weg zurück geben.«
Der Schwerttyp macht ein unergründliches Gesicht, dem, im Gegensatz zu dem des anderen, jeder Charme fehlt. »Gibt es nicht.«
Ich starre weiter grimmig zu ihm hoch. »Muss es geben.«
Er verzieht keine Miene. »Gibt. Es. Nicht.«
»Genug.« Der blonde Mann streckt mir wieder die Hand hin. »Wir werden das nicht hier draußen diskutieren. Komm. Ich bringe Euch in ein Zimmer. Habt Ihr Hunger?«
Ich kann mich nicht entscheiden, ob die beiden verrückt sind – oder ich. Ich packe den Dolch fester. »Ich werde nirgendwo mit dir hingehen.«
»Ich verstehe Euren Widerwillen ja, aber ich kann nicht zulassen, dass Ihr das Schlossgelände verlasst. Das ist zu gefährlich. Ich habe keine Soldaten, die auf dem Königsweg patrouillieren.«
»Auf dem Königsweg«, wiederhole ich wie benommen. Alles, was er sagt, klingt so logisch. Nicht so, als wolle er mich drängen, ihm zu folgen. Eher überrascht, dass mir etwas anderes überhaupt in den Sinn kommt.
Ich verstehe das alles nicht.
»Bitte«, sagt er sanfter. »Sicher wisst Ihr, dass wir Euch auch zwingen könnten mitzukommen.«
Mein Herz setzt beinahe aus. Natürlich weiß ich das. Ich weiß nur nicht, was schlimmer ist – mit Gewalt mitgeschleppt zu werden oder freiwillig mitzugehen. »Wag es nicht, mir zu drohen.«
»Euch zu drohen?« Er zieht die Augenbrauen hoch. »Denkt Ihr, ich habe die Absicht, Euch zu drohen, indem ich Euch Sicherheit, Bequemlichkeit, Essen und Trinken anbiete?«
Er klingt gekränkt. Ich kenne Männer, die sich nehmen, was sie wollen. Diese hier benehmen sich nicht so.
Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber mein Körper schmerzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne Hilfe vom Boden aufstehen kann. Mit Sicherheit kann ich nicht mehr weglaufen.
Er hat recht: Sie könnten mich zwingen mitzukommen. Aber ich sollte meine Kräfte schonen.
Ich kann mich ausruhen. Ich kann etwas essen. Und dann werde ich einen Weg von hier weg finden.
Ich halte den Atem an und schiebe den Dolch in die Scheide zurück. Eigentlich rechne ich damit, dass die Männer dagegen protestieren werden, dass ich die Waffe behalte, doch das tun sie nicht.
Trotz meiner Entschlossenheit fühle ich mich wie eine Versagerin. Ich frage mich, was Jake dazu sagen würde.
Oh, Jake. Ich weiß nicht, ob es ihm gut geht. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Aber ich kann das hier überleben. Ich muss einfach.
Also beiße ich die Zähne zusammen, verdränge meine Gefühle und strecke den Arm aus, um seine Hand zu ergreifen.
5 Rhen
Nachdem wir Ironwill in den Stall zurückgebracht haben, geht das Mädchen stumm neben mir, wobei ihr ungleichmäßiger Gang verrät, dass sie ernsthaft verletzt sein muss. Sie hält Abstand zu mir und Grey, hat die Arme über dem Unterleib verschränkt und eine Hand am Griff des Dolchs.
Es beeindruckt mich, dass sie eine Waffe gefunden hat – und noch mehr, dass sie, um zu flüchten, die Stallungen aufgesucht hat. Die meisten Mädchen, die Grey aus ihrer Welt herbringt, würden keine Klinge und kein Zaumzeug anrühren, sondern interessieren sich eher für den Aufputz, den sie in den üppig ausgestatteten Kleiderschränken von Ironrose Castle finden. So früh am Beginn eines neuen Versuchs pflegten die anderen Mädchen normalerweise am Kaminfeuer zu sitzen und mich über Kristallpokale hinweg anzusehen, während ich Wein nachschenkte und ihnen Anekdoten erzählte, die gerade frivol genug wären, um sie erröten zu lassen.
Gäbe ich dagegen diesem Mädchen einen Kristallpokal in die Hand, würde sie ihn wahrscheinlich sofort zerschlagen und die Scherben benutzen, um mich zu verletzen.
»Ich merke, dass du mich anstarrst«, sagt sie. Das Sonnenlicht lässt ihre nachtschwarzen Locken schimmern.
Ein halbes Dutzend Komplimente liegt mir auf der Zunge, aber sie scheint nicht der Typ für Schmeicheleien zu sein. »Ich habe mich gefragt, ob Ihr uns vielleicht Euren Namen verratet.«
Sie zögert und scheint über die Auswirkungen dieses Schrittes nachzudenken. »Harper.«
Ah. Natürlich. Annabeth oder Isabella würde auch nicht zu ihr passen. Eher so ein kantiger Name wie dieser.
»Harper.« Ich nicke ihr zu. »Es freut mich sehr, Eure Bekanntschaft zu machen, Mylady.«
Sie sieht mich an, als glaube sie, ich mache mich über sie lustig. »Und wer bist du?«
»Mein Name ist Rhen.« Auf meiner linken Seite wirft Grey mir einen vielsagenden Blick zu, aber ich ignoriere ihn. Früher einmal hätte ich meine Titel zu meinem Vorteil genutzt, um Mädchen mit dem Versprechen von Reichtum und Macht zu beeindrucken. Aber seit mein Königreich im Laufe der Zeit Armut und Terror anheimgefallen ist, gibt es kaum noch einen Grund, stolz auf meine Herkunft zu sein.
»Du lebst in einem Schloss«, sagt Harper. »Deshalb wird da wohl noch mehr als nur ›Rhen‹ sein.«
»Würde eine Aufzählung von Titeln Euch etwa imponieren?« Ich lasse in meiner Stimme ein wenig Lust am Geplänkel anklingen, aber das kostet mich mehr Mühe als früher. »Ich bin mir sicher, dass da auch noch mehr ist als nur ›Harper‹.«
Sie ignoriert das, wendet den Blick von mir ab und deutet auf Grey. »Und er?«
»Grey of Wildthorne Valley«, sage ich. »Kommandant der Königlichen Garde.«
Grey nickt ihr zu. »Mylady.«
»Kommandant. Das heißt, es sollte auch Leute zum Kommandieren geben.« Ihre Augen werden schmal, und sie scheint zu rechnen. Ich habe keine Ahnung, wo Grey sie gefunden hat, aber ihr Misstrauen ist viel ausgeprägter als bei irgendeinem der anderen Mädchen, die er bislang hergebracht hat. »Wo sind die?«
Viele geflohen und noch mehr gestorben, doch das sage ich nicht. »Fort. Wir sind allein.«
»Es ist sonst keiner hier?«
»Ihr klingt skeptisch. Aber ich versichere Euch, dass Ihr auf dem ganzen Schlossgelände niemand außer uns finden werdet.«
Ich rechne mit weiteren Fragen, aber sie scheint sich nur noch weiter zurückzuziehen. Wegen ihrer Entschlossenheit, Abstand zu uns zu halten, geht sie praktisch ganz am Rand des Wegs entlang.
»Ihr müsst Euch nicht so um Distanz bemühen«, sage ich zu ihr. »Ihr habt von mir nichts zu befürchten.«
Also, zumindest jetzt noch nicht.
»Ach ja?« Ihr wütender Blick ist streng. »Warum erzählst du mir dann nicht, was du mit dieser Frau vorhattest, die Kommandant Grey eigentlich entführen wollte?«
»Ich hätte ihr kein Leid zugefügt.« Zumindest anfangs nicht und nicht mit Absicht. Grey ist gut geübt darin, sie in Sicherheit zu bringen, sobald ich mich verwandle und Gewalt unvermeidlich ist.
»Sie war nicht bei Bewusstsein, also konnte sie gar nicht freiwillig mitkommen.« Ihre Worte klingen scharf. »Und nur damit das klar ist, ich wäre auch nicht freiwillig mitgekommen.«
Ich muss den Blick abwenden. Früher wäre dieses Ziehen in meiner Brust Arroganz gewesen, jetzt ist es Scham.
Ich erinnere mich an eine Zeit, als mein Volk den Tag gefürchtet hat, an dem ich die Macht übernehmen würde – weil man mich für verwöhnt, selbstsüchtig und nicht halb so mannhaft wie meinen Vater gehalten hat.
Jetzt bin ich auf andere Weise verwöhnt und selbstsüchtig und genauso wenig zum Herrschen geeignet.
Wir haben die Stufen zum Schloss erreicht, und ich biete ihr meine Hand an, doch sie ignoriert sie, um selbst die Treppe hinauf zu humpeln. Grey geht in schnellen Schritten voran und greift nach dem verzierten goldenen Türgriff. Als er die Tür weit aufreißt, ertönt fröhliche Musik aus der Großen Halle.
Harper bleibt abrupt stehen.
»Es ist nur Musik«, erkläre ich ihr. »Wobei ich zugeben muss, dass ich mich früher auch darüber gewundert habe.«
Inzwischen hasse ich diese Musik.
Normalerweise finden die Mädchen das bezaubernd, ja erfreulich, aber Harper sieht aus, als ob sie am liebsten auf der Stelle umkehren würde.
Anscheinend reißt sie sich zusammen, denn sie betritt den Raum und mustert die Instrumente. Dann legt sie ihre Finger auf die vibrierenden Saiten einer Geige. »Das muss ein Trick sein.«
»Man kann sie ins Kaminfeuer werfen oder in Stücke schlagen, nichts bringt die Musik zum Verstummen. Glaubt mir, das habe ich schon probiert.«
Sie zieht die Augenbrauen hoch. »Du hast diese Musikinstrumente … ins Feuer geworfen?«
»Habe ich.« Um ehrlich zu sein, habe ich schon das ganze Schloss niedergebrannt. Mehr als einmal. Dann erklingt die Musik weiter aus Schutt und Asche.
Beim ersten Mal war das sogar noch ziemlich faszinierend.
Ich deute auf die Treppe nach oben, bevor sie noch mehr Fragen stellen kann. »Auf Ihr Zimmer, Mylady?«
Grey bleibt abwartend zurück, als Harper mir die Haupttreppe hinauf und in den Westflügel folgt. Ich bringe die Mädchen immer in Arabellas Zimmer, weil der Geschmack meiner ältesten Schwester beruhigend und einladend wirkt: Blumen, Schmetterlinge und Spitze. Arabella pflegte den halben Tag zu verschlafen, wenn ihre Hauslehrer und Gouvernanten es ihr erlaubt hatten, deshalb wartet auf dem Tisch in ihrem Zimmer immer Essen: Gebäck mit Honig, Marmelade, aufgeschnittener Käse, eine Kanne Tee und ein Krug Wasser. Neben dem Gebäck liegt ein halb geschmolzenes Butterflöckchen.
Ich öffne die Tür. Dann deute ich in den hinteren Teil des Raums. »Hinter dieser Tür findest du ein heißes Bad, hinter der anderen ein Ankleidezimmer.« Ich schaue kurz auf ihre verschwitzten Sachen. »Da solltet Ihr etwas finden, wenn … es Eurem Geschmack entspricht.«
»Und du lässt mich jetzt allein?«
Sie klingt misstrauisch, aber ich nicke. »Wenn Ihr das wünscht.«
Harper tritt zögernd und um sich blickend durch die Tür. Mit den Fingern streicht sie über die Platte des Beistelltischs und hält vor dem Essen kurz inne – aber sie nimmt nichts davon.
Ich blicke stirnrunzelnd auf ihre Füße, die in den zu großen Stiefeln eines Stallburschen stecken. Ihr linker Knöchel wirkt verletzt, zumindest glaube ich, dass das der Grund sein muss, warum sie humpelt. »Seid Ihr Euch sicher, dass ich Euch mit nichts behilflich sein kann?«
Erstaunt dreht sie sich um. »Was?«
»Ihr seid doch offensichtlich verletzt.«
»Bin ich nicht …« Sie überlegt. »Mir fehlt nichts.«
Ich könnte nicht sagen, ob sie das aus Stolz oder Furcht oder einer Mischung aus beidem tut. Während ich noch darüber nachdenke, sagt sie: »Du hast gesagt, ich könnte jetzt allein sein.«
»Wie Ihr wünscht, Mylady.« Ich nicke ihr zu.
»Warte.«
Verwundert halte ich mit der Hand auf der Klinke inne. »Ja?«
Sie beißt sich auf die Lippen, dann blickt sie sich noch mal in Arabellas prächtigen Gemächern um. »Dieses Schloss, die Musik. Ist das alles so eine Art …« Sie verstummt und sieht verlegen aus. »Vergiss es.«
»Zauberei?«, schlage ich vor und ziehe eine Augenbraue hoch.
Sie holt beinahe hoffnungsvoll und gut hörbar tief Luft – aber dann verfinstert sich ihre Miene auch schon wieder. »Du machst dich doch bloß über mich lustig. Vergiss es. Lass mich allein.«
»Wie Ihr wünscht. Ich werde am Mittag wiederkommen.« Damit schließe ich die Tür, bleibe aber davor stehen. Dieser Versuch ist schon jetzt schrecklich schiefgelaufen. Sie wird mir niemals vertrauen.
Ich werde wieder scheitern.
Dann lege ich eine Hand an die Tür. Sie scheint sich auf der anderen Seite auch nicht von der Stelle gerührt zu haben. »Ich habe mich nicht über Euch lustig gemacht, Mylady.« Ich schweige, aber sie erwidert nichts darauf. »Ironrose ist nicht verzaubert.«
Sie spricht von hinter der Tür. »Schön. Was ist es dann?«
»Verflucht.«
Danach drehe ich den Schlüssel um und nehme ihn an mich.
*
Wie immer lasse ich meine Enttäuschung an Grey aus.
Oder er vielleicht seine an mir. Ich kann gut mit dem Schwert umgehen, er noch besser.
Wir befinden uns in der Trainingsarena. Das Klirren des aufeinanderprallenden Stahls hallt durch die Sparren. Ich sehe eine Blöße bei ihm und ziele auf seine Mitte, aber er weicht der Klinge mit einem Schritt aus und wirbelt herum, um zu parieren und sie abzufälschen. Seine Angriffe sind schnell und beinahe tödlich – was gut ist, weil ich etwas brauche, das meine volle Aufmerksamkeit verlangt.
Greys Schwert kracht auf meines und zwingt mich einen Schritt nach hinten. Wir trainieren schon seit einer Stunde, und Schweiß läuft mir aus den Haaren. Ich fange mich schnell und gehe zum Gegenangriff über, wobei meine Stiefel Spuren im Sägemehl der Arena hinterlassen. Schnell und heftig hole ich aus, in der Hoffnung, ihn in die Defensive zu zwingen.
Das funktioniert zunächst, und er muss zurückweichen. Aber ich weiß ganz genau, dass ich deshalb noch nicht im Vorteil bin. Er gibt nicht nach, sondern lauert auf eine Blöße.
Seine Geduld ist stets unendlich. Darum beneide ich ihn.
Ohne genau zu wissen, warum, erinnere ich mich noch an den Tag, als er in meine Leibgarde aufgenommen wurde. Damals habe ich kaum einem der Männer auch nur einen Blick geschenkt. War er doch nur ein weiterer Untertan, der schwor, sein Leben für mich zu lassen. Und wenn einem etwas zustieß, würde kurz darauf ein anderer nachrücken.
Doch Grey war versessen darauf gewesen, sich zu beweisen. Ich glaube, daran erinnere ich mich noch am deutlichsten: an seinen Eifer.
Den habe ich rasch zerstört. Genau wie alles andere.
In der Arena täuscht Grey gerade einen Angriff vor. Ich glaube, meine Chance zu sehen, hole in großem Bogen aus. Grey duckt sich, schießt nach vorn und rammt mir seinen Schwertgriff in den Bauch. Danach stößt er mich mit der Schulter um.
Ich gehe zu Boden. Mein Schwert fliegt mir aus den Händen.
»Was für eine Darbietung, Eure Hoheit.« Eine Frauenstimme von der Tribüne an der Längsseite der Arena, gefolgt von langsamem Applaus. Einen wilden, verrückten Moment lang denke ich, Harper muss irgendwie hierher gefunden haben.
Aber es ist nicht Harper. Es ist Lilith. Die letzte – und einzige – Zauberin in Emberfall. Mein Vater hatte einst alle aus seinem Königreich verbannt.
Doch ich war zu dumm, um zu begreifen, dass ich es genauso hätte machen sollen.
Ich hebe mein Schwert auf und springe auf die Füße, als Lilith bereits die Arena betritt. Nicht einmal die Sägespäne wagen es, sich an ihren Saum zu hängen.
Ich zwinge mich, mein Schwert in die Scheide zu stecken, anstatt mit der Klinge ihre Brust zu durchbohren.
Das habe ich bereits versucht, doch es geht niemals gut aus.
Ich verneige mich tief, ergreife ihre Hand und drücke einen flüchtigen Kuss auf den Handrücken. Dann sage ich, mit falschem Charme: »Einen guten Tag Euch, Lady Lilith. Das Morgenlicht schmeichelt Euch, wie immer.«
Immerhin das ist wahr. Glatte Haut, rosige Wangen und Lippen, die stets ein Geheimnis zu verbergen scheinen. Haare so schwarz wie Rabenschwingen, die ihr in perfekten Locken über die Schultern fallen. Ein smaragdgrünes Seidenkleid schmiegt sich um ihre Kurven, betont die schmale Taille, die Wölbung ihrer Brüste. Die Farbe unterstreicht das Grün ihrer Augen. Im Licht, das durch die Gaubenfenster fällt, sieht sie ausgesprochen gut aus. Einst hat sie mir damit den Kopf verdreht, aber aus völlig falschen Gründen.
»Was für Manieren«, sagt sie mit einer Spur Ironie in der Stimme. »Man könnte meinen, Ihr wärt königlich erzogen worden.«
Ich weiß sehr gut, dass ich mich von ihr nicht provozieren lassen soll, aber es fällt mir zunehmend schwer. »Könnte man meinen«, stimme ich ihr zu. »Nur braucht man für manche Lektionen eben länger als für andere.«
Lilith wirft einen Blick auf Grey, der stumm hinter mir steht. »Dachte Kommandant Grey ernsthaft, dieser Abschaum von einem Mädchen würde diejenige sein, die Euren Fluch bricht?«
»Soweit ich weiß, war sie nicht seine erste Wahl.«
»Trotzdem vergeudet Ihr die Gelegenheit, indem Ihr sie alleine schmachten lasst?«
»Sie hat meine Gesellschaft abgelehnt. Und ich werde mich keinem Mädchen wider Willen aufdrängen.«
»Wie galant.« Sie klingt dabei jedoch, als fände sie das alles andere als galant.
»Ich habe dein Spiel jetzt schon seit weit über dreihundert Mal mitgespielt. Wenn ich daher einem Mädchen erlaube zu schmachten, wie du es nennst, dann wird bald ein neues kommen.«
Sie runzelt die Stirn. »Das ist kein Mitspielen. Das nenne ich aufgeben. Seid Ihr unseres kleinen Spiels tatsächlich schon so überdrüssig?«
Ja. Das bin ich. So schrecklich müde.
»Niemals«, sage ich. »Ich finde jedes Mal unterhaltsamer als das vorherige, Mylady.«
So leicht lässt sie sich nicht täuschen. »Seit fünf Jahren versinkt Euer Königreich in Armut. Euer Volk lebt in Angst und Schrecken vor der wilden Kreatur, die mit entsetzlicher Regelmäßigkeit mordet. Und doch verschmäht Ihr eine Chance, sie allesamt zu retten?«
Fünf Jahre. Das ist irgendwie zugleich länger und kürzer, als ich dachte – auch wenn ich über keinerlei Mittel verfüge, um die Feinheiten ihres Zaubers nachzuverfolgen. Ich wusste, dass außerhalb des Geländes von Ironrose die Zeit ganz normal vergangen ist. Ich wusste auch, dass mein Volk litt. Mir war nur noch nicht klar, wie sehr.
Zorn durchdringt meine Worte, obwohl ich das nicht will. »Ich übernehme nicht allein die Schuld daran, dass mein Volk in Armut und Schrecken gestürzt wurde.«
»Das solltet Ihr aber, mein Prinz. Und man muss sich auch fragen, wie viele Gelegenheiten, es zu retten, Euch das Schicksal noch gewähren wird.« Sie wirft einen Blick auf Grey. »Seid Ihr Eurer Gabe schon müde, Kommandant? Vielleicht ist die Fähigkeit, zu Beginn jeden Versuchs auf die andere Seite zu gelangen, an Euch ja verschwendet.«
Ich erstarre. Ihre Worte haben stets einen drohenden Unterton. Einst war ich zu dumm, das zu erkennen, doch inzwischen vermag ich, zwischen den Zeilen zu lesen.
»Ich werde nie der Gelegenheit müde, dem Prinzen zu dienen, Mylady.« Seine Stimme klingt emotionslos. Grey ist gut darin geübt, nie mehr zu beantworten als das, wonach er gefragt wird, und nie Anlass für Ärger zu geben.
Das hat er vermutlich in meinen Diensten gelernt.
»Kommandant Grey ist dankbar für Eure Großzügigkeit«, versuche ich, an ihre Eitelkeit zu appellieren. Wenn sie ihm sein Armband wegnimmt, hat er keine Möglichkeit mehr, hinüber zu gelangen. Dann wird meine Chance, diesen Bann zu brechen, sogar noch geringer sein als jetzt schon. »Ich habe ihn schon oft Eure Großmut und Gnade loben gehört.«
»Ihr seid so ein hübscher Lügner, Rhen.« Sie streckt die Hand aus, um meine Wange zu tätscheln.
Da zucke ich zusammen – und sie lächelt. Sie lebt für diesen Moment, die Schwelle zwischen Furcht und Handeln. Ich halte nur den Atem an und rechne damit, dass sie meine Haut aufreißt und Blut fließt.
Doch sie wendet den Blick von mir ab, verzieht das Gesicht und mustert Grey. »Was ist mit deinem Hals passiert?« Sie hebt eine Hand, lässt sie jedoch keine drei Finger breit von seiner Kehle in der Luft schweben.
Er hält vollkommen still. »Ein unglückliches Missverständnis.«
»Ein Missverständnis?« Sie fährt mit dem Finger am obersten Kratzer entlang, und während sie das tut, wird der Kratzer leuchtend rot. Blut rinnt seinen Hals hinab. »Hat dieses Mädchen das getan?«
Er rührt sich nicht, und an seinem Hals zuckt nicht einmal ein Muskel. »Ja, Mylady.«
Ich bin wie erstarrt, möchte sie daran hindern, weiß aber auch, dass es für ihn dann wahrscheinlich noch schlimmer enden wird.
Sie schwebt näher. »Wenn sie den großen Kommandanten Grey bluten hat lassen, dann gefällt sie mir, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser.« Sie fährt den nächsten Kratzer entlang, wobei ihr Finger jetzt rot glüht. Und noch mehr Blut fließt.
Grey rührt sich immer noch nicht, aber er hält den Atem an. Sein Blick ist hart.
Ich beiße die Zähne zusammen. Einst dachte ich, die gewaltige Zerstörung sei das Schlimmste an diesem Fluch, doch nun weiß ich schon lange, dass das nicht stimmt. Es ist die wiederholte Demütigung und Bestrafung. Die Ohnmacht, zurückzuerobern, was mir gehört. Gezwungenermaßen zuzusehen, wie mir jede Würde genommen wird.
Sie fährt ein drittes Mal über seinen Hals und macht dazu ein neugieriges Gesicht.
Grey zuckt und schnappt zischend nach Luft. Ich rieche verbranntes Fleisch.
Lilith lächelt.
Ich mache einen Schritt vorwärts und packe sie am Handgelenk. »Lasst das sein.«
Ihre Augenbrauen gehen nach oben, und sie blickt erfreut drein. »Prinz Rhen! Welche Tatkraft. Man könnte fast meinen, Ihr hättet irgendein Interesse an Euren Untertanen.«
»Ihr habt mir nur einen einzigen Mann gelassen, und ich werde nicht zulassen, dass ihm ein Leid zugefügt wird. Wenn Ihr schon mit jemand spielen müsst, dann tut es mit mir.«
»Sehr gern.« Schon fährt sie mit ihrer freien Hand über meinen Bauch.
Ich spüre ihre Fingernägel nicht. Ich spüre gar nichts.
Aber dann kommt der Schmerz. Als hätte sie mich mit einer Flamme versengt.
Ich sehe schwarze Flecken vor meinen Augen und falle mit den Knien auf die Sägespäne. Wie aus weiter Ferne merke ich, dass Grey versucht, mich aufzufangen. Ich presse einen Arm gegen meinen Bauch, aber diese Verletzung entsteht durch Zauberei, und nichts kann sie lindern. Feuer brennt jetzt in meinen Adern.
Zieh dein Schwert, Kommandant, möchte ich am liebsten zu ihm sagen. Mach dem Ganzen ein Ende.
Doch das würde nicht funktionieren. Ich würde nur wieder in dem verfluchten Raum erwachen und dort darauf warten, dass Grey mit einem neuen Mädchen zurückkehrt.
Über mir beginnt Lilith zu sprechen. »Seid Ihr wirklich schon so müde, lieber Prinz? Wünscht Ihr Euch, dass ich Eurer Qual ein Ende bereite?«
»Ja, Mylady.« Meine Stimme ist kaum noch ein Flüstern. Die Worte klingen flehend. Wie ein Gebet. Selbst wenn das Ende meiner Qual auch mein eigenes Ende wäre, würde es doch wenigstens das Leid meines Volkes lindern. Und Grey würde es die Freiheit schenken.
»Ich bin großzügig, Prinz Rhen. Ich werde Euch Gnade erweisen. Dies soll Euer letzter Versuch sein. Dann werden Eure Tage vergehen wie im Rest von Emberfall. Sobald dieser Herbst endet, wird Ironrose in seinen früheren Zustand zurückkehren.«
Erleichterung keimt in meiner Brust auf, zumindest ein Tropfen Erleichterung angesichts des unaufhörlichen Schmerzes. Endlich mein letzter Versuch. Ich werde diese drei Monate ertragen und dann frei sein. Am liebsten möchte ich mich aus Greys Griff winden, ihr die Füße küssen und vor Dankbarkeit weinen.
»Was wird passieren«, fragt Lilith da, »wenn Ihr bei diesem Mädchen scheitert und dazu verdammt seid, die Ewigkeit als Ungeheuer zu verbringen?«
Diese Frage lässt mein Herz stocken.
»Ich habe Euch nicht nur einen einzigen Mann gelassen«, sagt sie, und ihre Stimme klingt so scharf wie tausend Messer. »Ich habe Emberfall außerdem nicht in Armut und Schrecken gestürzt. Und ich werde nicht diejenige sein, die Euer ganzes Volk vernichtet.«
Aus meiner Kehle kommt nur ein erstickter Laut. Jetzt möchte ich aus einem ganz anderen Grund weinen. Der brennende Schmerz hat meinen Kopf erreicht, und ich sehe Sterne vor Augen.
»Ihr seid für all das verantwortlich«, sagt sie, und ihre schauerliche Stimme verklingt. »Ihr, Rhen, Ihr allein werdet sie alle zerstören.«
6 Harper
Ich plane meine Flucht.
Und es läuft nicht gut.