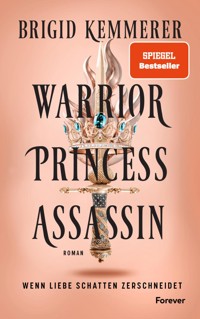13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Emberfall-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Fluch von Emberfall ist gebrochen. Doch die Gerüchte, dass Prinz Rhen gar nicht der legitime Thronerbe ist, wollen nicht verstummen. Nur Rhens engster Vertrauter, der schweigsame Grey, kennt die gefährliche Wahrheit. Er versucht sich zu verstecken, wird von Rhen aber gewaltsam an den Hof zurückgeholt. Die skrupellose Herrscherin des Nachbarreichs will die Wirren nutzen, um die Macht an sich zu reißen. Und ausgerechnet deren Tochter Lia Mara bittet plötzlich Grey um Hilfe. Kann er dem ebenso schönen wie mutigen Mädchen wirklich vertrauen? Kann er mit ihr Emberfall retten – indem er sich gegen Rhen stellt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Eine Ewigkeit habe ich an Prinz Rhens Seite gestanden, habe sein Ungeheuer überlebt, habe Lilith überlebt, habe die Zeit in der Garde überlebt, nur um jetzt neben einem Lagerfeuer im Dreck zu verrecken. Plötzlich ist alles still. Jemand berührt mein Gesicht. »Grey.« Lia Maras Stimme. Ihr süßer Atem streicht warm über meine Wange. Offenbar kniet sie auf dem Boden. »Du hast überlebt, was Rhen mit dir gemacht hast. Das hier überlebst du auch.«
Einst waren sie enge Vertraute: Rhen, der Prinz des magischen Reiches Emberfall, und Grey, sein treuester Diener. Doch nun ist Grey auf der Flucht. Als Halbbruder von Rhen ist er der wahre Herrscher über Emberfall. Ein Erbe, das Grey unter keinen Umständen antreten möchte. Aber Rhen, der endlich Gewissheit haben will, lässt ihn von seinen Schergen im ganzen Land suchen. Und nicht nur er: Auch die boshafte Königin Karis Luran und ihre Tochter Lia Mara stellen Grey nach …
»Eine epische Saga, temporeich, atmosphärisch dicht und aus feministischer Perspektive!«
Kirkus Reviews
Die Autorin
Brigid Kemmerer ist eine New-York-Times-Bestsellerautorin. Sie hat bereits mehrere Jugendbücher veröffentlicht. »Ein Herz so dunkel und schön« ist nach »Ein Fluch so ewig und kalt« der zweite große Roman ihrer neuen Bestseller-Trilogie um das magische Reich Emberfall. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren vier Jungen in der Nähe von Baltimore.
Brigid Kemmerer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel A Heart so Fierce and Brokenbei Bloomsbury YA, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Brigid Kemmerer
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte sind vorbehalten. Printed in Germany
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, nach einem Originalentwurf von Jeanette Levy (Bloomsbury)
Umschlagillustration: Shane Rebenschied
Karte: © Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24577-1V001
Dies ist für euch, meine lieben Leser:
Blickt in den Spiegel.
Ihr seid Fluchbrecher.
Ihr seid stark.
Ihr seid fantastisch.
Ihr verändert die Welt, einfach nur durch euer Dasein.
Und ich bin
sehr
sehr
stolz
auf euch.
1 Harper
Es fehlt mir, die genaue Uhrzeit zu kennen.
Nicht vieles von dem, was ich in Washington, D.C. zurückgelassen habe, fehlt mir hier. Aber wenn es dunkel wird, das Abendessen nur noch eine verblassende Erinnerung zu sein scheint und Rhen noch immer nicht aufgetaucht ist, wüsste ich wirklich gerne, wie spät es eigentlich ist. Für mich ist es nichts Neues, in der Dunkelheit zu warten, aber auf der Straße hatte ich zumindest immer das Handy meines Bruders und konnte jede Sekunde zählen.
Jetzt bin ich Prinzessin Harper von Disi, und Emberfall ist noch nicht im Zeitalter der Elektrizität angekommen.
Rhen und ich bewohnen getrennte Gemächer, wie es sich für den Kronprinzen und die Dame, mit der er ein staatliches Bündnis besiegeln will, geziemt, aber er kommt immer noch einmal bei mir vorbei, bevor er sich zum Schlafen zurückzieht.
Und dabei ist es noch nie so spät geworden. Zumindest glaube ich das.
Die Hitze des Tages ist abgeklungen, und nun strömt kühlere Luft durch das offene Fenster; im Kamin liegen nur noch ein paar glühende Kohlen. Draußen zeigen flackernde Fackeln die Wachposten rund um Schloss Ironrose an, gleichmäßig verteilte Lichtflecken, durch die es auf dem Gelände niemals richtig dunkel wird. Was für ein Unterschied zu der Zeit, als Ironrose noch verflucht war und die Nischen der Wachleute kalt und leer dalagen, als das Schloss keine anderen Bewohner hatte als Rhen, Grey und mich.
Jetzt wimmelt es hier nur so von Adeligen, Dienstboten und Wachen, und wir sind nie wirklich allein.
Und Grey ist nicht mehr da. Schon seit Monaten nicht mehr.
Ich nehme die Kerze vom Nachttisch und entzünde sie an der Glut im Kamin. Inzwischen tue ich das ebenso selbstverständlich, wie ich früher zu Hause auf den Lichtschalter gedrückt habe. Heute hat Zo, meine persönliche Leibwache und engste Freundin hier, Dienst, und sie hat auch ein Recht auf ein wenig Schlaf. Genau wie Freya, meine Kammerzofe. Bei ihr brennt schon seit Stunden kein Licht mehr, obwohl ich mir egoistischerweise wünsche, es wäre anders. Im Moment könnte ich eine Freundin gebrauchen.
Als es leise klopft, laufe ich schnell zur Tür.
Doch es ist nicht Rhen, bei dem ich auch gar nicht mit einem Klopfen gerechnet hätte. Nein, es ist Jake.
Als ich noch jünger war, hatte ich in Jake den perfekten großen Bruder, er war immer sanft und lieb. Dann wurden wir Teenager, unsere Mutter war plötzlich todkrank, und unser Vater fuhr unser aller Leben so richtig vor die Wand. Jake ist gebaut wie ein Linebacker, und damit wir irgendwie über die Runden kamen, übernahm er diverse Jobs für die Kredithaie, die immer wieder vor unserer Tür auftauchten. So wurde Jake für jeden, der nicht zur Familie gehört, schnell vom lieben Kerl zu jemandem, vor dem man sich besser in Acht nahm.
Dass er nun in Emberfall festsitzt, einem Land, das ebenso schön wie wild und gefährlich ist, hat nicht viel am Temperament meines Bruders geändert. Nach unserer Ankunft war er etwas verunsichert und fühlte sich fehl am Platz, aber inzwischen ist er in seine Rolle als Prinz Jacob aus dem fiktiven Land Disi hineingewachsen. Seine dunklen Haare sind länger geworden, und er trägt so selbstverständlich ein Schwert an der Hüfte, als wäre es nie anders gewesen. In D.C. hat sich niemand mit ihm angelegt, und auch hier trauen sich das nur wenige.
Heute wirkt er sehr ernst.
»Hi«, begrüße ich ihn leise. »Komm rein.«
Sobald er drin ist, schließe ich die Tür hinter ihm.
»Es wundert mich, dass du noch wach bist«, stellt er fest.
»Ich warte auf Rhen.« Nach kurzem Schweigen füge ich hinzu: »Erstaunlich, dass du noch wach bist.«
Jake zögert. »Noah und ich packen gerade.«
Noah ist sein Freund – einst Assistenzarzt in einer überfüllten Notaufnahme in D.C., jetzt der »Heiler« des Schlosses.
Verwirrt ziehe ich die Augenbrauen hoch. »Wie, ihr packt?«
Ohne eine Miene zu verziehen, erklärt mein Bruder: »Wir brechen morgen früh auf.«
Das kommt so überraschend, dass ich unwillkürlich einen Schritt zurücktrete.
Ein schmales Lächeln huscht über Jakes Gesicht. »Nicht für immer, Harp. So schlimm ist es nicht.«
»Aber … was soll das heißen: Ihr brecht auf?«
Mit einem Achselzucken geht er zum Fenster hinüber. »Wir hängen jetzt seit Monaten hier rum. Du spielst gerne die höfische Prinzessin, ich weiß, aber ich fühle mich hier wie in einem Käfig.« Er wirft mir einen Blick zu. »Es ist nur für ein paar Wochen. Höchstens einen Monat.«
Schockiert stoße ich den Atem aus. »Einen Monat.«
In einem Monat kann eine Menge geschehen. Gerade ich weiß das nur allzu gut.
»Ich hätte keinerlei Möglichkeit, mich um dich zu kümmern«, sage ich. »Was, wenn etwas passiert? Es dauert Tage, manchmal sogar Wochen, eine Nachricht zu schicken. Wir wissen noch immer nicht, wie sich das Problem mit Syhl Shallow entwickelt oder was aus Rhens Krönung wird oder …«
Jake sieht mich ruhig an. »Du musst dich nicht um mich kümmern, Harper.«
»Aber Sorgen machen darf ich mir ja wohl noch.« Wir waren schon einmal voneinander getrennt, als Grey mich aus D.C. entführt hat, und es war grauenhaft für mich, nicht zu wissen, was mit Jake geschehen war. So etwas will ich nie wieder durchmachen. »Hast du Rhen gefragt? Möglicherweise hält er das ja für keine gute Idee.«
Plötzlich ist Jakes Blick hart wie Stein. »Er ist nicht mein Aufpasser.«
»Ich weiß, aber …«
»Und er weiß Bescheid. Ich habe schon mit ihm gesprochen.«
Das trifft mich unvorbereitet.
»Ich habe ihn gebeten, dir nichts zu sagen«, fügt Jake erklärend hinzu. »Ich wollte das selbst mit dir besprechen.«
Gereizt presse ich die Lippen zusammen. »Offenbar hast du schon alles organisiert.«
»Nein, Harp, habe ich nicht.« Er unterbricht sich kurz. »Ich möchte, dass du mitkommst.«
»Das kann ich nicht, Jake. Du weißt, dass ich das nicht kann.«
»Doch, du kannst. Du kannst ebenso von hier verschwinden wie ich.« Er wendet sich vom Fenster ab, stellt sich direkt vor mich hin und fährt mit gedämpfter Stimme fort: »Er ist auch nicht dein Aufpasser. Du musst deine Abende nicht damit zubringen, auf ihn zu warten.«
»Er hat ein Land zu regieren«, protestiere ich. »Es ist ja nicht so, als wäre er mit seinen Kumpels beim Saufen.«
»Er ist achtzehn Jahre alt, genau wie du.« Wieder zögert Jake, bevor er fragt: »Willst du ihn heiraten?«
Bei dieser Frage bleibt mir die Luft weg.
Mein Bruder sieht mich durchdringend an. »Harp … du weißt doch, dass es genau darauf hinauslaufen wird, wenn du hierbleibst. Er hat sich eine Allianz mit einem erfundenen Land ausgedacht, die allein davon abhängt, dass ihr beide heiratet.«
Das weiß ich. Natürlich weiß ich das.
Mein Schweigen dauert bereits zu lange. Jake geht zum Kamin. »Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
Heiraten. »Ich … ich habe keine Ahnung.«
Er wirft ein Holzscheit auf die Glut und stochert mit dem Schürhaken in den Kohlestücken herum.
»Du solltest es nicht wissen müssen. Genau darauf will ich hinaus.« Erste Flämmchen lecken an dem Holz, und Jake schaut über die Schulter zu mir herüber. »Du solltest nicht in einer Situation feststecken, in der dein Freund gezwungen ist, dich zu heiraten, damit sein Land nicht im Chaos versinkt.«
Ich gehe zum Sofa und lasse mich in die Polster sinken. »Mann, Jake, was bin ich froh, dass du gekommen bist.«
Inzwischen blickt er wieder ins Feuer, das nun richtig aufflackert und sein braunes Haar mit einem rötlich-goldenen Glanz überzieht. »Ich weiß, dass unser Leben in D.C. nicht einfach war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre es hier auch nicht besser.«
»Wir wurden von einem Bewaffneten bedroht, als wir Washington verlassen haben«, betone ich.
»Ich weiß, ich weiß.« Als er nichts weiter sagt, ist mir klar, dass dies nichts an seiner Meinung ändert.
Und ich weiß nicht, was ich ihm noch sagen soll. »Ich kann nicht weg, Jake.«
»Du liebst ihn.«
»Ja.«
Mit einem tiefen Seufzer setzt er sich zu mir auf das Sofa. Ich lege den Kopf an seine Schulter, und wir starren gemeinsam in die Flammen.
»Die Gerüchteküche brodelt«, sagt Jake irgendwann. »Dass er nicht der rechtmäßige Erbe ist. Dass Karis Luran wieder angreifen wird.«
»Das erzählen sich die Leute doch schon seit Monaten.«
»Inzwischen wundern sie sich aber auch darüber, dass die Truppen aus Disi noch nicht eingetroffen sind. Man munkelt, eure Allianz sei nur Fake.« Er wirft mir einen stechenden Blick zu. »Ich gehe nicht nur, um hier rauszukommen. Ich will auch herausfinden, was außerhalb des Schlosses tatsächlich vorgeht.«
»Rhen würde uns niemals anlügen.«
Nun mustert mich Jake eine ganze Weile, bevor er sagt: »Rhen belügt das gesamte Land. Wenn du wirklich glaubst, er wäre nicht dazu fähig, uns ebenfalls zu belügen, solltest du genauer hinsehen.«
Ich schlucke schwer. Nein, so ist Rhen nicht. »Du brauchst jetzt keinen Streit vom Zaun zu brechen, Jake.«
»Tue ich nicht. Ich bitte dich einfach nur darum, selbstständig zu denken.« Verbittert schüttelt er den Kopf. »Noah hat nicht daran geglaubt, dass du mitkommst. Ich hatte gehofft, du würdest es dir zumindest überlegen.«
Mein rastloser Bruder, der so viele schreckliche Dinge getan hat, um mich zu beschützen. Tief in seinem Inneren ist er eben doch liebevoll und mitfühlend. Das weiß ich genau. »Es tut mir leid.«
Frustriert knirscht Jake mit den Zähnen. »Wenn wir wenigstens wüssten, ob Grey tot ist oder noch lebt.«
»Ja, das wüsste ich auch gern«, nicke ich mit einem schweren Seufzer.
»Allerdings aus anderen Gründen«, stellt Jake fest. »Er war es schließlich, der uns hierhergeschleppt hat.« Kopfschüttelnd reibt er sich das Kinn. Plötzlich wirkt er angespannt. »Falls er jemals wieder auftaucht, werde ich dafür sorgen, dass er das bitter bereut.«
Keine sonderlich schlimme Drohung. Grey ist vermutlich tot oder sitzt auf der anderen Seite fest, was fast genauso schlimm wäre. »Warum bist du eigentlich so wütend?«
Sein Blick erinnert mich an einen Gewittersturm kurz vor dem Ausbruch. »Ich sehe jetzt seit Monaten dabei zu, wie sie dich für ihre Zwecke ausnutzen, Harper.«
»Niemand hier nutzt mich aus …«
»Oh doch, das tun sie. Grey hat dich hergebracht, damit du einen Fluch brichst, mit dem du rein gar nichts zu tun hattest. Dann bist du entkommen, und er hat dich wieder her geschleift.«
»Ich wollte zurückkommen.« Wirklich. Und ich bereue diese Entscheidung absolut nicht.
Doch erst in diesem Moment, als ich Jake in die Augen sehe, begreife ich, dass er meine Entscheidung bereut. Auch wenn sie ihm vermutlich das Leben gerettet hat, sitzt er nun hier fest und kann nicht wieder nach Hause.
Der Türriegel klickt, und als ich mich umdrehe, steht – wenig überraschend – Rhen in der Tür.
Der Prinz ist noch immer formell gekleidet, die blaue Jacke bis zum Hals geschlossen, mit Schwert an der Hüfte. Das Kaminfeuer lässt seine Haare wie Gold schimmern, kann aber nicht verbergen, wie müde sein Blick ist. Als er mich mit Jake auf dem Sofa entdeckt, bleibt er stehen. Die Spannung hier drin ist so greifbar, dass er sie vermutlich sofort spürt.
»Verzeihung«, sagt Rhen langsam. »Es ist spät. Ich dachte, du wärst allein.«
Jake seufzt hörbar. »Du solltest allein sein. Ich werde gehen.« Er beugt sich vor und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. »Pass auf dich auf, Harper. Das meine ich ernst.«
Damit nimmt er seinen bisherigen Worten die Schärfe. »Danke, großer Bruder.«
Jake wendet sich noch einmal Rhen zu, bevor er nach der Türklinke greift. »Ich breche trotzdem morgen auf«, betont er.
»Eigentlich sogar heute«, stellt Rhen ebenso ruhig fest. »Mitternacht ist längst vorüber.« Sein Blick wandert zu der Dunkelheit hinter dem Fenster. »Dustan wird euch mit einer kleinen Wachmannschaft begleiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei Tagesanbruch losreiten.« Das scheint Jake kurz aus dem Konzept zu bringen, aber er erholt sich schnell. »Gut.«
Fragend zieht Rhen eine Augenbraue hoch. »Dachtest du etwa, ich würde nicht zu meinem Wort stehen?«
»Ich dachte, andere Dinge wären für dich von größerer Wichtigkeit.«
»So ist es.« Rhen zieht die Tür weiter auf und hält sie fest. Ein eindeutiger Rausschmiss.
Jake setzt zu einem Protest an.
Wenn er will, kann Rhen äußerst geduldig sein, doch ich spüre, dass jetzt keiner dieser Momente ist. »Jake«, mahne ich deshalb. »Du hast bekommen, was du willst.«
»Nicht einmal annähernd.« Doch es reicht, um meinem Bruder den Trotz zu nehmen, denn er geht.
Sobald er weg ist, kommt Rhen zu mir herüber. Mit jedem Tag scheinen die Schatten unter seinen Augen tiefer zu werden. Eine finstere, verhaltene Wachsamkeit hat Besitz von ihm ergriffen und lässt ihn nicht mehr los.
»Geht es dir gut?«, frage ich ihn. Wenn er von den Sitzungen mit seinen Ratgebern kommt, ist er immer sehr verschlossen, aber heute ist das noch stärker als sonst. Er wirkt richtig distanziert. Hart. Würde ich ihn nicht kennen, würde ich vor ihm zurückschrecken. »Was ist denn los? Es ist schon wahnsinnig spät. Ich dachte …«
Er schlingt einen Arm um meine Taille, und ich schnappe nach Luft. Dann spüre ich seine Lippen auf meinen.
Rhen ist so stark und tüchtig, dass es mich immer noch überrascht, wenn er plötzlich sanft wird. Gerade ist er noch durch das Zimmer marschiert, als wäre er auf einem Kriegszug, und dann küsst er mich, als wäre ich die zerbrechlichste Kostbarkeit des ganzen Schlosses. Ich spüre die Wärme seiner Finger durch mein Nachthemd, ihren leichten Druck an meinem Bauch. Schnell lege ich meine Hände an seine Jacke und sauge seinen Duft in mich auf, lasse die Nähe zu ihm die leise Sorge vertreiben, die Jake in mir geweckt hat.
Als Rhen sich von mir löst, zieht er sich gerade mal so weit zurück, dass er sprechen kann. Ich spüre seinen Atem an meinen Lippen, als er mit einem durchdringenden Blick sagt: »Selbst am anderen Ende des Schlosses habe ich gespürt, wie besorgt du bist.« Sanft streicht er mit dem Daumen über meine Wange. »Und ich spüre das jetzt noch.«
Röte steigt in meine Wangen, und ich weiche seinem Blick aus. Nervös spiele ich mit den Schnallen an seiner Jacke, als müssten sie zurechtgerückt werden. Was natürlich nicht der Fall ist. »Ich bin okay.«
»Harper«, mahnt er leise. Er legt seine Hand auf meine Finger, zwingt sie zur Ruhe.
Ich liebe es, wie er meinen Namen ausspricht. Durch seinen Akzent werden die Rs so betont, dass es beinahe wie ein Schnurren klingt. Oft ist er so förmlich, dass mein Vorname beinahe eine Art geheime Kostbarkeit für uns ist.
Jetzt hebt er mit einem Finger mein Kinn an, damit ich ihm ins Gesicht sehe. »Sag mir, was dich bedrückt.«
»Jake hat mir gerade gesagt, dass er fortgeht.«
»Ah.« Rhen seufzt verstehend. »Dein Bruder ist waghalsig, es fehlt ihm an Geduld, und der Zeitpunkt könnte besser sein – aber auch schlechter. Lieber schicke ich ihn mit meinem Segen los, als dass ich später erfahre, dass er irgendwo im Reich Unruhe gestiftet hat. Dustan wird zu verhindern wissen, dass er in größere Schwierigkeiten gerät.«
»Es überrascht mich schon, dass du ihm den Kommandanten deiner Garde mitgibst.«
»Mir wäre es anders auch lieber, aber ich habe nicht viele Männer, denen ich eine solche Mission anvertrauen könnte. Die Königliche Garde ist noch unerprobt, doch dein Bruder beharrt ja darauf, jetzt zu gehen, ob es mir nun gefällt oder nicht.«
Ja, das klingt definitiv nach Jake.
Rhen mustert mich aufmerksam. »Wäre es dir lieber, wenn ich Zo mitschicke?«
»Nein.« Wenn mein Bruder geht, kann ich nicht auch noch meine Freundin verlieren. »Hat Jake dir erzählt, dass er möchte, dass ich ihn begleite?«
Rhen erstarrt kurz. »Nein. Und wie lautet deine Entscheidung?«
Das gefällt mir mit am besten an ihm: Er ist gebieterisch und entschlossen und gerät nie ins Wanken, aber meine Entscheidungen überlässt er ausnahmslos mir selbst. »Ich habe abgelehnt.«
Er atmet auf, dann küsst er mich wieder. »Ich habe so lange auf dich gewartet, dass ich nun befürchte, das Schicksal könnte dich mir wieder nehmen.«
Ich drücke die Stirn an seinen Hals und atme seinen warmen Duft ein. »Ich werde nirgendwo hingehen.«
Schweigend drückt er mich an sich, doch ich spüre, dass er noch immer besorgt ist.
Unentschlossen beiße ich mir auf die Lippe; eigentlich will ich nicht, dass seine Anspannung sich noch weiter verschlimmert. »Jake meinte, die Gerüchte um den zweiten Erben hätten zugenommen.«
»Das stimmt.«
Ich lege eine Hand an seine Brust, während ich mir Jakes Worte noch einmal durch den Kopf gehen lasse. »Sprich mit mir, Rhen.«
Er stößt einen gereizten Seufzer aus. »Dieser Erbe existiert. Es gibt Aufzeichnungen darüber, mit dem Siegel meines Vaters. Eigentlich wollte ich die Krönung so bald wie möglich ansetzen, aber viele der Adeligen verlangen einen Beweis dafür, dass die Erbfolge korrekt ist. Also werde ich nun alles tun, um ihnen einen solchen zu liefern.«
»Und wie willst du diesen Erben aufspüren?«
»Das könnte sich als unmöglich erweisen. Vielleicht ist er schon gar nicht mehr am Leben. Wir haben sehr wenige Ausgangspunkte für unsere Suche. Falls seine Mutter – wie die Dokumente es andeuten – eine Magierin war, müsste er über magische Fähigkeiten verfügen, wie die Zauberin Lilith. Sie hat mir einmal gesagt, das Netz der Magie ende nicht bei ihr, dass sie die Existenz eines anderen spüre, der ebenfalls diese Kräfte in sich trage. Zwar ist die Magie bereits seit vielen Jahren aus Emberfall verbannt, aber wenn wir verbreiten lassen, dass es jemanden mit diesen Kräften gibt, dürften sie sich nur schwer verbergen lassen.«
Lilith. Schon wenn ich nur ihren Namen höre, überläuft es mich kalt. »Und was wirst du tun, wenn du ihn findest?«
»Sollte er tatsächlich magische Kräfte haben, wird er vernichtet.«
Mit einem Ruck löse ich mich von ihm. »Rhen!«
Doch er erwidert nichts. Muss er auch gar nicht. Der Ausdruck in seinen Augen verrät schon alles.
Ich weiche noch einen Schritt zurück. »Dieser Mann ist dein Bruder.«
»Nein. Er ist ein Fremder«, erwidert er unerbittlich. »Ich war eine Ewigkeit in den Klauen einer Magierin gefangen, und es hat mein Land an den Rand des Untergangs getrieben. Ich werde nicht riskieren, dass Emberfall von einem zweiten Magier vernichtet wird.«
Vollkommen starr stehe ich da. Obwohl direkt neben mir ein Feuer brennt, hat sich eisige Kälte in mir ausgebreitet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schon einmal habe ich miterlebt, wie er den Tod eines Menschen befohlen hat, aber dieser Mann hatte einen unserer Wachleute getötet, hätte auch uns getötet, wenn er die Chance dazu gehabt hätte.
Das hier ist etwas anderes. Es geschieht aus Berechnung. Mit Vorsatz.
Rhen kommt näher und will eine Hand an meine Wange legen, doch ich weiche zurück. Mit ausdrucksloser Miene sagt er: »Ich wollte dich nicht aufregen.« Das meint er aufrichtig. »Mir war nicht klar, dass es für dich so unerwartet kommt. Schließlich hast du mit eigenen Augen gesehen, was Lilith angerichtet hat.«
Ja, das habe ich. Wieder und wieder habe ich miterlebt, wie sie Rhen gefoltert hat. Wie er ihr vollkommen hilflos ausgeliefert war.
»Du hast sicherlich recht«, nicke ich, obwohl ich mir da überhaupt nicht sicher bin. Schaudernd hole ich Luft und drücke zur Beruhigung eine Hand auf meinen Bauch.
Rhen hat schon oft bewiesen, dass er tun wird, was nötig ist, um Emberfall zusammenzuhalten. Und nun beweist er es wieder.
»Du darfst dich nicht von mir zurückziehen«, sagt er leise. Ein ungewohnter Ton hat sich in seine Stimme geschlichen. Es ist nicht wirklich Verletzlichkeit – das niemals –, aber etwas sehr Ähnliches. »Bitte. Das könnte ich nicht ertragen.«
Er wirkt so erschöpft, ist so angespannt. Wann er wohl das letzte Mal geschlafen hat? Mit einem tiefen Atemzug vertreibe ich das Zittern aus meinen Händen und schlinge ihm die Arme um den Bauch.
»Sag mir, was dich bedrückt«, flüstere ich.
»Wir wissen nicht einmal, ob Lilith tot ist«, beginnt Rhen. »Sollte sie diesen Erben aufspüren, sollten die beiden sich gegen mich verbünden …«
»Es ist jetzt Monate her. Entweder ist sie auf der anderen Seite gefangen oder Grey ist es.«
»Oder er hat ihr seinen Eid geleistet, wie wir es ja gesehen haben, und sie wartet nur auf den richtigen Moment.«
Grey hat Lilith Treue geschworen, um mich zu retten – um ihr dann sein Schwert an die Kehle zu drücken und mit ihr auf die andere Seite zu verschwinden, nach Washington, D.C.
»Er würde ihr niemals helfen«, betone ich. »Rhen. Das würde er nie tun.«
»Ich muss mein Volk beschützen, Harper.«
Rhen lehnt sich an mich, und ich höre, wie sein Atem sich verlangsamt. Als ich eine Hand an seine Wange lege, schließt er die Augen. Vor einigen Monaten gab es einen Moment, als er das Monster war … da hat er seinen Kopf an meine Hand gedrückt und ist auch ganz ruhig geworden, so wie jetzt. Damals konnte ich seine Angst spüren. Genau wie jetzt.
»Du bist kein Monster mehr«, flüstere ich.
»Ich habe einige Wachen zum Haus von Greys Mutter geschickt, ins Wildthorne-Tal«, sagt er langsam.
Meine Hand erstarrt an seiner Wange. »Was? Wann?«
»Letzte Woche. Nur um sicherzugehen.« Er unterbricht sich kurz. »Heute sind sie zurückgekehrt.«
Grey hat mir einmal erzählt, dass Lilith seine gesamte Familie getötet hat, nur seine Mutter ließ sie am Leben. »Und, was haben sie gefunden?«
»Seine Mutter war fort. Im Ort sagten sie, sie hätte schon vor Monaten ihr Vieh verkauft und sei weggezogen. Niemand wusste, wo sie hin ist.« Wieder zögert er. »Angeblich war für eine Weile ein Verwundeter bei ihr untergekommen, aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen.«
Mir stockt der Atem. »Grey könnte also noch leben«, flüstere ich.
»Ja.« Trotz seines unerbittlichen Tonfalls höre ich die Sorge und die Unsicherheit heraus, die Rhen zu verbergen versucht. »Nach allem, was mir berichtet wurde, gehe ich davon aus, dass Grey quicklebendig ist.«
Ich schaue zu ihm hoch. »Grey würde ihr niemals Gefolgschaft schwören, Rhen.«
»Falls das wirklich so ist, warum ist er dann nicht nach Ironrose zurückgekehrt?«
Ich versuche, eine Antwort zu finden. Vergeblich.
»Karis Luran könnte jederzeit angreifen«, fährt Rhen fort. »Dieser Erbe könnte jederzeit in Erscheinung treten.« Nach einer kurzen Pause ergänzt er: »Und Lilith könnte nur auf den perfekten Moment lauern, um zuzuschlagen.«
Wieder lege ich meinen Kopf an Rhens Brust und sehe zum Fenster hinüber, hinter dem der Sternenhimmel funkelt. »Ach, Grey«, sage ich leise. »Wo steckst du nur?«
»Das ist die Frage«, seufzt Rhen. In jedem Wort schwingen Sehnsucht, Trauer und Sorge mit. Sanft haucht er einen Kuss auf mein Haar. »Das ist die Frage.«
2 Grey
Am späten Nachmittag ist die Sonne immer drückend heiß, aber mir macht das nichts aus, denn um diese Zeit ist es ruhig in den Ställen, höchstens einer der Stallburschen leistet mir Gesellschaft.
An diesem Ort wird wohl niemand nach mir suchen, also ist es mir nur recht.
Der Schweiß an meinen Armen zieht Staub und Schmutzflöckchen an, während ich die Mistgabel schwinge. Die Hitze wird noch schlimmer werden, bevor es sich abkühlt, aber daran bin ich gewöhnt. Worwicks Turnierplatz ist bis zur Abenddämmerung geschlossen, und außer mir und Tycho ist niemand hier. Später werden in den Ställen wieder Männer brüllend nach ihren Pferden verlangen oder sich um die Mietwaffen streiten, die am Ende der Stallgasse aufbewahrt werden. Wenn dann erst mal der Alkohol fließt und die Ränge des Stadions sich mit erlebnishungrigem Publikum füllen, wird der Lärm ohrenbetäubend sein.
Aber jetzt ist das Stadion leer, und die Ställe müssen gründlich gereinigt werden. Das hier hat rein gar nichts mehr mit dem extravaganten Luxus von Ironrose zu tun, weit weg sind die Zeiten, als ich Kommandant der Königlichen Garde von Emberfall war.
Tycho singt beim Misten vor sich hin, allerdings so leise, dass ich neben den Geräuschen der Pferde nicht einmal die Melodie erkennen kann. Er ist klein für sein Alter, und durch seinen drahtigen Körperbau wirkt er wie zwölf, nicht wie fünfzehn, was ihn allerdings nicht daran hindert, äußerst schnell und zupackend zu arbeiten. Seine dunkelblonden, kinnlangen Haare hängen ihm ins Gesicht und verstecken das strahlende Blau seiner Augen.
Tycho mag diese Tageszeit ebenfalls, allerdings aus anderen Gründen. Biertrunkene Männer suchen nach den Turnieren oft noch nach anderer Unterhaltung. Ich habe gehört, wie sie Worwick Geld für eine Stunde mit Tycho geboten haben. Und ich habe gesehen, dass Worwick es in Erwägung zog.
Dieser Junge weiß allerdings, wie man sich rar macht.
Während der letzten Wochen habe ich versucht, dafür zu sorgen, dass er stattdessen lernt, sich zu verteidigen.
»Wie viele hast du noch?«, rufe ich zu ihm hinüber.
»Drei«, lautet seine Antwort. Er wischt sich mit dem Unterarm die Stirn. »Höllenglanz, ist das heiß.«
Ich schaue durch das Stallfenster, um den Stand der Sonne zu prüfen. Uns bleiben noch ein paar Stunden bis zur Dämmerung. »Ich übernehme deine drei. Mach dich auf zum Knurrenden Hund. Jodi meinte, sie kriegt diese Woche Krebse aus Silvermoon rein.«
Tycho kommt aus seiner Box. »Mensch, Hawk! Jodis Kneipe ist auf der anderen Seite der Stadt.«
Hawk. Drei Monate, und ich habe mich noch immer nicht an den Namen gewöhnt. Grinsend streiche ich mir die feuchten Haare aus der Stirn. »Dann solltest du besser schnell sein. Gedämpfte Krebse kosten ein Kupferstück pro Krebs.«
Der Junge seufzt schwer, doch schon im nächsten Moment entfernt sich das Klatschen seiner nackten Füße in der Stallgasse. »Wenn ich gewinne, bestelle ich mir ein Dutzend«, ruft er noch über die Schulter.
Er wird nicht gewinnen. Nicht einmal mit dem Vorsprung, den ich ihm gegeben habe.
Doch es wird jedes Mal knapper.
Als ich hier ankam, litt ich noch unter den Wunden, die ich mir beim letzten Kampf gegen Lilith zugezogen hatte. Wochenlang quälten mich Albträume, die mich völlig auslaugt haben. Was ich an Energie hatte, brauchte ich für die Stallarbeit und das Reinigen der Waffen.
Doch sobald alles verheilt war, machte mich die Langeweile des monotonen Lebens am Turnierplatz rastlos. Mir fehlten die körperlichen Strapazen, die der Königlichen Garde abverlangt werden. Ein paar Stunden mit Mistgabel und Lappen waren gar nichts im Vergleich zu dem ewigen Drill und den Übungsrunden mit dem Schwert. Ich fing an, vor Sonnenaufgang aufzustehen und in der Dämmerung einmal um die Stadt zu laufen oder die Leitern an den Stützpfeilern des Stadiondaches auf und ab zu klettern.
Ich weiß nicht, wie lange Tycho mir dabei gefolgt ist, bis ich ihn erwischt habe, doch es war auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, als ich noch von der Angst getrieben wurde, jemand könnte mich entdecken. Sein Glück, dass ich keine Waffe bei mir hatte.
Oder vielleicht war es auch mein Glück. Mein Geschick im Umgang mit Waffen hätte sicherlich Aufmerksamkeit erregt. Falls hier jemand nach einem fähigen Schwertkämpfer sucht, sollen die Leute jedenfalls nicht auf mich zeigen. Manchmal trainiere ich Tycho mit unseren Übungswaffen, achte aber immer darauf, nur ganz einfache Techniken anzuwenden und ihm eine Menge Treffer zu erlauben.
Draußen quietscht ein Fuhrwerk, und der schwere Hufschlag von Zugpferden wird laut. Dann ruft eine polternde Stimme: »Tycho! Hawk! Kommt her und seht euch an, was ich mitgebracht habe!«
Worwick. Ich kann mir ein Stöhnen nicht verkneifen. Das könnte alles sein, von einem Eisblock über einen rostigen Nagel bis hin zum Leichnam eines Fischers.
Wenn man die Hitze bedenkt, kann ich nur hoffen, dass es nicht Letzteres ist.
Ich verlasse den Stall und wische mir die Hände an der Hose ab. Auf dem Fuhrwerk steht anscheinend eine riesige Kiste – mehr als mannshoch und mit einer langen Stoffbahn bedeckt, deren Enden an den Ecken des Wagens festgezurrt sind. Die Zugpferde sind schweißnass, Schaum tropft von ihren Mäulern.
Worwick treibt die Tiere immer zu sehr an. Ich werde sie abwaschen müssen, bevor ich meinen Lauf durch die Stadt beginnen kann. Vielleicht kann Tycho heute also doch gewinnen.
Worwick macht ein Gesicht, als hätte er einen Batzen königlichen Silbers gefunden. Er hüpft beinahe vom Kutschbock, was bei seinem Gewicht schon einiges heißt. Dann zieht er ein Tuch aus der Tasche und wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Ihr werdet es nicht glauben«, verkündet er. »Ihr werdet es einfach nicht glauben.«
»Was ist es denn?«, frage ich.
»Wo ist Tycho?« Offenbar kann sich Worwick nur mit Mühe ein freudiges Kichern verkneifen. »Ich will sehen, wie er reagiert.«
Der ist schon zu einem Wettrennen gegen mich angetreten, das damit enden wird, dass ich ihm gedämpfte Krebse spendieren muss, wenn du das hier weiter so in die Länge ziehst. »Ich habe ihn in die Stadt geschickt, damit er eine Salbe für die Pferde besorgt.«
»Ach so. Sehr schade.« Worwick seufzt enttäuscht. »Dann muss ich mir wohl deine ansehen.«
Von mir wird er keine besonders ausgeprägte Reaktion zu sehen kriegen, was er auch weiß. Worwick hält mich für stoisch und fantasielos. Dabei habe ich einfach zu lange dem Kronprinzen gedient – in menschlicher und monströser Gestalt –, um noch mit der Wimper zu zucken, wenn Worwick enthüllt, was unter dieser Plane ist.
Er ist kein schlechter Mensch, einfach etwas grob gestrickt und zu sehr darauf erpicht, sich die Taschen zu füllen. Als Kommandant Grey hätte ich ihn bemitleidet.
Als Hawk toleriere ich ihn einfach.
»Dann mal los«, fordere ich ihn auf.
»Hilf mir dabei, die Plane abzumachen.«
Die Seile sind doppelt verknotet und extrem straff gezogen. Ich bin bereits an der zweiten Ecke, als mir klar wird, dass Worwick noch immer neben dem Wagen steht und mir zusieht.
Typisch. Endlich löst sich das zweite Seil, und ich schlage die Plane zurück.
Es ist ein Käfig. Ich blicke auf … ein Wesen, das ich nicht identifizieren kann. Es hat ungefähr die Gestalt eines Menschen, aber seine Haut weist die Färbung eines wolkenverhangenen Nachthimmels auf. Auf seinem Rücken wachsen Flügel, die mit einem Seil zusammengebunden sind, und es hat einen Schwanz, der schlaff auf dem Boden des Käfigs zusammengerollt ist. An Händen und Füßen wachsen dem Wesen lange Krallen, außerdem hat es rabenschwarzes Haar, das nass ist von seinem Schweiß.
Und es rührt sich nicht.
»Gute Güte«, ruft Worwick. »Meinst du, es ist tot?«
»Auf jeden Fall kurz davor.« Ich werfe ihm einen finsteren Blick zu. »Wie lange war es so abgedeckt?«
»Zwei Stunden.«
»Bei dieser Hitze?«
Worwick schlägt eine Hand vor den Mund. »Oh je.«
»Es braucht Wasser.« Als Worwick sich nicht von der Stelle rührt, springe ich vom Wagen und hole einen Eimer aus dem Stall.
Bei meiner Rückkehr hat sich das Wesen noch immer nicht bewegt. Ich steige wieder auf den Wagen und hocke mich neben den Käfig. Der Brustkorb der Kreatur weitet sich etwas; zumindest atmet es also. Ich schöpfe mit der Hand etwas Wasser aus dem Eimer und strecke meinen Arm durch die Gitterstäbe, bis ich die Flüssigkeit über sein Gesicht träufeln kann. Seine Nase ist etwas schmaler als die eines Menschen, der Kiefer jedoch breiter. Das Wasser hinterlässt eine glänzende Spur auf seiner rauchfarbenen Haut.
»Was ist das?«, will ich von Worwick wissen. »Und wo hast du es her?«
»Das ist ein Scraver«, erklärt er. »Es hieß, er sei hoch oben im Norden gefangen worden, in den Eiswäldern jenseits von Syhl Shallow. Ich habe ihn beim Kartenspielen gewonnen! Heute war das Schicksal mir besonders hold, mein Junge.«
Ein Scraver. Als ich noch ein Kind war, hat man mir Geschichten über solche Wesen erzählt, aber es ist zu lange her. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. »Ich dachte, die wären nichts als Mythen. Etwas, womit man kleine Kinder erschreckt.«
»Anscheinend nicht.«
Wieder schöpfe ich etwas Wasser und lasse es über das Gesicht des Wesens laufen, dabei schnalze ich mit der Zunge, als hätte ich ein Pferd vor mir. Die Lider des Scravers flattern kurz, doch ansonsten bleibt er reglos liegen.
»Kannst du dir vorstellen, dass die zwei Kupferstücke von jedem verlangt haben, der ihn sich ansehen wollte?«, erzählt Worwick weiter. »Eine Schande war das.«
Überrascht ziehe ich die Brauen hoch. Mitgefühl ist eine Regung, die ich bei Worwick noch nicht oft erlebt habe. »Da kann ich nur zustimmen.«
»Ganz genau. Für einen Scraver? Da zahlen die Leute doch sicher fünf!«
Ach ja. Natürlich.
Als ich zum dritten Mal Wasser schöpfe, zuckt das Wesen kurz. Sein Mund bewegt sich, sucht nach der Flüssigkeit. Seine Krallen schaben über den Käfigboden, als er versucht, sich näher an mich heranzuschieben. Doch seine Bewegungen sind so schwach, dass man nur Mitleid mit ihm haben kann.
»Schön langsam«, sage ich leise. »Ich habe noch mehr.« Wieder tauche ich meine Hand in den Eimer; ich werde wohl eine Kelle holen müssen.
Der Scraver atmet tief ein, und seine Nasenflügel blähen sich. Dann dringt ein leiser Ton aus seiner Brust. Ich schiebe meine Hand so dicht an seinen Mund heran, wie es geht.
Seine Augen öffnen sich; sie sind pechschwarz. Aus dem leisen Ton wird ein Knurren.
»Ruhig«, mahne ich. »Ich werde dir nicht weh …«
Blitzartig stürzt er sich auf meine Hand. Ich reagiere sofort, aber er ist schneller. Scharfe Zähne graben sich in meinen Unterarm, bevor ich es schaffe, ihn aus dem Käfig zu ziehen. Ich reiße mich los und taumle rückwärts, stolpere über den Eimer und kann gerade noch verhindern, dass ich vom Wagen falle.
Worwick starrt mich an, dann bricht er in schallendes Gelächter aus. »Oh nein, es ist wohl doch besser, dass du hier warst. Tycho hätte sich bestimmt nicht getraut, da die Hand reinzustecken.«
Beim Höllenglanz, mein Unterarm blutet heftig. Schmutz und Schweiß sorgen dafür, dass die Wunde richtig schön brennt.
Der Scraver hat sich an das andere Ende des Käfigs zurückgezogen. In dieser Position kann ich erkennen, dass das Wesen eindeutig und unverkennbar männlich ist. Finster und mit halb gebleckten Reißzähnen starrt es mich an; in den dunklen Augen flackert eine eindeutige Warnung.
»Nun wirst du warten müssen, bis du Wasser bekommst«, stelle ich fest.
»Was meinst du, was sollen wir mit ihm machen?«, fragt Worwick.
Ich seufze müde. Mein Unterarm brennt, und ich bin halb verhungert. Außerdem werde ich Tycho holen und vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein müssen, sonst gibt es einen Riesenärger. »Wir können ihn nicht hier draußen in der Sonne lassen. Lass uns den Wagen ins Stadion bringen«, beschließe ich. »Nach dem Turnier können wir uns dann überlegen, was wir mit ihm anfangen.«
»Guter Mann, Hawk.« Worwick schlägt mir kräftig auf die Schulter. »Du findest mich in meinem Büro, falls du mich brauchst.«
Ich Glückspilz.
Tycho sitzt am Tresen, mit einer halb verschlungenen Portion Krebse vor sich und einem breiten Grinsen im Gesicht. Da es noch früh ist, sind nur wenige Gäste in der Schänke, und er hat den ganzen Tresen für sich. Als ich seine stolze Miene sehe, bin ich fast froh darüber, dass Worwick mit einem Problem angefahren gekommen ist, das ich für ihn lösen musste.
Unwillkürlich erwidere ich Tychos Lächeln. »Bloß nicht übermütig werden.«
Er wendet sich grinsend an die junge Frau hinter dem Tresen: »Ich denke, ich nehme noch ein Dutzend, Jodi. Hawk bezahlt.«
Sie lächelt so herzlich, dass ihre goldbraunen Augen strahlen. »Das hast du bereits gesagt.«
Ich schnaube abfällig. »Schon von dem, was da noch steht, wird dir schlecht werden. Und ich werde dich ganz sicher nicht nach Hause tragen.«
»Ich weiß.« Er schiebt den Teller zu mir rüber. »Die zweite Hälfte ist für dich.«
Nachdem ich auf dem freien Hocker neben Tycho Platz genommen habe, stellt Jodi mir Besteck und einen zweiten Teller hin. Der Weg durch die Stadt war lang, anstrengend und hat mir den Appetit geraubt, doch ich nehme mir trotzdem einen Krebs von dem Haufen. Normalerweise ist Tycho extrem zurückhaltend, weshalb ich ihm jetzt nicht die Stimmung vermiesen will.
Jodi kommt zu uns und lehnt sich entspannt gegen den Tresen. Ihr braunes Haar ist so lang, dass es ihr bis zur Hüfte reicht, und in einige Strähnen sind Federn und Steine eingeflochten. Auf ihren sonnengebräunten Wangen tummeln sich Sommersprossen, und sie hat eine winzige Lücke zwischen den Schneidezähnen. Als sie sich nun mit den Unterarmen auf den Tresen stützt, droht ihr Busen aus dem Ausschnitt ihres Kleides zu fallen; dazu schenkt sie mir ein strahlendes Lächeln.
Zwar verfehlt dieser Anblick nicht seine Wirkung bei mir, doch ich habe so lange jeder Art von Beziehung abgeschworen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, eine Frau attraktiv zu finden.
Nein, das stimmt nicht. Ich weiß noch, wie es bei Harper war: die Freundlichkeit in ihrem Blick, ihre unerschöpfliche Beharrlichkeit, das Gefühl ihrer Hand in meiner, als ich ihr beigebracht habe, wie man ein Messer wirft.
Damals verboten, heute verboten. Erinnerungen an Harper führen zu nichts, also schiebe ich sie beiseite.
»Wein oder Bier?«, will Jodi wissen.
»Wasser.« Ich zerteile ein Krebsbein mit dem Messer und schabe das Fleisch raus. »Wenn es dir nichts ausmacht.«
Sie verzieht die Lippen. »Du trinkst offenbar nie.«
Achselzuckend erwidere ich: »Tycho hat schon mein ganzes Geld für das Essen ausgegeben.« Das ist zwar nicht wahr, aber ich vertrage einfach keinen Alkohol. Als Mitglied der Garde war er für mich verboten, und als ich einmal mit Rhen eine Flasche geleert habe, bin ich beinahe aus den Latschen gekippt. In meiner Rolle als Hawk wiederum fürchte ich, dass mir gewisse Wahrheiten herausrutschen könnten, wenn ich einen weiteren Versuch mit Alkohol wage.
Aber vielleicht auch nicht. Während meiner Zeit bei der Königlichen Garde hatte ich immer das Gefühl, mein Leben wäre in zwei Kapitel unterteilt: Im ersten war ich ein kleiner Bauernjunge, der unbedingt seine Familie durchbringen wollte; im zweiten dann ein Mitglied der Garde, das es zu seiner Lebensaufgabe machte, die Königliche Familie zu beschützen. Manchmal schien meine eigene Familie nicht mehr zu sein als eine ferne Erinnerung, eher Gestalten, die meiner Fantasie entsprungen waren, als echte Menschen, mit denen ich zusammengelebt und um die ich mich gesorgt hatte.
Und nun scheine ich ein drittes Kapitel begonnen zu haben. An manchen Tagen kommen mir das Schloss und der Fluch so unwirklich vor wie meine Familie. Ich weiß selbst nicht, wie viel noch von Grey dem Gardisten geblieben ist.
Jodi stellt mir ein Glas Wasser hin. In einem Zug trinke ich es halb aus, wische mir mit einer Serviette den Mund ab und schlitze dann das nächste Krebsbein auf.
»Du isst wie ein Edelmann«, stellt Jodi belustigt fest. »Das ist mir noch nie aufgefallen.«
Ich halte kurz inne, zwinge meine Finger dann aber, das nächste Krebsbein zu knacken. Sie hat nicht unrecht, auch wenn ich diesen Punkt nie bedacht habe: Ich esse wie ein Mann, dem als Teil seiner Ausbildung beigebracht wurde, in königlicher Gesellschaft zu speisen.
Sofort versuche ich, mich weniger geschickt anzustellen, aber das sieht wohl nur gezwungen aus. Wahrscheinlich schneide ich mir so gleich noch einen Finger ab. Also grinse ich Jodi an und versetze Tycho einen spielerischen Stoß. »Wahrscheinlich bist du einfach nur Trunkenbolde gewöhnt, die alles abnagen.«
Tycho lächelt schüchtern. »Also, ich bin jedenfalls nicht betrunken.« Dann bemerkt er den provisorischen Verband an meinem Arm. »Was hast du mit deinem Handgelenk angestellt?«
Ich breche das nächste Krebsbein auf, diesmal mit den Fingern, weil Jodi mich offenbar genau beobachtet. »Worwick hat ein neues Spielzeug.«
»Ein neues Spielzeug?«
Bevor ich antworten kann, wird die Kneipentür so heftig aufgestoßen, dass sie gegen die Wand knallt. Ein halbes Dutzend Männer in voller Rüstung kommt herein; sie tragen das rot-goldene Wappen von Emberfall auf der Brust.
Keine Mitglieder der Königlichen Garde, aber Soldaten der Armee. Nach dem ersten Schreck zwinge ich mich weiterzuessen. Tycho ist ebenfalls sehr still geworden, wohl aus ganz eigenen Gründen.
Plötzlich wünsche ich mir dringend, ich hätte ein Schwert dabei. Möglichst unauffällig packe ich den Griff meines Messers.
Vermutlich ist es dumm. Zwar konnte ich nur einen kurzen Blick auf die Männer werfen, habe aber keinen von ihnen erkannt. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass einer von ihnen mich wiedererkennt. Nicht mit diesen langen Haaren und dem Bart im Gesicht.
Wenn mir das Glück hold ist, werde ich sowieso nicht gesucht. Was ich allerdings nicht mit Sicherheit wissen kann.
Einer der Männer kommt an die Bar und wirft eine Bronzemünze auf den Tresen. »Essen und Wein für meine Männer, wenn ich bitten darf.«
Jodi steckt die Münze ein und deutet einen Knicks an. »Kommt sofort, Mylord.«
Er ist zwar kein Lord, aber das gefällt ihm sicher. Zwei seiner Männer pfeifen spöttisch; sie haben sich einen Tisch vorn an der Tür gesucht.
Der Soldat wirft eine zweite Münze auf den Tresen und räuspert sich. »Hab Dank.«
»Ich danke Euch.« Sie steckt auch diese Münze ein, und als der Mann sich abwendet, zwinkert Jodi mir fröhlich zu.
Es fällt mir schwer, ihr Lächeln zu erwidern. Dafür bin ich zu sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, was die hier wollen. Wir sind ein ganzes Stück von der Grenze entfernt, in diesem kleinen Städtchen kommen daher nicht oft Soldaten vorbei.
Der Mann will gehen, zögert dann aber. Jetzt sieht er mich direkt an.
Ich nippe an meinem Glas und prüfe unauffällig das Gewicht des Messers in meiner Hand. Es wäre mir ein Leichtes, es in seiner Kehle zu versenken. Mein Arm hat den nötigen Bewegungsablauf nicht vergessen. Dieses Messer ist leichter, als es meine Wurfwaffen waren, es bräuchte also weniger …
»Sind das gedämpfte Krebse?«, fragt er. »Wir haben seit Ewigkeiten keine Schalentiere mehr zu Gesicht gekriegt.«
Während ich mich räuspere, lasse ich das Messer los, auch wenn es mir schwerfällt. Trotzdem ist meine Stimme rau, als ich antworte: »Jodi macht die besten Krebse der Stadt.«
»Dann haben wir uns ja den richtigen Laden ausgesucht.«
Erst jetzt sehe ich dem Mann ins Gesicht. Ein Risiko, das ich eingehen muss, da es sonst so wirkt, als hätte ich etwas zu verbergen.
Dunkle Haare, rosiger Teint, kräftig gebaut. Nein, ich kenne ihn nicht. Erleichtert atme ich auf. »Ihr werdet es nicht bereuen.« Nach kurzem Zögern füge ich hinzu: »Weit gereist?«
»Sind auf dem Weg nach Norden, zu Hutchins Schmiede«, antwortet er. »In offizieller Mission.«
»Natürlich.« Ich nicke ihm zu, während ich von meinem Barhocker gleite. »Dann noch gute Reise, Soldat.« Ich lege einige Münzen neben meinen Teller. »Tycho, wir müssen nach Hause.«
Obwohl auf dem Teller noch Krebse liegen, springt er sofort von seinem Hocker und folgt mir zur Tür. Gemeinsam treten wir in das grelle Sonnenlicht hinaus.
Bevor die Tür hinter uns zufällt, höre ich einen der Soldaten sagen: »Beim Glanz des Silbers, Kapitan, die Leute wissen von den Städten, wo es wegen eines zweiten Erben zu Aufständen gekommen ist. Die Gerüchte haben sich überall verbreitet.«
Ich packe Tycho am Ärmel und halte den Atem an, in der Hoffnung, noch mehr zu erfahren.
»Was der Prinz wohl tun wird, wenn er ihn findet?«, überlegt einer der anderen.
Der Kapitan schnaubt abfällig. »Ihm wahrscheinlich den Kopf abschlagen. Der König ist tot, der Kronprinz wird seinen Platz einnehmen. Da lässt er bestimmt nicht zu, dass irgendein Außenseiter …«
Die Tür schlägt zu, und wir stehen draußen in der Sonne.
Nachdenklich sieht Tycho zu mir hoch. »Diese Soldaten haben dich nervös gemacht.«
Es gefällt mir gar nicht, dass er mich so leicht durchschaut hat. Demonstrativ rempele ich ihn mit der Schulter an. »Dich aber auch.«
Sofort wird er rot und weicht meinem Blick aus.
Das hätte ich nicht sagen sollen. Natürlich wollte ich von mir selbst ablenken, aber so habe ich den Fokus direkt auf ihn gelegt. »Wettrennen nach Hause?«, schlage ich vor.
»Ich dachte, du wärst pleite.«
»Wenn du gewinnst, übernehme ich morgen deinen kompletten Stalldienst.«
Ein kurzes Grinsen, dann rennt er los, ohne einen Gedanken an die Hitze oder das viele Krebsfleisch in seinem Magen zu verschwenden. Vermutlich werde ich ihn auf halbem Weg einholen, weil er Letzteres wieder auskotzt.
Ich gehe weiter.
Der König ist tot.
Der Kronprinz wird seinen Platz einnehmen.
Der Kronprinz sollte seinen Platz einnehmen. Überraschenderweise spüre ich plötzlich ein Ziehen in der Brust. Aus genau diesem Grund habe ich Rhen einst einen Eid geschworen, ihm mein Leben gewidmet: um Teil von etwas zu sein, das größer ist als ich.
Und nun stehe ich hier, in den staubigen Straßen von Rillisk, und bin kaum mehr als ein Stallbursche. Der unerkannte Halbbruder des Kronprinzen von Emberfall. Der verschwundene Erbe, der nicht gefunden werden will.
Teil von absolut gar nichts.
3 Lia Mara
Schon seit vielen Meilen schaue ich aus dem Kutschenfenster. Auf dieser Seite der Berge trägt die Luft eine gewisse Schwere in sich, eine Art Schwüle, die den Wunsch in mir weckt, nur in Hosen und Hemd zu reisen, nicht in meinen königlichen Roben. Doch die Schönheit der Landschaft ist es wert. Syhl Shallow besteht vor allem aus flachem Ackerland, in dem hin und wieder eine Stadt auftaucht, und aus einem einzigen, schmalen Fluss. Emberfall hingegen verfügt über eine Menge Täler, Wälder und abwechslungsreiche Landstriche.
Und auch einige niedergebrannte Städte, von denen nur verkohlte Ruinen geblieben sind, nachdem Mutter unsere Soldaten das erste Mal in dieses Land geschickt hatte, um es zu erobern.
Dieser Anblick lenkt meinen Blick immer wieder zurück in die Kutsche. Ich muss mir nicht auch noch ansehen, welche Zerstörung unser Volk hinterlassen hat.
Früher einmal dachte ich, an diesem Muster der Zerstörung etwas ändern zu können, doch dann ernannte Mutter meine jüngere Schwester zu ihrer Erbin.
Die sitzt mir nun gegenüber, offenbar unbeeindruckt von Klima und Landschaft. Nolla Verin hält sich im Schatten und arbeitet an einer Stickarbeit aus rotem und silbernem Garn. So wie ich sie kenne, wird das ein Kopfschmuck für eines ihrer Pferde.
Sie würde beim Anblick der niedergebrannten Städte nicht mit der Wimper zucken. Es gibt wohl nichts, wovor Nolla Verin zurückscheut.
Deshalb wurde auch meine Schwester zur Thronfolgerin ernannt, und nicht ich.
Nolla Verin verzieht belustigt die Lippen. »Dir ist schon klar, dass wir hier als Feinde betrachtet werden, Lia Mara?«, fragt sie in unserer Muttersprache Syssalah.
Trotzdem kann ich mich nicht vom Anblick des üppigen Grüns dort draußen losreißen. »Mutter hat versucht, dieses Land zu vernichten. Wie könnte es da anders sein?«
»Ich meine ja nur, dass du ein leichtes Ziel abgibst, wenn du dich mit offenem Mund aus dem Fenster hängst.«
Abrupt schließe ich den Mund und gleite zurück auf meinen Sitz, sodass der durchscheinende Vorhang wieder vor das Fenster fällt.
Jetzt grinst Nolla Verin breit. »Und da heißt es immer, du wärst die Schlaue.«
»Ja, richtig. Was mir immer noch lieber ist, als wenn sie mich die Robuste nennen.«
Meine Schwester lacht leise. »Mach eine Liste. Wenn ich Königin bin, lasse ich sie alle für dich hinrichten.«
Wenn ich Königin bin.
Ich schenke ihr ein Lächeln; hoffentlich merkt sie nicht, dass ein Hauch von Traurigkeit darin mitschwingt.
Was nicht daran liegt, dass ich eifersüchtig wäre. Wir haben uns schon vor langer Zeit versprochen, einander immer zu unterstützen, ganz gleich wer von uns ausgewählt wird. Und auch wenn sie zwei Jahre jünger ist als ich … schon jetzt, mit sechzehn, ist sie perfekt dafür geeignet, einmal die Krone unserer Mutter zu tragen. Nolla Verin wurde sozusagen mit Pfeil und Bogen in der Hand geboren und dazu noch mit einem Schwert an der Hüfte. Wie unsere Mutter zögert sie nie, diese Waffen auch einzusetzen. Sie kann selbst die aggressivsten Pferde in unseren Stallungen zureiten. Inzwischen schicken viele der Hohen Häuser ihre Hengstfohlen zu ihr, und sei es nur, um hinterher damit prahlen zu können, dass ihre Pferde von der Tochter der großartigen Königin zugeritten wurden.
Außerdem teilen Nolla Verin und unsere Mutter ihre Neigung zu schnellen, brutalen Urteilen.
Und das macht mich traurig. Meine Schwester lacht beim Gedanken an eine Hinrichtung.
Weil es ihr damit ernst ist.
Doch die Ähnlichkeit der beiden geht noch weiter: Nolla Verin und Mutter sind beide nicht sonderlich groß und verfügen über den athletischen, geschmeidigen Körperbau, der sie zu perfekten Kämpfern macht. Ich hingegen habe nur die roten Haare unserer Mutter, die in meinem Fall bis zur Taille reichen, während Mutter ihr Haar kürzer trägt. Nolla Verins dichtes, glänzendes Haar ist schwarz. Ich bin weder klein noch geschmeidig, was die Angehörigen des Hofstaates oft zu Kommentaren über meine Klugheit verleitet – wenn sie nett sein wollen. Wenn nicht, kommentieren sie meine »Robustheit«.
Meine Schwester hat sich wieder ihrer Stickarbeit zugewandt. Geschickt lassen ihre Finger die Nadel durch den Stoff gleiten. Falls sie nervös ist, zeigt sie es nicht.
Wir reisen nur mit kleiner Entourage: meine Leibwächter Sorra und Parrish bilden die Nachhut, Nolla Verins Wachen Tik und Dyhl reiten in der Mitte. Mutter hat vier Leibwachen, die ihre Kutsche an der Spitze der Reisegruppe umringen.
»Und wenn der Prinz Mutters Angebot ausschlägt?«, frage ich unvermittelt.
Nolla Verin blickt von ihrer Arbeit auf. »Dann wäre er ein Narr. Unsere Streitkräfte könnten dieses erbärmliche Land dem Erdboden gleichmachen.«
Wieder blicke ich aus dem Fenster. Bislang finde ich Emberfall eigentlich nicht erbärmlich. Und Prinz Rhen hat es geschafft, unsere Truppen bis hinter den Pass zurückzudrängen, es wäre also klug, Vorsicht walten zu lassen.
»Hmm. Und meinst du wirklich, eine solche Zerstörung würde die Leute dazu motivieren, ihre Arbeit an den Wasserstraßen weiterzuführen, die wir so dringend brauchen?«
»Das kann unser Volk ebenso gut lernen.«
»Aber wohl schneller, wenn es ihnen von Menschen beigebracht wird, die diese Arbeit bereits beherrschen.«
Mit einem herablassenden Blick meint Nolla Verin: »Du würdest wahrscheinlich noch mit Leckereien um diese Einweisung betteln.«
Mein Blick wandert wieder zum Fenster. Ja, ich bitte lieber um Hilfe, anstatt sie mit dem Schwert in der Hand zu erzwingen, aber das erinnert mich nur ein weiteres Mal daran, warum Nolla Verin erwählt wurde – und nicht ich.
»Sollte es nötig sein, können wir ja ein paar am Leben lassen«, sagt sie nun. »Die werden dann nur zu gern bereit sein, uns zu helfen.«
»Wir können sie alle am Leben lassen, wenn es Mutter gelingt, ein Bündnis zu schmieden.«
»Und so wird es geschehen. Prinz Rhens Ungeheuer ist verschwunden«, betont Nolla Verin. »Unsere Spione berichten, dass sein Herrschaftsanspruch in manchen Städten bereits angezweifelt wird. Wenn er dieses dumme Land halten will, wird er zustimmen.«
Sie ist immer so pragmatisch. Meine Mundwinkel zucken spöttisch. »Und wenn du ihn nun nicht ausstehen kannst?«
Meine Schwester verdreht die Augen. »Als ob das eine Rolle spielen würde. Ich kann auch mit einem Mann ins Bett gehen, den ich nicht leiden kann.«
Ihre Frechheit treibt mir die Schamesröte in die Wangen. »Nolla Verin! Hast du … hast du es etwa schon getan?«
»Na ja. Nein.« Sie sieht mich an und lässt die Stickarbeit ruhen. »Du etwa?«
Meine Wangen werden noch heißer. »Natürlich nicht.«
Begeistert reißt Nolla Verin die Augen auf. »Dann solltest du es zuerst tun und mir dann berichten, was mich erwartet. Hast du gerade Langeweile? Ich kann Parrish sofort antreten lassen. Oder wäre dir Dyhl lieber? Ihr könnt die Kutsche haben …«
Kichernd werfe ich ein Brokatkissen nach ihr. »Du wirst nichts dergleichen tun.«
Geschickt weicht sie dem Wurfgeschoss aus. »Ich bitte dich ja nur um einen schwesterlichen Gefallen.«
»Was ist denn mit Prinz Rhens Verlobter?«
»Prinzessin Harper?« Nolla Verin hat ihre Arbeit wieder aufgenommen, zieht den Faden straff und verknotet ihn. »Die kann natürlich in ihr Bett holen, wen immer sie will.«
»Stell dich nicht dumm, Schwester.«
Sie seufzt. »Darüber mache ich mir keine Gedanken. Diese Allianz ist bedeutungslos. Es sind drei Monate vergangen, seit Emberfall angeblich ein Bündnis mit diesem mysteriösen Disi geschlossen hat. Seitdem sind keinerlei Truppen eingetroffen. Mutter ist der Ansicht, dass der Prinz seinem Volk etwas vormacht, und ich kann ihr da nur zustimmen.«
Ja, ich auch. Während Nolla Verin ihre Zeit am liebsten auf dem Truppenübungsplatz verbringt, habe ich wöchentliche Lehrstunden bei Clanna Sun, der Obersten Ratgeberin unserer Mutter. Von ihr lerne ich alles über Militärstrategie und die fragilen Verflechtungen unserer Hohen Häuser. Während der letzten Monate sah es so aus, als würde Prinz Rhen eine Armee aufstellen, die uns gefährlich werden könnte. Aber irgendwie ist die niemals in Erscheinung getreten. Mir kommt es merkwürdig vor, dass der Prinz auch weiterhin um die Prinzessin von Disi wirbt, wenn ihr Bündnis eigentlich zerbrochen ist. Emberfall ist schwach. Er muss sich an ein Land binden, das ihm die nötige Unterstützung geben kann, um sein Reich wieder aufblühen zu lassen.
Ein Land wie Syhl Shallow.
Der Vorhang am Kutschenfenster weht im Wind, und so sehe ich in der Ferne die Überreste einer weiteren zerstörten Stadt. In meiner Kehle bildet sich ein Kloß. Mutters Soldaten waren wirklich gründlich.
Schnell konzentriere ich mich wieder auf meine Schwester. »Warum gehst du eigentlich davon aus, dass der Prinz uns überhaupt empfangen wird?«
»Laut Mutters Informationen will er das.« Die Nadel fliegt wieder über den Stoff. »Erinnerst du dich noch an die Zauberin, die vor einigen Monaten bei uns im Kristallpalast aufgetaucht ist?«
Und ob. Diese Frau hatte wundervolle Alabasterhaut, seidiges schwarzes Haar und trug ein tiefblaues Kleid. Als sie behauptete, eine Magierin zu sein, hat Mutter sie zunächst ausgelacht, doch dann sorgte die Frau dafür, dass eine der Wachen tot vor Mutters Füßen zusammenbrach, ohne dass sie den Mann auch nur anfasste. Danach hat Mutter ihr eine Audienz gewährt. Die beiden saßen stundenlang im Thronsaal zusammen.
Nolla Verin und ich drückten uns in der Nähe herum und tuschelten. Man muss kein Historiker sein, um zu wissen, dass sämtliche Magiebegabten schon vor Jahrzehnten aus den Eiswäldern von Iishellasa vertrieben wurden. Mithilfe ihrer Magie überquerten sie den Gefrorenen Fluss und wollten sich in Syhl Shallow ansiedeln, was meine Großmutter ihnen aber verbot. Daraufhin suchten sie in Emberfall Schutz, wo man ihnen zunächst Asyl gewährte, um sie später – nach irgendeinem Betrug am König – alle hinzurichten.
Bis auf diese eine Zauberin, wie es scheint.
»Natürlich«, nicke ich. »Sie war die Letzte.«
Meine Schwester schüttelt den Kopf. »So wie es aussieht, hat wohl noch einer überlebt. Das hat Mutter mir gestern Abend erzählt, als wir uns auf die Reise vorbereitet haben.«
Natürlich hat Mutter es ihr erzählt, nicht mir. Denn Nolla Verin ist ja ihre Erbin.
Ich bin nicht eifersüchtig. Meine Schwester wird eine großartige Königin sein.
Nachdem ich versucht habe, den Kloß in meinem Hals zu vertreiben, hake ich nach: »Es hat noch einer überlebt?«
»Ja, und sie war auf der Suche nach ihm.«
»Wieso?«
»Weil er mehr ist als ein Mann mit Magie im Blut.« Entschlossen sticht sie die Nadel in den Stoff. Der rote Faden gleitet durch den weißen Seidenstoff wie ein blutiges Rinnsal. »Dieser andere Magier ist der wahre Thronerbe von Emberfall.«
Fassungslos starre ich sie an. »Wirklich wahr?«
»Jawohl.« Ihre Augen funkeln. Nolla Verin liebt Klatsch und Tratsch. »Aber der Prinz hat nicht die leiseste Ahnung, wer es ist.«
Welch ein Skandal. Magie ist in Emberfall ebenso wenig willkommen wie in Syhl Shallow. Ob Rhens Volk davon weiß? Wie es wohl darauf reagieren wird?
Plötzlich stelle ich mir vor, dass mein Leben in Zukunft vermutlich immer so aussehen wird: Ich werde mir Informationen über verfeindete Königreiche erbetteln müssen wie ein Hund seine Happen beim Schlachter.
Wieder spüre ich den Kloß in meiner Kehle. »Weiß Mutter, wer der Erbe ist?«
»Nein. Die Zauberin hat vor ihrem Abgang nur verkündet, dass es einen einzigen Menschen gäbe, der seine Identität kennt.«
»Wer ist das?«
»Der Gardekommandant des Prinzen.« Sie zieht den Faden straff und beißt ihn ab. »Ein Mann namens Grey.«
Bei Einbruch der Dunkelheit sind wir viele Meilen von der letzten Ortschaft entfernt, also befiehlt meine Mutter den Wachen, anzuhalten und ein Lager aufzuschlagen. Wären wir in Syhl Shallow unterwegs, würden sie große, komfortable Zelte für uns errichten, aber hier in Emberfall müssen wir darauf bedacht sein, unauffällig zu bleiben.
Nolla Verin und ich teilen uns ein kleines Zelt. Meine Wachen Sorra und Parrish haben Decken auf dem Boden ausgebreitet und mit Kissen und weiteren Decken eine Art rundes Nest für uns geschaffen. Das letzte Mal haben wir in einem Bett geschlafen, als wir noch sehr klein waren, und ich freue mich auf die Gelegenheit, meiner Schwester mal wieder so nah zu sein.
Die hat sich bereits auf ihren Kissen ausgestreckt und kneift nun frech die Augen zusammen. »Ziemlich weich, diese Decken. Bist du sicher, dass du nicht lieber mit Parrish hier liegen möchtest?«
Brennende Hitze steigt in meine Wangen. Im Schutz der Kutsche solche Witze zu machen, ist eine Sache. Aber es ist etwas vollkommen anderes, so etwas zu sagen, wenn der Mann, um den es geht, direkt hinter einer zwar blickdichten, aber geräuschdurchlässigen Zeltwand steht. Seit sie Thronerbin ist, ist Nolla Verin noch verwegener geworden, so wie es mir einen Teil meines Selbstbewusstseins geraubt hat.
»Sei still«, zische ich.
Ihr Grinsen wird noch breiter. »Man wird ja doch noch fragen dürfen. Es würde den Abend jedenfalls interessanter machen.«
Ich schaue prüfend zu Parrishs Schatten hinüber, der sich hinter dem Stoff abzeichnet, und rücke dann näher an Nolla Verin heran. »Ich glaube, er schwärmt für Sorra.«
Ihre Augenbrauen schießen in die Höhe. »Ach ja?«
Sorgfältig ziehe ich meine Decken zurecht und schlage einen bewusst gelangweilten Ton an, weil ich nicht will, dass sie später meine Leibwache triezt: »Den Verdacht habe ich schon länger.«
Eigentlich ist es mehr als ein Verdacht. Während des Winterfestes vor einem Jahr habe ich Parrish und Sorra im Wald hinter dem Palast beim Knutschen erwischt. Zwar sind sie sofort auseinandergesprungen, aber der Glanz in ihren Augen und die feine Röte auf Sorras sonst so blassen Wangen waren eindeutig.
»Meinetwegen müsst ihr nicht aufhören«, sagte ich zu ihnen, dann eilte ich schnell zurück zu der Feier, bevor ich selbst rot anlaufen konnte.
Noch nie hat mich ein Mann so angesehen wie Parrish seine Sorra. Dieser Kuss ist mir viel länger im Gedächtnis geblieben, als ich zugeben würde.
Sorra ist stets kühl und distanziert, stoisch und brutal wie all unsere Wachen. Ihre braunen Haare flicht sie immer zu einem straffen Zopf, der unter ihrer Rüstung verschwindet. Keinerlei Schmuck ziert ihren schlanken Körper, kein Lidstrich ihre Augen, kein Rouge ihre Wangen. Trotzdem ist ihre zarte Schönheit nicht zu übersehen. Parrish ist ebenfalls schlank, er ist schmaler als die meisten Männer, dafür aber schnell und sehr geschickt. Viele halten ihn für maulfaul, aber ich weiß, dass er sich seine Worte stets gut überlegt. Wenn ich mit den beiden allein bin, kann er richtig lustig sein. Oft bringt er Sorra mit nicht mehr als einem gezielten Blick zum Schmunzeln.
Meine Schwester hat mich nicht aus den Augen gelassen. Schließlich senkt sie die Stimme, bis ich sie kaum noch verstehen kann. »Lia Mara – schwärmst du etwa für Parrish?«
»Was? Nein! Natürlich nicht.«