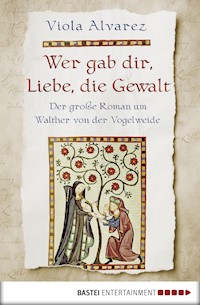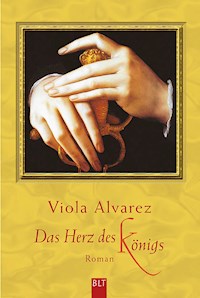4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Glanz und Schatten der Vergangenheit: Die bewegende Frauensaga »Ein Flüstern zwischen den Zeiten« von Viola Alvarez jetzt als eBook bei dotbooks. Zwei Frauen, über Jahrzehnte hinweg durch das Schicksal verbunden … Als die Literaturstudentin Marie durch einen Zufall auf einen Skandalprozess aus den 50ern stößt, ist sie sofort fasziniert von der Angeklagten: Die Presse hat sie damals sensationslüstern als schöne, aber eiskalte Mörderin vorverurteilt. Marie ist sicher, dass Mathilde S. zwar ein Geheimnis vor der Welt verbarg – doch unschuldig war am Tod ihrer Ziehtochter. Was etwa hat es mit Mathildes rätselhaftem Geschäftspartner Henk Willmes auf sich, der für sie so viel mehr als das zu sein schien? Gemeinsam mit dem jungen Archivar Vasilij stößt Marie bald auf Ungereimtheiten in dem Fall: Sollte hier vor allem ein Exempel statuiert werden an einer Frau, die mehr vom Leben wollte, als in stiller Demut am Herd zu stehen? Bald schon muss Marie sich fragen, ob auch sie einen Preis dafür zahlen wird, die Wahrheit endlich ans Licht zu bringen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Roman »Ein Flüstern zwischen den Zeiten« von Bestsellerautorin Viola Alvarez zeichnet ein fesselndes Zeitporträt der Nachkriegsjahre und ihrer Herausforderungen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwei Frauen, über Jahrzehnte hinweg durch das Schicksal verbunden … Als die Literaturstudentin Marie durch einen Zufall auf einen Skandalprozess aus den 50ern stößt, ist sie sofort fasziniert von der Angeklagten: Die Presse hat sie damals sensationslüstern als schöne, aber eiskalte Mörderin vorverurteilt. Marie ist sicher, dass Mathilde S. zwar ein Geheimnis vor der Welt verbarg – doch unschuldig war am Tod ihrer Ziehtochter. Was etwa hat es mit Mathildes rätselhaftem Geschäftspartner Henk Willmes auf sich, der für sie so viel mehr als das zu sein schien? Gemeinsam mit dem jungen Archivar Vasilij stößt Marie bald auf Ungereimtheiten in dem Fall: Sollte hier vor allem ein Exempel statuiert werden an einer Frau, die mehr vom Leben wollte, als in stiller Demut am Herd zu stehen? Bald schon muss Marie sich fragen, ob auch sie einen Preis dafür zahlen wird, die Wahrheit endlich ans Licht zu bringen …
Über die Autorin:
Viola Alvarez, geboren 1971 in Lemgo, ist eine deutsche Schriftstellerin, Dozentin und Keynote-Speakerin.
Sie ist Inhaberin eines Instituts für Managemententwicklung und Kommunikationspsychologie. Sie lebt im Rheinland.
Die Autorin im Internet: www.viola-alvarez.de
Die Autorin bei Instagram: viola_alvarez_romane
Viola Alvarez veröffentlichte bei dotbooks auch ihre Romane:
»Was uns am Ende bleibt«
»Das Flüstern des Glücks«
»Ein Tag, ein Jahr, ein Leben«
»Die Zunftmeisterin«
***
Originalausgabe April 2023
Copyright © der Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Stefan Wendel
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Masson, trabantos, Olga Korableva
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-454-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein Flüstern zwischen den Zeiten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Viola Alvarez
Ein Flüstern zwischen den Zeiten
Roman
dotbooks.
Per Orfeo.
Timmendorfer Strand, 1974
J’attendrai.
Kapitel 1Der kalte Hauch des Morgens
Den ersten Teil der Vorkommnisse konnten die ermittelnden Beamten gut bis sehr gut rekonstruieren.
Er hatte sich in einer Pension hinter dem Kurpark eingemietet, sie in dem großen, neuen Hotel an der Strandpromenade.
Von der Pension aus hatte er sie am frühen Nachmittag in ihrem Hotel angerufen.
Die Wirtin hatte, wiewohl sie mit einem sehr lauten Staubsauger den Frühstücksraum gereinigt hatte, Teile des Telefonats mitbekommen.
Der Gast sei ihr zuvor schon durch seinen außergewöhnlich guten Kleidungsstil aufgefallen. Er habe nicht nach jemandem ausgesehen, der in Wanderschuhen oder Gummistiefeln am Flutsaum entlangmarschierte, den Blick auf der Suche nach Bernstein auf den Boden geheftet, zweimal am Tag nach Scharbeutz und zurück.
Solche Gäste gebe es nämlich häufiger im November.
Dieser Gast habe sich in Sprache und Kleidung wie ein »besserer Herr« präsentiert, so waren ihre Worte, ein bisschen bewundernd, aber auch ein bisschen verwundert, warum so jemand sich kein mondäneres Quartier suchte.
Bei dem Anruf vorne an der Rezeption, wo sie ihn diskret allein gelassen habe, eben um staubzusaugen, habe er zweimal den Namen des Gastes wiederholt, den er im Hotel sprechen wollte.
Dass er so schwer zu verstehen gewesen sei, habe nun keineswegs am Namen gelegen, der denkbar einfach war, sondern, dies hatte der Wirtin dann gedämmert, an ihrem Monster von einem Staubsauger im Hintergrund. Sie habe den Trethebel bedient, um das Gerät auszuschalten, und so den Namen bei der zweiten, lauteren Wiederholung ganz deutlich verstanden.
Der Gast habe schon bei seiner Ankunft darauf bestanden, im Voraus zu bezahlen. Und als er dann gegen halb drei gegangen sei, habe sie sich nichts dabei gedacht, denn er habe die Pension ohne Gepäck verlassen, alle Meldeunterlagen seien ordnungsgemäß ausgefüllt gewesen.
Auch sei er zu alt für einen Terroristen und zu situiert für einen Verbrecher gewesen, ergänzte sie in der Befragung mit einigem Sarkasmus, den man ihr so gar nicht zugetraut hätte.
Als er also gegangen sei, habe sie – wenn sie denn überhaupt einen bewussten Gedanken daran verschwendet habe – gedacht, dass er nun unterwegs sei zu seiner Verabredung mit der Dame, deretwegen er im Hotel angerufen hatte.
Allerdings wusste sie noch, dass sie ihm nachgesehen hatte, eben weil sie ihn so elegant fand mit seinem Hut, dem Schal und dem schwingenden Mantel. Und sie habe sich gedacht, dass er eher wie jemand wirkte, der ein wenig aus der Zeit gefallen sei. In ihrer Kindheit habe sie solche Herren manchmal gesehen, in Lübeck, »bessere Herren« eben. Ihre Eleganz habe immer auch einen Hauch Melancholie, was vielleicht am Alter dieser besseren Herren liegen mochte. Und vielleicht sei er auch einen Hauch zu leicht gekleidet gewesen angesichts des Wetters. Er habe einen Seidenschal getragen, der den heftigen Wind nicht abhalten können würde. Keine fünf Minuten.
Aber dann wiederum sei das ja nun wirklich nicht ihre Sache gewesen.
Die Geschichte des jungen Mitarbeiters an der Hotelrezeption vom großen Haus an der Strandpromenade passte haargenau dazu.
Sie sei am späteren Vormittag von der Bahn abgeholt worden, dies telefonisch bestellt und einmal noch am Vorabend bestätigt. Zwar habe sie nicht wie jemand gewirkt, der viel verreiste, aber sie habe ein freundlich bestimmendes und sehr versiertes Auftreten gehabt, was Absprachen anging.
»Eine Dame«, nannte sie der Concierge, der Portugiese war, auch er sagte dies mit einer gewissen Bewunderung.
Keinesfalls sei die Dame tüdderig oder altersverwirrt gewesen, wie die Beamten abzufragen versuchten. Im Gegenteil, den Meldeschein habe sie in einer gestochen scharfen Schrift äußerst zügig ausgefüllt.
»Null Komma nix«, sagte der Portugiese assimiliert.
Am frühen Nachmittag also habe er einen Anruf auf ihr Zimmer durchgestellt, der von einem Herrn gekommen sei.
Der Herr sei erst schwer zu verstehen gewesen wegen der Hintergrundgeräusche, ein lautes Rauschen in der Leitung.
Das Telefonat habe wohl nicht lange gedauert, und dann sei die Dame auch schon bald aus dem Fahrstuhl gekommen, sehr elegant gekleidet, ein Kopftuch umgebunden, wegen des Windes vermutlich.
Sie habe einen Moment in der Halle gewartet, schließlich wohl ihre Verabredung entdeckt und sei schnellen Schrittes die Auffahrt hinuntergegangen.
Auch ihr hatte der junge Portugiese nachgesehen und sich den eher schwärmerischen Gedanken erlaubt, dass den jungen Frauen von heute solche Grandezza und Beherrschtheit nie gelingen würden.
Und dann habe er zu tun gehabt.
Bis hierher fand Kommissar Parlow, den man aus Lübeck hinzutelefoniert hatte, alles sehr einfach.
Er ging die Strandpromenade ab, die die beiden genommen haben mussten, fühlte den Wind auf seiner Haut und dachte nach.
Zwei sehr gepflegte ältere Leute, die sich außerhalb der Saison in Timmendorfer Strand verabredet hatten.
Timmendorfer Strand außerhalb der Saison war für Rentner erschwinglich.
Verwandte? Ein altes Liebespaar? Alte Freunde?
Beide hatten sich keine Mühe gegeben, ihre Identität zu verschleiern. Die Unterlagen waren korrekt ausgefüllt.
Jedenfalls auf den ersten Blick nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass man sie am nächsten Morgen tot zusammen am Strand finden würde, nebeneinanderliegend; die Hände mit ihrem Kopftuch zusammengeflochten.
Und hier wurde die Geschichte schwierig.
Seit dem Zeitpunkt, zu dem sie das Hotel verlassen hatte, offenbar um sich mit ihm zu treffen, verloren sich die Spuren.
Nur zwei jugendliche Tunichtgute, die in einem zuvor aufgebrochenen Strandkorb, den man noch nicht für den Winter weggeräumt hatte, Unterschlupf gesucht hatten, hatten die beiden noch gesehen.
»Wir waren echt dicht, Mann«, teilte der eine Tunichtgut Kommissar Parlow erhellend mit.
»Zugedröhnt«, verdeutlichte der zweite.
Beide waren verfroren und wischten sich hin und wieder die Nasen.
Die Tunichtgute hatten kleinere Vorstrafen und Anzeigen wegen Beschaffungskriminalität. Es gab keinen Anlass zu denken, sie könnten mit dem Tod der beiden Menschen da am Strand etwas zu tun haben, zumal die Leichen auf den ersten Blick keinerlei Gewalteinwirkung aufwiesen.
Erfroren waren sie auch nicht, dafür war es bei aller Ungemütlichkeit nicht kalt genug.
Man versorgte die Tunichtgute, die als Zeugen nun einen anderen Status hatten, als sie sonst von ihren Begegnungen mit der Polizei gewöhnt waren, mit Kaffee aus einer Thermoskanne und mit Zigaretten.
Kommissar Parlow stellte sich so, dass er mit dem Wind stand, sonst waren die beiden wegen ihres Geruchs schwer zu ertragen.
Der größere − lange, fettige Haare und eine Lederjacke mit Aufnähern − konnte sich daran erinnern, dass die beiden nach Einbruch der Dunkelheit vorne an der Wasserkante gestanden hatten, er traue jedoch dieser Erinnerung nur bedingt.
»Das war wie in ’nem Film, kann also auch von den Joints sein. Total satt.«
Das Licht der neuen Laternen an der Strandpromenade, der Wind, der leichte Nieselregen oder Nebel. (»So wehende Nebelschleier, grau in grau«, steuerte Tunichtgut zwei überraschend poetisch bei.) Dieser Hintergrund jedenfalls habe den beiden Gestalten etwas unglaublich Besonderes, aber auch Unwirkliches verliehen.
»Wie Casablanca«, befand der zweite Tunichtgut und schlürfte eilig den in der Brise rasch erkaltenden Kaffee.
Der zweite Tunichtgut trug einen Parka, eine Cordhose, die das Kunststück fertigbrachte, selbst an seinen kurzen, krummen Beinen noch zu kurz auszusehen, und hatte sich eine Art Mongolenbart stehen lassen.
»Quatsch«, ernüchterte ihn der erste, »Casablanca ist am Flughafen. Die waren ja auch zu alt für Casablanca.«
Kommissar Parlow mahnte sich zur Geduld ebenso wie zur Ernsthaftigkeit, immerhin sah er sich mit zwei Leichen konfrontiert.
Ein örtlicher Reporter machte einen langen Hals. Zwei Leichen in Timmendorfer Strand, am Strand, wann gab es das schon mal.
»Also, die beiden Herrschaften standen miteinander am Meer. Und dann?«
Hier mussten die Tunichtgute passen.
Aufgrund der schon erwähnten Zugedröhntheit seien sie entweder in ihrer Aufmerksamkeit mal weggedriftet, vielleicht sogar eingenickt – »weggepennt« –, so dass ihnen die zeitlichen Dimensionen abhandengekommen seien.
Die beiden Menschen da am Strand hätten sich sowohl mal umarmt, trotz des hohen Alters womöglich sogar geküsst, als auch an den Händen gehalten. Die Nähe habe etwas befremdlich Inniges gehabt; zwei alte Leute, die sich wie ein Liebespaar aufführten.
Dann aber wieder seien ja nur die Silhouetten erkennbar gewesen, wie in einem Schwarzweißfilm.
»Ebent. Casablanca«, bekräftigte der zweite Tunichtgut, der für einen müffelnden Gammler neben der unerwarteten Poesie auch eine erstaunliche Beharrlichkeit und Rechthaberei an den Tag legte.
Auf das nächste Zeugnis des ersten Tunichtgutes konnte man deswegen nicht viel geben, fand Parlow. Es schien aus einem gewissen Wettbewerb zu erwachsen, jetzt, da Casablanca so gerechtfertigt im Raume stand.
Der Mann, so berichtete Tunichtgut eins, habe zu einem gewissen Zeitpunkt der Frau die Hand an die Wange gelegt, oder unter das Kinn, und habe lange mit ihr gesprochen. Und sie habe ihm den Kopf zugeneigt, »wie eine Blume«.
Hier musste Parlow husten.
Tunichtgut eins blinzelte, blieb aber dabei. Stirn an Stirn hätten die beiden dagestanden, als würden sie ihre Gedanken ineinanderfließen lassen.
»Als ob sie die beiden einzigen Menschen auf der Welt wären. Echt stark«, erläuterte er.
Parlow entschied irgendwann, dass er genug von ältlichen Filmliebespaaren und den beiden poetischen Kiffern hatte, und ließ den örtlichen Kollegen die Personalien aufnehmen.
Er setzte sich durchfroren ins Auto, zündete den Motor, damit die Scheibenwischer und die Heizung liefen, und sah auf seine Notizen.
Zwei Tote, beide über siebzig.
Eine Zeitspanne von drei oder vier Stunden, in denen beide von niemandem gesehen worden waren, um dann am Strand in der Dämmerung wie ein Filmliebespaar aufzutauchen, halb bestaunt, halb halluziniert von den beiden Tunichtguten, nur um dann am nächsten Morgen dazuliegen, als wären sie zu einer Trauerfeier aufgebahrt.
»Erbschaft?«, schrieb Parlow auf seinen Block.
Das könnte ein Motiv sein. Es ging ja meistens bei Selbstmorden um Liebeskummer oder um Geld. Und bei alten Menschen ging es selten um Schulden. Vielleicht wollten sie einem Verwandten durch ihren Freitod aus der Klemme helfen?
»Gift?«, schrieb er daneben, wie sonst verstarben zwei Menschen so unversehrt zeitgleich?
Zurück in Lübeck ließ er die Namen der beiden durch die Suchläufe gehen, weil er wissen wollte, ob jemand sie als vermisst gemeldet hatte, zumindest einen von beiden.
Der Name der Frau brachte einen Treffer.
Es handelte sich zu seiner wirklichen Überraschung um eine Dame mit einer Vorverurteilung.
Lebenslänglich. Wegen Mordes.
Köln, 2019
Youth is wasted on the young.
Kapitel 2Morgenstund
Das Erste, das Marie jeden Morgen tat, wenn sie aufwachte, war, ein unbestimmtes Fischen mit der linken Hand aus dem Bett heraus am Boden zu vollführen.
Das Fischen galt ihrem Telefon, das sie gleichzeitig als Wecker, Zeitung, Spiegel, Musikanlage, Fotoapparat, Diktiergerät und natürlich als Telefon nutzte.
Sie verband mit dieser automatisierten Handbewegung ein ebensolches automatisiertes schlechtes Gewissen – aus zwei Gründen:
Zum einen trichterte ihr ihre Mutter bei jeder Begegnung ein, dass ein Telefon neben dem Bett schreckliche elektromagnetische Strahlungen um sich herum wabern ließ, die sich auf die körperliche wie geistige Gesundheit negativ auswirken würden. Dieser Grund war von beiden aber der eher zu vernachlässigende, da Maries Mutter keinesfalls über irgendeine Expertise im Bereich elektromagnetischer Strahlungen verfügte, sondern ihr Wissen aus Illustrierten – gedruckten Illustrierten! – bezog.
Der zweite und für Marie wichtigere Grund war, dass es zu Zeiten, die Marie als deutlich lebenswerter erachtete als die Gegenwart, so einen Morgen mit dieser ritualisierten Handbewegung nicht gegeben hätte.
In Maries Welt, die wie ihre Freundin Maila bemeckerte, eine »illusionär-idealisierte Retro-Welt« war, wäre ein idealer Morgen eher so ausgefallen:
Unter ihren mit Satin bezogenen Daunendecken, bekleidet mit einem Babydoll, wäre Marie (natürlich perfekt geschminkt) mit nur leicht verwuschelter Dauerwelle aufgewacht und hätte sich liebreizend gereckt, wobei sie ein süßes kleines Geräusch gemacht hätte.
Dann hätte sie mit ebenso süßem kleinen Gähnen beide perfekt geformten Beine zugleich aus dem Bett gewirbelt und die kleinen Füße in zauberhafte Pantöffelchen in der Farbe des Babydolls schlüpfen lassen.
Mit weiterem, katzenhaften Recken, einem Rekeln eher, das eine natürliche Kindlichkeit ebenso wie eine gewisse unerweckte Sinnlichkeit hätte interpretieren lassen, wäre sie aufgestanden und hätte in der Küche das Kaffeewasser aufgesetzt, bevor sie das Radio andrehen und einen Morgenmantel anziehen würde.
»Keiner hat was gegen die fünfziger Jahre, aber du lebst in einem schlechten Film über die fünfziger Jahre. In deinem Kopf«, motzte Maila.
Maila war in Maries Leben vielleicht das Gegenwärtigste, was sich finden ließ, hatten doch ansonsten diverse Geburtstage und Weihnachtsfeste dazu beigetragen, dass ihr alles, was sich für solche Anlässe eignete, an »Retro« geschenkt worden war.
Maries Bettwäsche war »retro«, vieles an ihrer Garderobe, ihr Geschirr, einige Teile der Küchenausstattung, die Tapete in ihrem Zimmer und diverser Schnickschnack, »Stehrumchen«, wie ihre Mutter etwas betulich sagte.
Genauso gab es einiges in ihrem Leben, das »vintage« – also echt alt statt nur designt alt, eben »retro« – war: ihre Tasche für die Uni – echtes Leder aus den Sechzigern –, ihre Schreibtischunterlage; ein paar Leitzordner, die sich aber zunehmend leer langweilen mussten, weil kein Mensch mehr etwas ausdruckte, und ein paar Bücher, die immer leicht muffig rochen, sowie ein paar fast zerfallene Zeitschriften vom Flohmarkt ohne Sammlerwert.
Nur ein Telefon aus Bakelit – das gab es nicht.
Überhaupt einen Festnetzanschluss gab es natürlich nicht. Sondern es gab eben dieses Telefon, das sie trotz aller Bemühungen um nostalgisch anmutende Individualität zu einem Klischee ihrer Generation machte.
Und jeden Morgen fühlte sie sich schlecht, dass es ihr nicht gelang, die Rolle des sehr gegenwärtigen digitalen Telefons in ihrem gewünscht analogen Leben weniger prominent zu gestalten.
Um zumindest eine Teilrolle des Telefons faktisch zu entkräften, hatte sie sich zum letzten Weihnachten von ihren Eltern sogar einen Retro-Wecker gewünscht, der von der Atomuhr gesteuert wurde, dessen Geticke man nicht hörte, der aber eine Klingel hatte, das ein ganzes Gefängnis wecken könnte.
Der Retro-Wecker stand auch auf ihrem Nachttisch, der weder retro noch vintage war, sondern ein Gesellenstück ihres Ex-Freundes, inzwischen Möbeldesigner in der Schweiz.
Nur stellte sie abends nicht den Wecker, sondern las im Bett ihre Nachrichten und allen möglichen Kram, bevor sie dann mit zweimal Tippen dort einen Wecker aktivierte und einschlief bis zum erwähnten, neuerlich vollführten morgendlichen Fischen.
Das heutige Fischen und Gucken war mit einer gewissen Anspannung verbunden, da sie bis zum nächsten Tag das Thema ihrer Bachelorarbeit benennen und schriftlich einreichen musste und gestern Abend gegen 22:30 Uhr endlich einen Vorschlag an ihren Prof geschickt hatte, auf dessen prompte Antwort sie gähnend eine Weile vergeblich gewartet hatte, bis sie dann eingeschlafen war.
Also stand sie auf, ohne schicke Pantoffeln, ohne Dauerwelle und ohne choreographiertes Rekeln, durchsuchte das Telefon weiterhin erfolglos nach einer über Nacht eingetroffenen Antwort des Profs und fand es ziemlich blöd, dass er sie seit gestern Abend einfach so schmoren ließ.
Dass Marie selbst bis zwei Tage vor Ende der Abgabefrist gewartet hatte, obwohl sie vier Wochen Zeit gehabt hatte − hätte −, verdrängte sie mit viel Übung, die sie sich durch das jahrelange Verdrängen solcher Erkenntnisse angeeignet hatte.
Sie hämmerte ans Holz der Badezimmertür, da das Badezimmer von ihrer Mitbewohnerin erwartungsgemäß noch besetzt war, schlurfte in die Küche und fand dort den Abwasch so unberührt wie am Vorabend vor, obwohl es Johannas Abend gewesen war und die eher kindgerecht gestaltete Spüluhr auch deutlich auf Johanna zeigte.
Marie nahm sich Milch aus dem Kühlschrank und Müsli aus dem Regal, pantschte beides schlecht gelaunt in eine kurz unter fließendem Wasser ausgespülte Schale und starrte das Telefon an, das aber nach wie vor keine Hinweise auf einen geänderten Kommunikationsstatus des Profs gab.
Johanna verließ wie üblich mit dem mürrischen melodischen Ruf »Kannst« das Badezimmer, und Marie widmete sich der Morgentoilette, deren größte Herausforderung es war, das Haar unter einem knallroten Rosie-the-Riveter-Tuch zu verbergen und einen gleichmäßig geschwungenen Lidstrich zu ziehen, was beides halbwegs gelang.
Dann ging sie in Jeans und T-Shirt in die Küche zurück, um das nunmehr matschig aufgequollene Müsli in sich reinzuschaufeln.
Das Müsli beinhaltete Schokolade und war kein bisschen gesund.
Überhaupt aß Marie zu viel Süßes, was sich bisher zwar figürlich noch nicht rächte, es aber bald tun würde, wie ihr Maila, bei der es sich offenbar immer schon gerächt hatte, gerne finster prophezeite.
Ihre Mutter hatte dazu auch etwas gelesen, mal nicht in einer Illustrierten, sondern in einem Ratgeberbuch – Print − über das Loslassen von Kindern.
Maries Mutter sicherte durch den Ankauf von Printerzeugnissen das Überleben der deutschen Verlagsindustrie für unwichtige Bücher ziemlich gut ab.
Das Ratgeberbuch jedenfalls behauptete − besser: Maries Mutter behauptete, dass es dies behauptete −, junge Menschen, die zwar das elterliche Nest verlassen hatten, aber dennoch eine gewisse Unreife in sich trügen, ernährten sich »regressiv«: durch allzu viele Süßspeisen, durch zu leicht zuzubereitende Mahlzeiten (Müsli, Pudding aus der Tüte, Pfannkuchen aus Pulver, Instant-Milchreis, Nudeln im Becher, aufgießbar mit heißem Wasser). All dies seien Hinweise, dass das ausgezogene Kind zwar verzweifelt versuche, seine scheinbare Selbstständigkeit zu behaupten, in Wirklichkeit jedoch seine Sehnsucht nach warmer Muttermilch und tröstender Breikost auslebe.
Damit einhergehend diagnostizierte das Buch eine vermeintliche Unfähigkeit, eigene, gegebenenfalls konfliktträchtige Entscheidungen (gerade gegen die Mutter) zu treffen, mangelnden sexuellen Selbstausdruck (was letzten Endes »Orgasmusprobleme« hieß, wie ihre Mutter hilfreich erläuterte) und eine Neigung, Dinge nicht allein zu Ende bringen zu können.
Marie hasste das Buch, das sie nie gesehen, geschweige denn gelesen hatte, so sehr, wie ihre Mutter es offenbar liebte.
Jedes Mal, wenn sie sich also wieder ein Müsli oder einen Instant-Milchreis angerührt hatte, schämte sie sich. Gleichzeitig war sie ärgerlich und fragte sich bang, ob das Buch vielleicht doch etwas über sie wusste, was stimmen konnte.
Allerdings hätte sie es auch zur Überprüfung dieser Unsicherheit niemals gelesen.
Sie hatte mit Maila zusammen die Vermutung diskutiert, dass – gesetzt den Fall, Marie wäre nicht ausgezogen, sondern zu Hause wohnen geblieben – Maries Mutter ein Buch gefunden hätte – Hotel Mama – der Nesthocker und seine Neurosen –, das auf andere, eben gegensätzlich gelagerte Eigenschaften Maries ebenfalls pathologisierend eingegangen wäre.
(Maila studierte Psychologie. Marie studierte Germanistik und Geschichte. Beide kannten sich seit der fünften Klasse.)
Manchmal, wenn sie ein bisschen angeschickert waren, dachten sich Maila und Marie Buchtitel aus, die Maries Mutter gerne kaufen oder eben nie kaufen würde.
Darin war Marie sehr kreativ. Was ihre Arbeit anging, offenbar nicht.
Und wenn der Prof nun aus irgendeinem Grund, den man nicht wirklich ausschließen konnte, Maries Vorschlag nicht annehmen würde, dann stünde sie einen Tag vor Ende der Abgabefrist ohne Thema da und müsste ein »verordnetes Thema« akzeptieren, von denen sie schon gehört hatte und die strafhaft langweilig sein sollten.
Jetzt endlich allerdings unterbrach ein gnädiges Zirpen – Hinweis auf eine eingegangene Nachricht – diese geißelnden Gedanken.
Der Prof hatte um exakt 08:52 Uhr, also fast zwölf Stunden, nachdem Marie ihm geschrieben hatte, die Gnade gefunden zu antworten.
Krass, dachte Marie ebenso beleidigt wie erleichtert und wischte einen Milchtropfen vom Kinn.
Mit beiden Backen voll schwammigem Müsli musste sie dann jedoch zur Kenntnis nehmen, dass der Prof ihr eine klare Antwort nur im persönlichen Gespräch und nur in seiner Sprechstunde, die heute von 09:00 bis 10:30 Uhr stattfände, zu übermitteln gedächte.
»Ey«, entwich es ihr laut.
Johanna − ausgehfertig angekleidet, was bedeutete, sie sah aus, als spielte sie in einer amerikanischen Anwaltsserie mit − hatte den Ausruf gehört und fragte: »Was?«, mit einem aggressiven Unterton, da die Diskussion um den Abwasch ja noch ausstand und man nie wissen konnte.
Johanna studierte Jura im zweiten Semester.
In Haushaltsführung war sie noch schlechter als Marie, bei der man das Wort eigentlich auch nicht in einem Atemzug nennen sollte.
»Der Typ, ja? Ich schreib dem gestern wegen dem Thema für meine Bachelorarbeit, das morgen, also heute, stehen muss, dann antwortet der erst jetzt, und dann soll ich doch bitte in seine Sprechstunde kommen.«
»Aha«, sagte Johanna ausdruckslos, »seit wann bestand denn die Frist?«
Marie vergaß lieber das Antworten. »Du bist mit Abwaschen dran«, sagte sie stattdessen und zeigte unbestimmt in Richtung von Spüle und bunter Abwaschuhr. So heiter und motivierend die mit ihren Bildchen und Emojis auch wirken sollte, war sie doch zu einem aggressiv aufgeladenen Politikum geworden.
Johanna sagte nur: »Tschüss«, drehte sich um und ging.
Marie reagierte nicht. Sie sah auf die Handy-Uhr. Wenn sie in diese Sprechstunde musste, dann war keine Zeit zu verlieren.
Sie stand auf, öffnete das Dokument auf ihrem Laptop, in dem sie den Vorschlag in Windeseile zusammengeschrieben hatte, und bekam ein schlechtes Gefühl in der Magengegend, dass der Prof damit nicht zufrieden sein könnte.
Sie wackelte in ihren Gedanken hin und her wie ein Vogel, der sein Nest gleichzeitig verteidigen und einen Angreifer abwehren will, blieb dann letzten Endes tatenlos, packte alles in ihren Rucksack und rannte die Treppe hinunter, um die nächste Bahn zu erwischen.
Um 10:05 Uhr erreichte sie das Sprechzimmer, vor dem noch vier andere Studenten und Studentinnen in unterschiedlichen Stadien der Wachheit und Sauberkeit hockten. Einen von den vier Halbwachen kannte sie, Jonas.
»Hi«, sagte sie außer Atem.
Er nickte ihr zu.
»Seit wann wartet ihr?«, fragte sie.
Jonas schaute auf sein Telefon, so wie die drei anderen auch auf ihr Telefon schauten.
»Halbe Stunde.«
»Echt?« Marie wurde es mulmig. »Bist du der Nächste?«
»Nee«, sagte er, aber ohne nachzureichen, wer das denn wäre.
»Überzieht er?«, fragte Marie.
»Meistens nicht«, antwortete eine der beiden anderen Studentinnen, die hellwach und gekämmt aussah und von der man sofort wusste, dass sie Lehrerin werden würde, wahrscheinlich an ihrer alten Schule, wenn die das irgendwie hinkriegte.
Marie machte eine Bewegung mit dem Kinn, die ein Nicken oder eine Konfrontation hätte sein können und insgesamt zu unhöflich für den Anlass war.
Die Tür ging auf, entließ einen ziemlich verstört aussehenden Kiffer, gab einen Blick frei auf Professor Kland. Ausdruckslos musterte er die Gruppe und rief einen anderen Studenten herein, der aufsprang, als gäbe es einen Gehorsamspreis zu gewinnen.
»Verbindungsstudent«, zischte Jonas verächtlich durch die Zähne.
»Echt?«, flüsterte Marie, als wäre sie von der Schärfe der Diagnose beeindruckt.
»Klar«, behauptete Jonas.
Die gekämmte Lehramtsstudentin verdrehte überlegen die Augen und machte ein zischendes Geräusch ob der Intoleranz der anderen.
Mit Maila hätte sie sich darüber totgelacht. Jetzt, alleine, war sie zu nervös.
Marie klappte ihren Laptop auf und starrte auf ihren Vorschlag. Sie entdeckte ungefähr acht Tippfehler, von denen fünf wirkliche Rechtschreibfehler waren – und was die Zeichensetzung anging, hatte sie das ungute Gefühl, dass es ein paar mehr Kommata hätten sein dürfen. Eigentlich fand sie, dass eine Germanistikstudentin Zeichensetzung beherrschen sollte. Aber sie fand auch, dass man sich in der heutigen Zeit mit anderen Dingen zu beschäftigen habe, ohne dass sie nennen könnte, welche dies in ihrer gesteigerten Wichtigkeit wären.
So schob sie, um sich abzulenken, ein paar Absätze herum, klickte und tippte, bis Jonas sich neben so viel Arbeitseifer offenbar unwohl fühlte.
»Master?«, fragte er halbwegs beeindruckt.
»Bachelor«, antwortete Marie leicht gekränkt, weil sie der Meinung war, dass man für einen Master älter und vor allem abgelernter aussah.
»Und dafür den Stress?«, wunderte sich Jonas, der in diesem Moment im Austausch für den vermeintlichen Verbindungsstudenten reingerufen wurde.
Der mutmaßliche Verbindungsstudent sah ziemlich zufrieden mit sich und der Welt aus, musterte die Lehramtsverdächtige und Marie, entschied sich dann, dass die Lehramtstante seiner Aufmerksamkeit doch würdiger wäre, und sagte zu dieser: »Hi.«
Die Gekämmte machte auf Blümchen-rühr-mich-nicht-an und nickte huldvoll.
Aber der Corpsstudent hatte sich in seinen werberischen Anstrengungen schon verausgabt. Ohne weitere Versuche einer zielgerichteteren Anmache marschierte er zackig von dannen.
Um 10:35 Uhr waren alle anderen durch, und Kland starrte in der Tür demonstrativ auf seine Uhr, seufzte und sagte: »Na ja, dann kommen Sie eben noch.«
Kland war Ende vierzig, hatte eine fliehende Stirn und Kerben in den Wangen wie Hermann Hesse.
Mit Maila hatte Marie darüber abgelästert, dass er immer so angezogen war, als gäbe es irgendwo einen Akademiker-Klischee-Bedarfsladen, in dem Sakkos mit Lederellbogen und Pullunder mit V-Ausschnitt verkauft würden.
Jetzt war ihr nicht so sehr nach Lästern.
Sie setzte sich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, bis sie merkte, dass er seine Besprechungen an einem Besprechungstisch abhielt, wo man eher nebeneinandersaß als gegenüber. Vermutlich war das paritätischer.
»Frau Gartzow«, sagte Kland über seine Nickelbrille hinweg – aus ebendemselben Laden vermutlich. Er schien etwas anfügen zu wollen, schwieg dann aber, tippte und scrollte auf seinem iPad herum, bis er Maries Vorschlag gefunden hatte.
»Da«, Marie musste sich räuspern, »da sind noch ein paar Rechtschreibfehler drin, Tippfehler, tut mir leid. Ich kann Ihnen ja eben die neue Version schicken? AirDrop?«
Kland ignorierte das Angebot, ignorierte, dass sie überhaupt gesprochen hatte.
»So«, sagte er schließlich und las dann ab: »HETZEBLEIBT HETZE – Ein stilistischer Vergleich des Boulevardjournalismus der fünfziger und sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts mit den antisemitischen Leitartikeln des Stürmers.«
Dann machte er eine Pause, atmete durch und sagte: »Erklären Sie das doch mal.«
Marie schluckte. »Also, ich wollte eigentlich was über die Berichterstattung der Nürnberger Prozesse machen. Dazu hatte ich auch schon mal eine Arbeit geschrieben …«
Sie ließ ihre Stimme hoffnungsvoll in der Luft hängen. Die Arbeit war ganz gut gewesen.
Kland reagierte nicht.
»Weil ich ja auch Geschichte studiere. Also, mir ist jedenfalls einge-, aufgefallen, dass die Berichte über die Nürnberger Prozesse insgesamt sehr faktenorientiert sind. Also, dass versucht wird, das Grauen sachlich zu beschreiben. Irgendwie.«
Kland runzelte die Stirn. Da er still blieb, fuhr Marie fort.
»Also, die Artikel im Stürmer, darüber hatte ich auch schon mal eine Arbeit im ersten Semester geschrieben, die sind voller Beschuldigungen, Unwahrheiten, Thesen, Polemik – gegen Menschen, die ja nichts gemacht hatten. Und dann die Artikel von ’47, die sind eben so total übersachlich, obwohl es da ja um echt krasse Kriegs- und Menschheitsverbrechen ohne Ende geht. So, dass man denken könnte, das wäre aus der deutschen Medienwelt gereinigt worden. Hetze. Und dann habe ich einen Gerichtsreport aus einer alten Illustrierten gelesen, durch Zufall, zu Hause. Das klang genau wie die Artikel im Stürmer. Vor allem zwei Zeitungen sind mir aufgefallen, die Rapid und die Illustrierte Information, und dass da oft auch dieselben Leute Artikel geschrieben haben. So Stammjournalisten. Und immer derselbe Stil, private Details ausbreiten und dadurch entweder Glaubwürdigkeit suggerieren oder … sexuelle Verworfenheit und deswegen mangelnde Glaubwürdigkeit bzw. Schuldwahrscheinlichkeit. Und je nachdem, wie sich die Autoren entschieden hatten, wurde dann die Öffentlichkeit dadurch ja massiv beeinflusst. Jedenfalls versucht zu beeinflussen. Hetze.«
Sie machte eine kurze Pause und schluckte.
Kland schwieg noch immer.
»Und dann bin ich auf das Zusammenspiel von Bild und Text gestoßen. Dass manchmal Bilder gezeigt werden, die irgendwie wie die Karikaturen im Stürmer sind. Oder zumindest total tendenziöse Untertitel haben. Und so bin ich auf den Vergleich gekommen. Hetze bleibt Hetze.«
Ihr Hals war trocken.
Kland schob noch einmal das Dokument hoch und runter und bequemte sich schließlich, etwas zu sagen: »Es ist schade, dass Ihr Umgang mit Formalia nicht reflektiert, wie intelligent Sie sind, Frau Gartzow. Wissen Sie, Regeln können einem erst dann egal sein, wenn man sie beherrscht. Ansonsten wirkt es nur dumm, schlampig und nachlässig, wenn man sie nicht beachtet.«
Kapitel 3Emsig, emsig
Marie war stinksauer, als sie schließlich wieder unten im Foyer angekommen war. Sie schrieb sofort eine Nachricht an Maila, voller »anal-aggressiver« Emojis, wie Maila selbst sagen würde: Kackhaufen, Totenköpfe und Blitze.
Maila schien aber in einer Vorlesung oder einem Seminar zu sein, das ihr Interesse insofern fesseln musste, als dass sie offenbar in Flugmodus geschaltet hatte.
Marie widerstand nur mühsam der Versuchung, als zweitbeste Wahl ihre Mutter anzurufen, um sich über Kland aufzuregen, weil ihre Mutter sich auf der einen Seite höchst erfreut gezeigt hätte, mal wieder die Abhängigkeit ihrer Tochter wahrzunehmen, und weil ihre Mutter auf der anderen Seite Kland in seiner blöden Gehässigkeit ohnehin nur zugestimmt hätte.
Seit Ruben und sie sich getrennt hatten, hielten sie zwar noch »freundschaftlichen« Kontakt − das machte man eben so −, aber sie hatte keine Lust, Extragebühren für einen Anruf in der Schweiz zu zahlen. Und sie hatte eigentlich auch keine Lust, Ruben die ganze Sache zu erklären, denn einer ihrer Trennungsgründe bestand darin, dass Ruben sich nach Maries Meinung zu wenig für sie interessierte. Ruben hatte daraufhin gesagt, dass Marie endlich mal erwachsen werden solle, dass sich nicht alles immer um sie drehen könne und dass sie aus jeder Mücke einen Elefanten mache. Sie wusste inzwischen nicht mehr, wer recht hatte.
Kland, ihre Mutter und Ruben schienen in diesem Moment quasi in einer Reihe zu stehen, was die Missachtung ihrer Person oder zumindest ihrer Bedürfnisse anbelangte.
Maila war immer noch auf Flugmodus, und Marie musste sich eingestehen, dass sie niemand anderen anrufen wollte. Das hätte nur ihr Image als kesse, taffe Studentin irgendwie angefasst, sich über einen nicht einmal ungerechtfertigten Hinweis auf Beachtung der Formalia derart aufzuregen.
Maila, die gerne an Marie herumanalysierte – nicht bösartig, mehr wie mit einem lebenden Psychologiebaukasten –, hatte gemeint: »Du musst dir überlegen, warum du so auf die Fünfziger fixiert bist, gerade äußerlich. Weil du über das Äußerliche etwas Inneres substituieren willst.«
Maila war sehr direktiv in ihren Ansprachen, und Marie hatte ihr entgegnet, dass deren erste Patienten sich bei so einem Umgangston wahrscheinlich nur wimmernd abwenden würden, um entweder einem Beschwerdeverfahren oder ihrem Suizid entgegenzueilen.
»Point taken, ich arbeite dran«, hatte Maila geantwortet. »Trotzdem. Denk mal drüber nach.«
Marie hatte überlegt: »Weil die in den Filmen alle so gesammelt sind. So stark.«
Und Maila hatte zufrieden genickt: »Dafür, Liebelein, braucht aber keiner eine Haartolle oder Dauerwelle. Gesammelt und stark kann man auch in der Gegenwart sein. Egal in welchen Klamotten.«
Daran erinnerte sich Marie jetzt.
Sie fragte sich, wie beispielsweise Ruth Leuwerik – Auf Wiedersehen, Franziska!, Remake 1957, war einer von Maries Lieblingsfilmen – wohl mit so einer Nachricht wie der blöden Bemerkung von Kland umgegangen wäre.
Obwohl Ruth Leuwerik nie − wirklich nie! − wegen mangelnder Formalia aufgefallen wäre. Ruth Leuweriks Charaktere, egal in welcher Rolle, wären vorbereitet gewesen, hätten nicht bis zum vorletzten Tag gewartet, um ein Thema für eine Abschlussarbeit einzureichen. Und wenn einer ihr gegenüber so eine Bemerkung gemacht hätte – als Schurke: Paul Dahlke? –, dann hätte sie ihm, rauchig hauchend, ein bisschen kurzatmig vielleicht, etwas entgegnet wie: »Schade, dass Sie auf Ihrer elevierten Position weder den passenden Geschmack noch das notwendige Benehmen haben.« Und die Großaufnahme wäre dann etwa auf Dahlkes wutzitterndem Schnurrbart gewesen, kurz bevor er hilflos wütend und besiegt »Hinaus!« geschrien hätte. Eindeutig wäre er mit all seinem Status und hinter seinem großen Schreibtisch der Verlierer gewesen.
Marie war bei Kland nur rot geworden, hatte keine Antwort parat gehabt und stattdessen eine Liste von noch zu klärenden Gliederungspunkten in der Hand gehalten, die sie ihm doch bitte »bis morgen um acht – vormittags, Frau Gartzow« beantwortet einreichen sollte.
»Ja, danke, mache ich«, hatte sie nur gesagt.
Aber wenigstens jetzt könnte sie etwas vergleichbar Leuweriksches an den Tag legen. Da Maila immer noch im Flugmodus weilte, hatte sie sowieso nichts Besseres zu tun. Würde Ruth Leuwerik jetzt einen Kaffee trinken gehen? Oder gleich in die UB, um Klands Auftrag zu erfüllen?
Die Frage verdiente es nicht, eine Frage zu sein. Marie hob das Kinn und begab sich königlichen Schrittes zur Bibliothek.
Als sie endlich einen freien Tisch gefunden hatte, nahm sie sich Klands Liste vor.
Sie sollte möglichst zwei der Boulevardjournalisten auswählen, deren Berichterstattung zum selben Fall sich bestenfalls über mehrere Wochen erstreckt habe. Nur so könnte man in der Analyse den Anspruch erheben, dass ein System des Rufmordes oder eben der Hetze dahintersteckte.
Außerdem sollte sie die Biographien der Verfasser recherchieren, und vielleicht wäre ja sogar ein Treffer dabei, dass einer der beiden in seiner Jugend für den Stürmer oder den Völkischen Beobachter geschrieben habe.
Dann sollte sie den konkreten Fall recherchieren, am besten unter Zuhilfenahme juristischer Schriftsätze. Ob ein Fehlurteil erfolgt sei – »Das wäre der Jackpot«, hatte der uncoole Kland in der vermeintlich hippen Diktion seiner Jugend gemeint –, möglicherweise ein Fehlurteil, das mit der Berichterstattung zusammenhinge oder gar auf diese zurückzuführen sei.
Und schließlich natürlich die Biografie, den tatsächlichen Lebensweg der Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten.
»Was war vorher, was war nachher?«
Marie, im Geiste von Ruth Leuwerik, unterdrückte vornehm ein Stöhnen. Sie gab sogar zähneknirschend zu, dass Kland damit keinesfalls falschlag. Offenbar nahm er ihre Idee ernst, ernst genug, sie durch solches Nachfragen zu schärfen, auf den Punkt zu bringen.
Es war interessant, fesselnd sogar, aber auch … unheimlich viel Arbeit! Mehr, als sie sich je für irgendeine akademische Herausforderung gemacht hatte oder hatte machen müssen.
Marie war es gewohnt, mit ihrer zweifelsfrei vorhandenen Intelligenz bequem durchzurutschen. Schon seit der Schule. Sie musste nichts dafür tun, um überdurchschnittlich gute Noten zu bekommen, was hieß: Zweien. Wenn sie dann ein bisschen was tat − mit einer Attitüde, als wäre es ein Martyrium, zwei Stunden am Schreibtisch zu sitzen −, wurden aus den Zweien schnell Einsen. Im Studium war das kaum anders gewesen.
Sie hatte sehr viel Freizeit, wie Ruben, der ja eine Ausbildung machte und deswegen jammerte, als hätte er eine 270-Stunden-Woche zu absolvieren.
»Du beschäftigst dich so viel mit dir selbst, und dann erwartest du auch noch, dass andere ähnlich viel Zeit aufbringen, um sich mit dir zu beschäftigen.«
Und dann hatte er noch etwas Gehässiges gesagt, dass die 24-Stunden-Beschäftigung mit den Stimmungen seiner Freundin seines Erachtens kein anerkannter Ausbildungsberuf sei.
Aber zu dem Zeitpunkt war schon alles ziemlich kaputt zwischen ihnen gewesen, und die Beschimpfungen waren so stumpf geworden wie die Versöhnungen.
Maila, die auch sehr schlau war, aber deren Gedächtnis nicht ganz so schnell funktionierte wie Maries und die mehr üben musste, bis etwas saß, fand es auch eine »karmische Unverschämtheit«, mit wie wenig Arbeit Marie bisher durch ihr dreiundzwanzigjähriges Leben gekommen war.
Aber die Arbeit, die ihr jetzt anhand Klands Liste bevorstand, war wirklich enorm, fürchtete Marie. Sie erforderte zudem eine Struktur, Genauigkeit des Vorgehens und der Planung, was noch nie ihre Stärke gewesen war.
»Durchaus sehr originell, aber beim nächsten Mal bitte doch etwas mehr auf die Form achten«, stand seit jeher unter ihren Klausuren und Facharbeiten. Sie sah das ein, doch Marie reichte es, originell zu sein.
Aber sie wusste sehr genau, dass sie bei Kland damit nicht weit käme. Er würde sie durchfallen lassen, ohne mit der farblosen Wimper zu zucken.
Sie schrieb also zunächst in eine Datei, was sie zu dem Fall, den sie sich ausgesucht hatte, schon in Erfahrung gebracht hatte – wenig genug.
Die Journalisten: Ed von Ölwangen und Jokus Schlatten.
Die Medien: Rapid und Illustrierte Information.
Der Fall: Mord an der Gelegenheitsprostituierten Lizzy oder Lissy B., 23, durch ihre Ziehmutter Mathilde S., 54.
Der Prozess: Frühjahr 1958 in Köln.
Das Urteil: Lebenslänglich.
Der Hergang: Spätherbst 1957. Angeblich aus Habsucht und Neid auf die Jugend und Schönheit der Lizzy B. habe ihre ehemalige Ziehmutter die junge Frau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Seidenschal erdrosselt.
Die Ziehmutter leugnete, doch ihr Lebenswandel und ihre Berufstätigkeit schienen in den Augen der beiden Reporter ausgereicht zu haben, um sie zu überführen, noch bevor der Prozess überhaupt begonnen hatte.
Marie war rein zufällig in ihren alten Illustrierten darauf gestoßen. Aufmerksam war sie hauptsächlich deshalb geworden, weil die Rapid in vier aufeinanderfolgenden Ausgaben über den Fall berichtete. Zwei weitere Artikel hatte sie dann noch in der Illustrierten Information entdeckt.
Lizzy B. war 23 gewesen, also genauso alt wie Marie, und auf einem großen Porträtfoto hatte sie genauso ausgesehen, wie Marie gern ausgesehen hätte. Vielleicht war das der Auslöser gewesen, weshalb sie sich näher mit dem Fall beschäftigt hatte.
Süßes, herzförmiges Gesicht, perfekte Augenbrauen über tiefen, großen Augen, ein Mund wie gemalt, Haare in weichen Wellen.
Die hat ein Leben, hatte Marie für einen Moment neidisch gedacht, bevor sie verstanden hatte, dass diese junge Frau ermordet worden war.
Nun würde sie also tatsächlich herausfinden müssen, wer Lizzy B. gewesen war.
Mathilde S., 53, war ebenfalls eine sehr schöne Frau. Sie sah überhaupt nicht wie eine Mörderin aus.
Jokus Schlatten und Ed von Ölwangen hatten über sie jedoch das gleiche vernichtende Urteil gefällt: Mathilde S., selbst »moralisch verkommen«, hatte ihre Ziehtochter »wie eine Wilde« aufwachsen lassen und vernachlässigt. Selbst »eitel und putzsüchtig« habe sie der Ziehtochter deren Jugend so geneidet, dass sie sie schließlich in einem Anfall von Neid und Eifersucht erdrosselt habe.
Am Tatort habe sie ein Geständnis abgelegt, das sie dann widerrufen habe. Sie behauptete, Lizzy habe schon tot in der Wohnung gelegen, als sie von der Arbeit heimgekommen sei.
Ungünstige Charakterzeugnisse gegen Mathilde S., die vor Gericht zwar wohl nicht relevant waren, aber ein finsteres Bild zeichneten, waren mit Vorliebe von beiden Journalisten zusammengetragen worden.
Es war trotz der Aussicht auf Arbeit irgendwie aufregend.
Zunächst googelte Marie alles, was es zu googeln gab, und das war sehr wenig.
»Berühmte Fehlurteile der 1950-er« brachte sie ebenso wenig weiter wie »Justizskandale der frühen Bundesrepublik« und ein paar andere naheliegende Winkel, über die sie es versuchte.
Alle verwiesen bis zum Überdruss auf Rosemarie Nitribitt oder Vera Brühne, zu dem Zeitpunkt wurde sie aber schon von Ad-Trackern verfolgt, die ihr die entsprechenden Verfilmungen und Bücher virtuell andienten.
Also wechselte sie die Suchanfragen:
Ed von Ölwangen hatte Mitte der siebziger Jahre aufgehört zu schreiben.
Der Wikipedia-Artikel über ihn war nur sieben Zeilen lang.
»Ed von Ölwangen, Nom de Plume des Journalisten Werner Gönig. Geboren 1934 in Dortmund.«
1934! Deutlich zu jung für den Stürmer oder den Völkischen Beobachter. Mist. »Arbeitete als Journalist für …« Blabla. »Berichtete von den Olympischen Spielen 1956 aus Melbourne als Augenzeuge, obwohl er gar nicht nach Australien gereist war. Dieses unjournalistische Vorgehen brachte ihm unter Kollegen den Beinamen ›Melbourne-Ed‹ ein.«
Was für ein mieser Typ!
Kein Todesdatum. Ob der noch lebte? Marie notierte sich Geburtsdatum und beide Namen.
Sie rechnete. Melbourne-Ed müsste jetzt also 86 sein. Wann hätte der dann vielleicht aufgehört zu schreiben? Vor zwanzig Jahren? Zu lange her, um eine Onlineakte zu haben.
Und weil sie nicht so gut im Rechnen war, machte sie sich auch noch eine Notiz, dass er vermutlich gleichaltrig mit dem Opfer, Lizzy B., gewesen war. Oder nur wenig älter.
Die Suche nach Ed von Ölwangen wie auch die Suche nach Werner Gönig – 148 Ergebnisse, keines davon brauchbar, führte erst mal ins Nichts.
Jokus Schlatten hatte nicht mal einen Wikipedia-Eintrag und keinerlei Onlinespuren. Es gab »Jokus«-Treffer und »Schlatten«-Treffer, nichts im Zusammenhang, nicht mal ein Nachruf.
Das konnte ja heiter werden.
Der »Fall Lizzy B.« führte sie zu einer alten juristischen Fachzeitschrift, die aber online nicht abrufbar war. Man musste sie bestellen.
Es wurde immer besser.
Marie stand genervt auf, kratzte sich, Ruth Leuwerik einen Moment vergessend, mit allen zehn Fingern unter dem Rosie-Kopftuch, streckte sich und gähnte, bis ihr einfiel, dass sie sich ja vorgenommen hatte, sich gesammelter zu benehmen.
Sie klemmte sich den Laptop unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Information.
Dort hatte unglücklicherweise der »Frauenhasser« Dienst.
Der Frauenhasser, 50, schwul, bösartig, machte es sich offenbar zur Aufgabe, alle Studentinnen, die es wagten, sich bei ihm blicken zu lassen, so wenig wie möglich zu beachten, ihnen so wenig wie möglich zu helfen und sie nach Möglichkeit mit einem vernichtenden Kommentar zu entlassen.
Der Frauenhasser war allerdings auch nicht besonders nett zu Männern, nicht mal zu schwulen Männern.
Vielleicht hasste er auch einfach Studenten, was dann aber auch problematisch war, wenn man in einer Universitätsbibliothek arbeitete.
Aus irgendwelchen Gründen waren die natürlich längst und häufig erfolgten Beschwerden machtlos gegen den Frauenhasser. Er hatte eine unsichtbare, aber schwere Behinderung, hieß es, und sei daher trotz seines Verhaltens unkündbar. Man habe ihn, so berichtete der ASTA inzwischen sogar auf seiner Website unter FAQ, schon mehrfach auf AGG-Schulungen geschickt, aber der Frauenhasser blieb bei seinem Leisten und auf seinem Posten.
Ausgerechnet ihn nun zu fragen, wo in der ihr völlig unbekannten juristischen Abteilung Marie diese Zeitschrift finden oder wohin sie sie bestellen könnte, war zu viel verlangt, fand sie.
Lieber gab sie ihre Jacke an der Garderobe ab und fuhr mit dem Fahrstuhl in die juristische Abteilung in der vagen Hoffnung, dass sie ja dort irgendwen bitten könnte, ihr zu helfen.
Mehr noch als vage war diese Hoffnung nicht auf Erfahrung begründet. Marie hatte oft das Gefühl, dass sie selbst ebenso wie ihre Kommilitonen ihre eigene Hilfsbereitschaft für einen unbekannten Zeitpunkt reservierten. Jedenfalls gingen sie sparsam damit um. Unverbindliche Freundlichkeit, ein verwischtes »Hi« über dem Smartphone war ihr – und den anderen offensichtlich auch – meist genug des Guten. Und wenn einer eine Frage hatte, dann musste es doch irgendeinen Beauftragten geben, der sich da kümmern müsste, »sorry, du«.
Ein Thema, über das Maila viel zu sagen hatte. (Maila war immer noch im Flugmodus, wie Marie zwischendurch – diesmal schon leicht besorgt – feststellte.)
Angekommen auf dem Stockwerk der Juristen bemerkte sie als Erstes, dass ihre Mitbewohnerin Johanna hier nicht diejenige wäre, die sich seltsam kleidete, sondern Marie selbst wurde leicht abschätzig, bisweilen auch abschätzend betrachtet.
Eine Weile stand sie mit ihrer unbestimmten Hoffnung dumm herum, entschloss sich dann, systemisches Denken zu aktivieren, und loggte sich in den Katalog ein, um nach der Fachzeitschrift zu suchen.
Das gelang ihr erst mal auch ohne Hilfe, obwohl sie nicht wusste, ob sie darauf stolz war oder ob sie es schade fand, dass sie es sich schon nicht mehr einfach zutraute, jemanden um einen so kleinen Gefallen zu bitten. Die Zeitschrift und offenbar auch die entsprechenden Prozessakten konnte man mit ein bisschen Aufwand aus dem Archiv bestellen und vor Ort lesen.
Als sie abends in ihrer Wohnung ankam, war die Ruth-Angleichung nach den Anstrengungen des Tages ziemlich verblasst. Sie war todmüde.
Es war fast sechs. So lange hatte sie noch nie am Stück an einer Sache gearbeitet.
Ihr Nacken tat weh, sie fühlte sich zerschlagen und wünschte, es gäbe keine ökologischen Schuldgefühle, wenn sie sich jetzt in ein Fünfziger-Schaumbad legen würde.
Immerhin musste Johanna zwischendurch zu einer Einsicht gekommen sein, in der Küche war der Abwasch erledigt und es sah sehr aufgeräumt aus.
Zu aufgeräumt, genau genommen. Marie hatte den Verdacht, dass Johanna ihre Mutter hatte kommen lassen, um zu putzen, was sie manchmal tat, obwohl Marie es ihr mehrfach untersagt hatte.
Jetzt war sie zu matt, sich darüber aufzuregen.
Sie stieg unter die Dusche, schmierte sich ein Brot und zog sich auf ihr Bett zurück. Eigentlich wollte sie gar nichts machen, doch aus irgendeinem Grund ließ sie die Arbeit, so erschöpfend sie gewesen war, immer noch nicht los.
Sie angelte nach der Ausgabe der Rapid, in der sie zuerst von Lizzy B. gelesen hatte.
Es war ein Aufmacher über vier Seiten.
Zuerst das große Porträt von Lizzy selbst, schwarzweiß, der perfekte Lidstrich, den Marie trotz aller Tutorials zu Lidstrichen, die sie sich angesehen hatte, nie genauso hinbekommen würde.
Diese himmlische Haut, wie ein Filmstar sah sie aus.
Das war natürlich der Ansatz für Ed von Ölwangen gewesen: »So weiß wie Schnee, so rot wie Blut«, hatte Melbourne-Ed getitelt, »erst dreiundzwanzig und schon tot.«
»Am 11. November letzten Jahres wurde die dreiundzwanzigjährige Lizzy B. (Name ist der Redaktion bekannt) um 17 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ermordet. Erdrosselt mit einem Seidenschal. Der Anruf bei der Polizei erging vom Telefon der Nachbarin, Christel von B., einer aufmerksamen Hausfrau, die schon vorher laute Schritte und ein mutmaßliches Gerangel in der Wohnung gehört hatte.
Aufgelöst, so schildert es die sehr glaubwürdige, unbescholtene Zeugin unserem Reporter, habe kurz vor 18 Uhr Mathilde S., die Ziehmutter der Ermordeten, an ihre Tür geklopft und Sturm geklingelt.
›Die Lizzy, um Gottes willen, die Lizzy!‹, hatte die Frau in höchster Not ausgerufen.
Das verlässliche Zeugnis der Nachbarin: ›Ich sage, ja, um Himmels willen, Frau S., sage ich, was ist denn nur los mit Ihnen?‹ – da schreit sie: ›Die Lizzy ist tot!‹ und ›Sie müssen die Polizei rufen!‹ Ja, da war ich ja erst mal ganz perplex, verstehen Sie, ich bin dann ans Telefon, das war so wie im Krieg, als man auch erst mal funktioniert hat, ohne nachzudenken. Also rufe ich die Polizei an und sage, in der Nachbarwohnung sei etwas Schreckliches passiert. Und dann gebe ich die Adresse durch, drehe mich wieder um zur Frau S. – wir verkehrten ja sonst nicht miteinander, sie hat ... Ich will ja nichts gesagt haben, aber der Lebensstil der Frau … Na ja, aber in der Not, nicht, da hilft man sich ja schließlich. Also, ich drehe mich wieder um, da ist sie so völlig in sich zusammengesackt und wimmert immerzu: ›Wie konnte ich das nur tun, wie konnte ich das nur tun?‹«
Kapitel 4Rückmeldungen
Maila rief an. Marie schrak zusammen, so sehr hatte sie alles um sich herum gerade vergessen.
»Ja?«, keuchte sie ins Telefon.
»Was ist mit Kland?«, fragte Maila ohne Begrüßung zurück. »Warum ist er ein Kackhaufen-Kackhaufen-Blitz-Totenkopf-Emoji-mieser-Typ?«
»Was?«
»Hast du geschrieben«, erläuterte Maila, und dann übergangslos die deutlich interessiertere Frage: »Essen wir heute zusammen?«
»Was?«
»Essen. Wir. Heute. Zusammen? Ich kann was holen.«
»Nee, tut mir leid, ich hab schon gegessen.«
»Hast du dir was gekocht?«
»Äh, n-, warum?«
»Ich wollte nur mal sehen, ob deine Fähigkeiten zur Selbstversorgung sich bessern.«
Marie verdrehte die Augen. »Was soll das?«
»Also, warum ist er ein mieser Typ?«
»Ich soll mir total viel Arbeit machen mit diesem Ding.«
»Mit der Bachelorarbeit?«
»Ja, mehr, als sogar für eine Masterarbeit normal wäre.«
Maila nieste. »’tschuldigung. Und woher weißt du das, dass es so viel mehr ist?«
»Was bist du denn jetzt, sein Anwalt?«
»Was bist du denn so zickig?«
»Ich bin todmüde.«
Maila und Marie waren schon damals in der fünften Klasse die Einzigen gewesen, die unter ihren Mitschülern sonst niemanden kannten.
Einzelkinder, wie Maila später dozieren würde, neigten dazu, ihre Freundschaften eher wie Verschwisterungen zu betrachten.
»Ich bin kein Einzelkind«, würde Marie dazu dann sagen. Sie hatte einen Bruder, Burkhard, drei Jahre älter. »Du bist Einzelkind.«
»Aber in deiner Familie leben alle so bindungslos vor sich hin, dass du genauso gut ein Einzelkind sein könntest.«
Sie hatten die Pubertät zusammen überlebt, inklusive schlimmer Frisuren wie Dreadlocks und blauer Stirnponys (beides Maila), Phasen der verweigerten Hygiene (Maila für drei Monate), einer gepiercten Nase mit elterlicher schriftlicher Erlaubnis zum sechzehnten Geburtstag (auch Maila), waren ihre Jungfernschaft binnen vier Wochen quasi als verabredete »Support Group« losgeworden, bevor Maila dann die Idee kam, eigentlich doch lesbisch zu sein.
Maila hatte analysiert, dass sie in dieser Freundschaft der »agierende« Teil sei, während Marie sich »stellvertretend« durch Mailas Experimente auslebe.
»Nein!«, beharrte Marie dazu. »Ich toleriere sie bloß.«
Und Maila setzte dann das überlegene Lächeln auf, das immer hieß: »Aha, sie ist in der Verleugnung.«
Marie war in der Tat die Unauffälligere von beiden. Hübsch, nett, wohlerzogen, war ihr Fünfziger-Fimmel vielleicht das Interessanteste oder Außergewöhnlichste an ihr. Aber doch auf eine gedämpfte Art.
Sie war ansonsten das, was die Freundinnen ihrer Mutter gerne ein »nettes junges Mädchen« nannten oder die politischeren unter ihnen vielleicht eine »nette junge Frau«.
»Nett ist die kleine Schwester von Scheiße«, wusste Maila dazu zu sagen.
Maila mit ihren Gewichtsproblemen, mit denen sie wie mit allem anderen offensiv bis aggressiv und doch hilflos umging, mit ihren schlimmen Frisuren, ihren Kleidungsfehltritten, ihrer politischen Radikalmeinung, die sich jeden Monat einem anderen Zweck zuwendete; Maila, die wie ein wütender und trotzdem liebenswerter Gummiball zwischen aller elterlichen Toleranz – »Desinteresse!« – scheinbar richtungslos hin und her topste.
Und Marie, die ziemlich lieb und nett, »mainstream eben«, leidlich kooperativ, leidlich leistungsbereit, leidlich normal, natürlich auch verwöhnt und verzogen, wie fast alle jungen Menschen in ihrem Umfeld, irgendwie das machte, was alle wollten, irgendwie aber auch nicht genug machte.
Verschwisterung war ein gutes Wort für eine solche Freundschaft, die eine Beziehung war − und mehr. Etwas, das beide brauchten, egal, wie sehr sie manchmal voneinander genervt waren.
Sogar Maila hatte manchmal weiche Momente, in denen sie davon phantasierte, dass sie noch genauso zueinanderstehen würden, wenn sie alt wären.
Alt war dabei ein unbestimmter Zustand fortgeschrittenen Erwachsenseins, nicht ein bestimmtes chronologisches Alter, denn Maries Mutter, Mitte fünfzig, bestand selbstredend darauf, dass sie noch nicht alt sei.
Und Maries Großmutter, Anfang achtzig, konnte man mit dem Adjektiv auch leicht verärgern.
Dass Maila glaubte, lesbisch zu sein, was weder bewiesen noch entkräftet werden konnte, da sie beziehungslos lebte, war ein eher beschwiegenes Thema zwischen den Freundinnen.
Ebenso wie Maries mangelnde Interaktion mit Männern. Nach der Trennung von Ruben gab es natürlich erst mal eine Schonfrist. Oder sollte sie in Mailas Augen eben nicht geben, die den Standpunkt vertrat, Marie müsse doch nur munter in der Gegend herumschlafen, um »den Typen zu überwinden«.
»Wer will sich jetzt stellvertretend ausleben?«, hatte Marie da geätzt.
Sie hasste es, dass man Verabredungen Dates nannte, dass es diese Plattformen gab, in denen man sich einen potenziellen Partner customizen konnte. Sie wollte eine »wirkliche Begegnung«, wie sie es für sich nannte. Nur für sich nannte sie es so – man konnte ja nicht wissen, was Maila daraus gemacht hätte.
Ihre Vorstellung war klar. Sie wollte einem Mann begegnen, der erstens keinen Wuscheldutt, keine Dreadlocks und keine Gelfrisur trug und der in ihr eine Art Ganzkörperstillstand auslöste. Keinesfalls war sie, zu ihrem eigenen Erstaunen, an einem dieser Rockabilly-Typen interessiert, was man ja vielleicht – passend zu ihrem Retro-Wahn – hätte vermuten können.
Marie mochte deswegen nicht mit Maila über die Abwesenheit von Männern in ihrem Leben sprechen, weil sie zu Recht vermutete, dass Maila eine Vermeidung diagnostiziert hätte, getarnt hinter überhöhten Ansprüchen.
Und weil Marie wusste, dass Maila dasselbe Urteil fürchtete, schwiegen sie beide zu beidem.
Sie teilten Abende wie den heutigen im Einverständnis, dass sie in ihrer beider Gesellschaft – am Telefon oder direkt – zumindest niemandem etwas vormachen mussten, sondern in welchem Stadium sie auch immer waren, sie selbst sein konnten.
Das war ihnen beiden viel wert.
»Willst du noch vorbeikommen? Du kannst übernachten, wenn du willst.«
Maila wollte plötzlich nicht.
»Nur weil wir nicht zusammen essen?«
»Nein, einfach so.«
Marie verdrehte wieder die Augen. Aber im Kampf zwischen Einsamkeit und Müdigkeit war es ihr doch auch ganz recht, gleich Zähne putzen und dann direkt ins Bett gehen zu können.
»Morgen Abend?«, fragte sie versöhnlich.
»Schreiben wir, ja?«, war Mailas Antwort, aber sie klang nicht angesäuert oder manipulativ. Verbindlichkeit war einfach ein großes Thema für sie.
»Ist gut«, sagte Marie. Sie renkte sich fast den Kiefer aus, so musste sie gähnen. Sie versuchte es lautlos zu tun.
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, taumelte Marie unter die Dusche.
Sie war jetzt zu müde, um an Ruth Leuwerik zu denken, zu müde, um an Lizzy B., Mathilde S. oder Schlatten und Melbourne-Ed zu denken. Sie wollte einfach nur noch ins Bett und musste sich geradezu zwingen, noch ihre Zähne zu putzen.
»Was meinst du, wenn du mal kleine Kinder hast«, hörte sie die etwas bitter klingende Stimme ihrer Mutter aus einiger Entfernung in ihrem Gehirn, »dann weißt du erst, was müde ist.«
Marie sah nicht mal mehr auf ihr Telefon; sie fiel ins Bett und schlief ein.
Als sie aufwachte, war es fünf Uhr morgens.
Es war natürlich viel zu früh, um aufzustehen. Gleichzeitig waren es nur drei Stunden bis acht Uhr, dem Zeitpunkt, zu dem sie Kland die Antworten auf die »offenen Punkte« zusenden sollte.
Obwohl die gestrige Müdigkeit irgendwie noch ein Echo hinterlassen hatte, war Marie hellwach. In ihrem Kopf gingen die Überlegungen zu ihrer Arbeit sofort wieder los.
»Struktur«, murmelte sie ein paarmal, als könnte ihr das zu einer Erleuchtung verhelfen.
In der Schule hatten sie immer gesagt, man müsse einen Text so verfassen, dass auch jemand, der keine Vorkenntnisse hat, ihn verstehen könnte.
In der Uni hieß es dann, dass der Text sich ausschließlich an ein wissenschaftliches Publikum richten sollte; somit müssten bestimmte Dinge weder erklärt noch erwähnt werden.
Marie schob beide Ansätze in ihrem Kopf hin und her.
Das, was hier entscheiden sollte, fand sie, war Lizzy B.
Sie beschloss, dass ihre Struktur mit dem anfangen sollte, was sie über das Leben von Lizzy B. wusste.
Faktisch. Sachlich. Und dann, was sie über deren Ziehmutter wusste. Komisches Wort, altmodisch.
Sie stellte die Kaffeemaschine an, auch auf die Gefahr hin, dass das Geräusch zu so früher Stunde Johanna wecken könnte, und setzte sich direkt an ihren Schreibtisch.
Auf ein Blatt schrieb sie: »Lizzy oder Lissy B. bzw. Elisabeth Berger«, und auf das andere Blatt schrieb sie: »Mathilde S.«, das S. stand für Schmidt.
Und wie sie so nebeneinanderlagen, dachte sie an den Ausdruck, dass jemand ein unbeschriebenes Blatt sei.
Irgendetwas hatte das mit Mathilde zu tun; sie meinte sich zu erinnern, dass Schlatten oder Ölwangen in einem der Artikel geschrieben habe, Mathilde S. sei »bei weitem kein unbeschriebenes Blatt«.
Was hatte er damit wohl gemeint?
Lizzy hatte man den Vorwurf der Prostitution gemacht, aber Mathilde doch nicht, oder?
Da war irgendwas mit diesem seltsamen Kuppeleiparagraphen. War es das?
Sie suchte in den Ausschnitten und Aufzeichnungen.
Melbourne-Ed war es gewesen!
Da: »Mathilde S. hat es nie so genau genommen«, wusste ihre Nachbarin Christel von Banowski zu berichten. »Ich kenne die Dame. Als ihr armer Mann im Lazarett war, ein braver Soldat, wo er dann seinen Verletzungen erlag, und auch schon vorher, unterhielt sie intime Beziehungen zu einem Tunichtgut, einem gewissen Herrn Willemes oder so. Jude war er nicht, aber der Name klang so. Und wie ein Zigeuner sah er aus. Die war sich für nichts zu schade. Überall haben die beiden es getrieben. Schamlos.«
Marie schrieb »Zeugin: Christel von Banowski« auf das Blatt. Und dann: »Außereheliches Verhältnis, wann, mit wem? Willemes?«
Auf den Bildern, die sie zeigten, sah Mathilde trotz ihres Alters sehr schön aus, eben auf eine sehr erwachsene Art. Eine richtige Frau, dachte Marie, oder eine Dame eher, die einem Respekt einflößte. Sie hatte ein ebenmäßiges, ruhiges Gesicht voller Anmut.
Lizzy B. war ja auch hübsch, toll zurechtgemacht, aber doch eben sehr jung und ohne eine Geschichte in ihren Zügen.
Aber Mathilde hatte etwas, dachte Marie, so eine echte, eine erzählende Schönheit. Wissende Augen und einen sinnlichen Mund.
Marie nahm den Ausschnitt der Großaufnahme, die neben einem der Berichte abgedruckt war, in die Hand.
Es war eines der Bilder, wie Marie sie aus den frühen Fünfzigern kannte, aber es schien noch etwas älter zu sein beziehungsweise Mathilde noch etwas jünger. Mathilde im Porträt, die sich über die Schulter zum Fotografen umdrehte, ein zärtliches Lächeln auf ihren Zügen.
Marie versuchte, ihren Ausdruck zu deuten. Sie sah den Fotografen voll an, aber es war kein Bild der Eitelkeit. Sie machte das Bild für jemanden, den sie so ansehen wollte; nicht für Lizzy, das war klar, das war kein mütterliches Bild. Das war ein Bild, bei dem ein Mann Verlangen empfinden würde, auf eine Art, die durch nichts Vulgäres ausgelöst worden wäre.
»Toll«, flüsterte Marie und wünschte, es gäbe jemanden, den sie so ansehen wollen würde. Der das nur durch den Gedanken an ihn mit ihrem Gesicht machen würde.
Das Bild war arrangiert, aber nicht gestellt, dachte sie.
Mathilde hatte schöne gerade Augenbrauen, zum Ende hin etwas aufsteigend, die nicht so zu Tode gerupft waren wie sonst bei vielen Frauen ihrer Zeit.
In ihrem Gesicht stand eine Geschichte, eine Liebesgeschichte.
»Kein unbeschriebenes Blatt«, hatte die Nachbarin gesagt.
Vielleicht war es eine gute Geschichte? Eine zwiespältige?
Mathilde, die ihren Mann betrogen hatte, als der im Lazarett war. Stimmte das?
Aber selbst wenn, das machte ja noch niemanden zum Mörder. Nur, ein Charakterzeugnis war das ja wohl auch nicht, fand Marie.