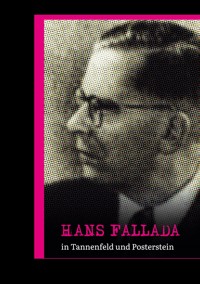Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Wie kann man Dänen kennenlernen? Der Däne an sich nämlich ist freundlich, er bleibt aber gerne unter sich. Und benutzt gerne Redewendungen, die man besser nicht übersetzt. "Dein Essen schmeckt ja scheißgut!" Überhaupt: Die Dänen essen gern "smørrebrød"; allerdings kommt es dabei ganz genau auf die verschiedenen, strikt festgelegten Kombinationen von Belägen an. Wer falsch kombiniert, wird merkwürdig angeschaut. Dies alles und noch viel mehr lernt Marlene Hofmann einem Jahr Kopenhagen kennen und lieben – ja, auch lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marlene Hofmann
Ein Jahr in Kopenhagen
Reise in den Alltag
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in Kopenhagen
Reise in den Alltag
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Margot Hanel
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80401-4
ISBN (Buch): 978-3-451-06734-1
Inhalt
Davor In Dänemark gefunden
November Einsiedlerkrebse
December Ankommen auf dem Fahrradhighway
Januar Flagge zeigen in Dänemark
Februar Dänen unter sich
Marts „Klein-Berlin“
April Allein unter Dänen
Maj „Scheißgutes“ Essen und „pisswarmer“ Tee
Juni Autos, Elche und andere Einwanderer
Juli Halb so viel Panik
August Mein Kind darf Jensen heißen
September Dänische Datensammler
Oktober Kinderwagen-Rallye auf Nørrebro
Danach Dänemark ist besser, als man denkt
Dank
DavorIn Dänemark gefunden
Meinen Freund Niels lernte ich bereits vor zwei Jahren bei einem Auslandssemester im dänischen Aarhus kennen. Meine letzte, innerdeutsche Fernbeziehung war damals an den 400 Kilometern Entfernung zerbrochen, da schlitterte ich in die nächste, diesmal dänisch-deutsche Wochenend-Beziehung. Die geriet in meinem Bekanntenkreis schnell zum Schenkelklopfer: „Dein Freund heißt Niels, hat blonde Haare, blaue Augen und kommt aus Dänemark?“ Großes Gelächter. Dabei war Nils Holgersson Schwede!
Wie die meisten Deutschen kannte ich Dänemark bisher nur aus dem Urlaub. Beim Studium der skandinavischen Sprachen wollte ich lieber Schwedisch lernen. Mein Skandinavistik-Professor bestand darauf, dass alle Skandinavier sich – wenn sie nur wollten – ohnehin verstehen könnten. Was aber auf Konferenzen funktionieren mag, überforderte die Dänen im Alltag. Meine Mitbewohner im Wohnheim bedachten mich mit verwirrten Blicken, wenn ich in der Küche verzweifelt nach einem „kastrull“ (schwedisch: Topf) suchte. Dann wusste ich, dass diese Vokabel in Dänemark keiner kannte. Obwohl man dort immerhin ab und zu eine „kasserole“ (kleiner Topf) benutzt, war die schwedische Aussprache wohl zu weit weg. Ein stinknormaler Topf, das lernte ich schnell, heißt auf Dänisch „gryde“ – ausgesprochen mit „weichem D“, einer ganz besonderen dänischen Spezialität. Man lallt etwas, lässt die Zunge locker aus dem Mund hängen, als sei sie geschwollen, und bringt dann eine Art britisches „th“ hervor, das aber ganz ohne ausgehauchte Atemluft zäh heruntertropft.
Pendelnd zwischen Hamburg und Aarhus verwandelte sich meine klare schwedische Aussprache schnell in ein undeutliches Gemurmel, gemischt mit weichen Ds und Atemaussetzern ähnelnden dänischen Stoßtönen. Dabei entwickelte ich einen ganz eigenen schwedisch-deutschen Akzent, der die meisten Dänen erst einmal gründlich verwirrte.
Hamburg gefiel Niels gut, besonders weil man an fast jeder Ecke zu – aus dänischer Sicht – Schleuderpreisen leckeren Kaffee trinken konnte. Aber dort wohnen?
„Du hast mich doch in Dänemark gefunden!“, wandte er ganz diplomatisch ein – und zog nach dem Studium in die Landeshauptstadt Kopenhagen, wie fast alle Dänen. Nicht zuletzt, weil ich ja die ehemalige Skandinavistik-Studentin mit den entsprechenden Sprachkenntnissen war, beschloss ich, gleich nach dem Studium ebenfalls nach Kopenhagen zu ziehen. Ein passender Job für eine deutsche Journalistin würde sich schon finden, oder?
Ein paar Vorurteile gegen die kleine, unscheinbare Hauptstadt hatte ich schon. Auf den beiden Exkursionen in die lokale Museums- und Theaterwelt während meines Studiums lobte meine Universitätsdozentin, eine gebürtige Kopenhagenerin, die Stadt dermaßen in den Himmel, dass allein das schon meine Skepsis wecken musste. Aber immerhin sollen hier ja die glücklichsten Menschen der Welt leben! Schon mehrmals in Folge bezeichneten verschiedene Studien, unter anderem auch der „World Happiness Report“ und Berichte der OECD, die Dänen so. Das liegt natürlich auch am hohen Einkommen, am gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat und an der vergleichsweise geringen Arbeitslosigkeit. Viele Dänen sind wie meine Dozentin stolz auf ihre kulturelle und grüne Hauptstadt und ihr Land im Allgemeinen, auf ihre Monarchie (mit über tausend Jahren die älteste Europas!) und selbstverständlich auf ihre glorreiche Wikinger-Geschichte.
Ein rosiges Bild. Aber schon Shakespeares „Hamlet“ stellte ja fest, dass etwas faul sei im Staate Dänemark. Gleichzeitig belegten die Dänen nämlich auch Spitzenplätze in unrühmlichen Hitlisten über die depressivsten Völker der Welt. Das Burn-out-Syndrom mache den Nordlichtern am Arbeitsplatz zu schaffen, viele gingen offenbar wegen Stress und Depressionen vorzeitig in den Ruhestand.
Da drängte sich mir die Frage auf, wie so unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse zusammenpassen können. Ist die eine Hälfte der Nation depressiv, die andere manisch? Oder wechselt die Laune des Durchschnittsdänen jede zweite Minute von „himmelhoch jauchzend“ nach „zu Tode betrübt“? Ich wollte mich aufmachen, das herauszufinden.
NovemberEinsiedlerkrebse
Gar nicht so einfach, eine passende Wohnung in Kopenhagen zu finden. Wir stellten hohe Ansprüche: Sie sollte zentral und nah am Stadtzentrum sein, am besten im angesagten Multi-Kulti-Viertel Nørrebro. Keinen Monat länger wollte Niels dreißig Fahrradminuten von der Altstadt entfernt in dem gemütlichen und strandnahen Villenviertel auf der Insel Amager verbringen (obwohl ich da nicht protestiert hätte!). Natürlich sollte die Wohnung auch günstig sein – und ganz schwierig: zur Miete.
Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der man erst dann über einen Immobilienkauf nachdenkt, wenn man sich sesshaft machen und möglichst für immer am auserwählten Ort bleiben möchte. Die Kopenhagener aber betreiben in diesem Punkt eine Kultur der Einsiedlerkrebse, die sich einfach das nächstgrößere Schneckenhaus suchen, wenn das alte zu klein geworden ist. Weil das alle so handhaben, die Banken großzügig Kredite dafür hergeben und die Wohnlage Kopenhagen wohl auch zukünftig zuverlässig attraktiv bleiben wird, funktioniert die Kauf-Verkauf-Kultur auch ganz gut. Mich, als bisher nicht besonders sesshaften Wandervogel, schreckte das erst einmal ab. Natürlich musste als erste Bleibe im Ausland und als erste gemeinsame Wohnung eine Mietwohnung her, man will sich doch nicht gleich für immer festlegen!
Wir stellten fest, dass vergleichsweise wenige Mietwohnungen auf kostspieligen Internetportalen angepriesen werden, dazu oft sehr teuer und nur für begrenzte Zeit. Während ich in Hamburg saß und recherchierte, pilgerte Niels in Kopenhagen von Wohnungsbesichtigung zu Wohnungsbesichtigung.
Nur einmal schaffte ich es auch, bei einer dieser „Åbenthus“-Veranstaltungen („offenes Haus“) dabei zu sein. Der Stadtbus spuckte uns an einer vierspurigen, viel befahrenen Hauptstraße aus. Wir mussten nicht lange suchen, denn vor einem ansonsten unscheinbaren Hauseingang standen bereits gut zehn Leute und warteten. Bis der Makler die Tür öffnete, gesellten sich noch mehr Menschen dazu. Dann zog die Karawane die Treppe hinauf in den zweiten Stock, hinein in eine frisch geweißte Dreizimmerwohnung mit Blick auf die große Straße auf der einen Seite und einen als Lagerraum und Parkplatz genutzten trostlosen Hinterhof auf der anderen. Das Bad mit Waschbecken und daran angeschlossener Dusche sowie schräg stehendem Klo maß etwa anderthalb Quadratmeter. Nein, eine Waschmaschine könne man in der Wohnung leider nicht anschließen. Wer Interesse habe, könne sich auf der Liste dort eintragen, sagte der ansonsten wortkarge Makler. Schlüsselübergabe in zwei Tagen. Desillusioniert machten wir uns wieder aus dem Staub. Auf dem Weg nach unten sahen wir im Treppenhaus eine Menschenmenge, die offenbar geduldig auf den Beginn der nächsten Besichtigung wartete.
Unsere alten Wohnungen waren längst gekündigt, der Umzug geplant, einzig, es fehlte das Dach über dem Kopf, und der 1. Dezember, an dem ich spätestens meine Hamburger Bleibe verlassen musste, rückte immer näher. Ich bekam Schweißausbrüche angesichts Niels’ dänischer Gelassenheit in dieser Situation.
„Ich poste einfach täglich auf Facebook, dass wir eine Wohnung suchen“, erklärte er über Skype, was mich wohl beruhigen sollte. Bisher hatte es außer vielen „Likes“ keine Wohnungsangebote via soziale Netzwerke gerieselt.
In verschiedenen Rankings zählt Kopenhagen zu den teuersten Städten der Welt. Wenn es die dänische Hauptstadt mit ihren – das weitere Umfeld eingeschlossen – 1,2 Millionen Einwohnern nicht in die Top Ten schafft, dann landet sie doch meist zuverlässig auf Listen der dreißig teuersten Städte. Kurz bevor ich angesichts unserer Wohnungslosigkeit endgültig in Panik ausgebrochen wäre, tauchte – über Facebook! – ein privates Wohnungsangebot auf. Ich verließ mich ganz auf Niels’ ortskundiges Urteilsvermögen, und zwei Wochen später trugen wir unsere Umzugskisten und Möbel in den ersten Stock eines Backsteinbaus mitten im Viertel Nørrebro. Mit rund tausend Euro Warmmiete waren die rettenden sechzig Quadratmeter für Kopenhagener Verhältnisse ein Schnäppchen. Das zwei Quadratmeter große Badezimmer mit WC und Dusche sei absolut nicht das kleinste, was man hier kriegen könne. In der Tat konnte ich auch später noch Bäder besichtigen, in denen man sitzend duschen musste, mit den Knien direkt am Türrahmen. Das alles ist freilich nichts gegen die angesagten, zentralen Wohnungen ganz ohne Dusche, deren Bewohner dann regelmäßig öffentliche Badeanstalten oder Gemeinschaftsbäder (Bewohnerbad – „beboerbad“ – genannt) aufsuchen müssen. Die liegen dann beispielsweise im Kellergeschoss eines Wohnhauses, und drinnen reihen sich Duschkabinen aneinander wie in einer Schwimmhalle. In der hippen Jægersborggade begegneten mir öfter Leute in Bademänteln auf dem Weg zur morgendlichen warmen Dusche …
Diese Zustände rühren noch aus der Zeit her, als das Viertel Ende des 19. Jahrhunderts in wenigen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft wurde. Zwischen 1850 und 1900 wuchs die Kopenhagener Bevölkerung von zunächst rund 10 000 auf über 100 000 Einwohner, und man baute nun auch im großen Stil Häuser außerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Was damals als Slum-ähnliche Arbeiterkasernen entstand, ist heute meist saniert und im Innenhof begrünt und gemütlich. Leider passt in die meisten kleinen Arbeiterwohnungen von damals auch heute offenbar höchstens ein winziges Badezimmer!
Unsere neu errungenen Quadratmeter richteten wir zunächst einmal ziemlich zweigeteilt ein, als verliefe die dänisch-deutsche Landesgrenze mitten durchs Wohnzimmer. Die eine Seite dominierten Niels’ schlichte weiße Möbel, seine Bücher und Schallplatten, die andere bevölkerten bunte Regale mit deutschsprachiger Literatur und meiner CD-Sammlung. Bis heute gibt es bei uns auch zwei Besteckkästen: einen für Niels’ geerbtes Silberbesteck und einen mit meinen bunten IKEA-Gabeln und -Messern darin.
An einem grauen Wochenende im November fiel Niels’ gesamte jütländische Familie in unserer Zweizimmerwohnung ein und half beim Möbelschleppen. Einen Esstisch und vier wackelige, grün gepolsterte Stühle bekamen wir von Niels’ Cousin spendiert. Ein klappriger weißer Kleiderschrank wurde sorgfältig wieder zusammengeschraubt und die alten Papierlampen aus dem schwedischen Möbelhaus wieder entfaltet und aufgehängt.
Niels erkämpfte sich die Wandfarbe Weiß, etwas anderes sei in Skandinavien einfach inakzeptabel. Meine Hamburger Wohnung mit ihren blau-gelben Wandbemalungen habe ihn ohnehin immer an einen Kindergarten erinnert, obwohl farbige Wände auch in dänischen Kindergärten extrem selten seien. Meine orangefarbenen Gardinen und die lilafarbenen Regale durften bleiben und ergänzten sich ausgezeichnet mit Niels’ ebenfalls quietschorangefarbenem Sofa und einer passenden Stehlampe, beides Trophäen aus Second-Hand-Läden. Dänischer Besuch, der unsere Wohnung zum ersten Mal sah, rief typischerweise Sätze wie: „Oh, so farbenfroh hier bei euch …!“ Und man wusste nie, ob das ein Kompliment sein sollte.
Am Ende eines langen, vom Inhalt unserer Umzugskisten dominierten Tages platzierte Niels einen alten Röhrenfernseher auf einem kaputten Verstärker und steckte die Kabel probeweise in die dafür vorgesehene Dose. Obwohl wir gar keinen Vertrag abgeschlossen hatten, flimmerte sogleich ein Bild auf: ZDF! Niels schaltete um: Das schwedische Staatsfernsehen SVT konnten wir auch empfangen! Niels schaltete nochmals um und atmete erleichtert auf, als auch das dänische staatlich finanzierte Fernsehen DR erschien. Ich lernte schnell, dass dort so gut wie jeden Abend Geschichts-Dokus laufen, meist über den Zweiten Weltkrieg.
„Wer soll sich denn Abend für Abend Dokumentationen über die Stellungen der verschiedenen Armeen anschauen?“, fragte ich überrascht.
„Ich finde das entspannend“, meinte Niels nur und schaute tatsächlich regelmäßig das abendliche „Kriegsprogramm“. Überhaupt stellte ich bald fest, dass der Durchschnittsdäne über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs viel detaillierter Bescheid zu wissen scheint, als es der deutsche Schullehrplan je hätte vermitteln können.
An dem Wochenende, als ich nach Kopenhagen kam, fiel auch der erste Schnee des Jahres. Die dänische Hauptstadt begrüßte mich mit grauer, trostloser Fassade. Die kleinen, von Einwanderern aus aller Welt betriebenen Gemüse- und Tabakläden wirkten heruntergekommen, der Müll, den die Dänen beim Feiern am Wochenende auf den Fußwegen hinterlassen, verbesserte die Stimmung nicht, und ein paar Straßen weiter klaffte am Jagtvej Nummer 69 ein großes, unbebautes Loch, das an das berühmt-berüchtigte „Ungdomshus“ erinnerte. Seit 1982 trafen sich Jugendliche aus dem politischen und kulturellen Untergrund Kopenhagens in dem ursprünglich einmal denkmalgeschützten Haus von 1897. Auf Drängen eines neuen Eigentümers wurde das Gebäude Anfang März 2007 nach gewaltsamen Demonstrationen und Straßenkämpfen mit der Polizei kurzerhand abgerissen. Heute ist der Platz eine Art Pilgerstätte für Graffitikünstler und ein Sammelplatz für Sperrmüll und Tauben – und natürlich nehmen hier regelmäßig Demos ihren Anfangs- oder Endpunkt.
Fasziniert beobachtete ich vom Fenster aus, wie dicke Schneeflocken vorbeiflogen und unten auf der Straße sofort schmolzen. Dort stand auch mein inzwischen bald zehn Jahre altes Auto, das mir in Hamburg treue Dienste geleistet und nun auch den Weg in den Norden geschafft hatte. Allein, es durfte nicht bleiben! Mit Schrecken las ich auf der Website der deutschen Botschaft, was es kostete, ein ausländisches Fahrzeug zu importieren. Egal, ob nur für den Privatgebrauch oder ob der eigentliche Fahrzeughalter in Deutschland lebt, ein Auto muss nach zwei Wochen Aufenthalt in Dänemark erst einmal offiziell registriert werden. Was so harmlos klingt, beinhaltet eine Gebühr von 60 bis 63 Prozent des aktuellen Verkehrswertes des Autos – auf dem dänischen Markt, wohlgemerkt.
„Wie dachtest du, wie wir diesen Wohlfahrtsstaat hier finanzieren?“, fragte Niels, als ich einfach nicht auf hören konnte, mich über diese Abgabe, die wohl den dänischen Markt vor billigen ausländischen Importen schützen soll, aufzuregen.
So viel war mir mein Umzug ins Land des Glücks dann doch nicht wert, und ich beschloss, ganz aufs Fahrrad umzusteigen.
DecemberAnkommen auf dem Fahrradhighway
Ich erwog ernsthaft, mir einen Seitenspiegel an mein altes, immerhin kostenfrei importiertes Mountainbike zu schrauben, um meine ersten Radelversuche in Kopenhagen unbeschadet zu überstehen. Direkt vor unserer Haustür verlief die Nørrebrogade, die geradewegs in die Innenstadt führt. Vor einigen Jahren ließ die Stadt Kopenhagen sie zu einer Art Fahrradhighway ausbauen: Die Autos mussten auf eine einzige Mittelspur weichen, Fahrrädern steht dafür ein Radweg zur Verfügung, der so breit ist, dass auch ein Kleinwagen bequem darauf fahren könnte. Dort radelt man dann in zwei Spuren, überholt wird links, ganz forsche Radfahrer überholen auch die Überholenden noch weiter links. Dabei gilt: Unbedingt vorm Ausscheren einen Blick über die Schulter werfen! Bei meinen ersten Fahrversuchen kam der erhöhte Puls eindeutig nicht vom Pedaletreten.
Niels fand, ich müsse dringend Leute kennenlernen – und was sei dafür besser geeignet als ein Fest? Von November bis Mitte Januar veranstalten Dänen aller Altersgruppen bevorzugt Weihnachtsfeiern. Was aber so harmlos bis langweilig klingt, kann von der tatsächlich öden Betriebsweihnachtsfeier, wie man sie aus Deutschland kennt, bis zur rauschenden Party mit roter Zipfelmütze alles sein.
An einem Freitag Mitte Dezember besorgten wir zwei Weihnachtsmützen, die hier „nissehue“ heißen und benannt sind nach dem „nisse“, einer Art kleinem Kobold, der Dänemark offenbar seit Jahrhunderten ungesehen bevölkert. Mit Mützen, Bier und verschiedenen Gläsern Hering bewaffnet machten wir uns mit dem Fahrrad auf den Weg zu einem solchen „julefrokost“, einem Weihnachtsessen bei Niels’ ehemaligen Mitbewohnern.
Das dänische Wort „frokost“ verwirrte mich anfangs: Warum sagten sie Frühstück zum Mittagessen, und warum aßen sie ihr meist kaltes Mittagessen an Weihnachten abends? Niels’ Mutter hatte mir einmal erklärt, dass viele ältere Menschen mittags noch warm essen, so wie es früher war. Dann nennen sie ihre Mahlzeit auch „middag“ und nicht „frokost“. Die meisten Dänen essen mittags aber inzwischen belegte Brote und abends, wenn die Familie gemeinsam am Tisch sitzt, warme Gerichte. Dann sagt man mittags „frokost“ und abends „middag“. Weil beim traditionellen „julefrokost“ jedoch belegtes Brot auf dem Menü steht, heißt es „frokost“. – Merkwürdig nur, dass die schwedischen Nachbarn das Konzept nicht vollständig übernommen haben. Dort gibt es morgens „frukost“, mittags „lunch“ und abends „middag“…
In den vergangenen zwei Wochen hatte Niels schon zwei Weihnachtsfeiern absolviert – mit den alten Studienkameraden in Aarhus und feuchtfröhlich mit der ehemaligen Band –, und normalerweise nahm man den Partner dazu nicht mit. Um die Weihnachtszeit verbreiteten die Medien regelmäßig Gerüchte darüber, dass die traditionsreichen Weihnachtsfeiern mit ihrem ungehemmten Bier- und Schnapskonsum alljährlich die Scheidungsrate in die Höhe schnellen ließen. Weil ich aber inzwischen lang genug von Hamburg aus in Niels’ alte Wohngemeinschaft gependelt war, konnte man in meinem Fall offenbar ein Auge zudrücken. Um zu dem kleinen, gelben Einfamilienhaus auf der Insel Amager zu gelangen, würden wir die gesamte Innenstadt durchqueren und über den 1619 von König Christian IV. im wortwörtlichen Sinn aus dem Sumpf gestampften Stadtteil Christianshavn nach Amager radeln müssen.
„Ein Seitenspiegel? Das ist doch uncool“, rief Niels und lachte mich aus. Der Spiegel blieb vorerst in der Werkzeugkiste. Ohne Fahrradhelm loszuziehen konnte sich Niels allerdings nicht vorstellen. Obwohl es erst später Nachmittag war, lag die Stadt bereits im Dunkeln. Auf den selbst in Seitenstraßen gut beleuchteten Radwegen kommen die meisten Einheimischen jedoch mit zwei minimalistischen Blinklichtern am Fahrrad aus – vorn ein weißes, hinten ein rotes. Als Autofahrer muss man in dieser Stadt beim Abbiegen ganz genau hinsehen!
In Kopenhagen gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Über die Hälfte der Kopenhagener ist täglich auf dem Rad unterwegs, und die Parteien schreiben sich bevorzugt in die Wahlprogramme, diesen Anteil noch zu erhöhen. An verschiedenen Stellen werden seit 2009 die vorbeirasenden „cyklister“ automatisch gezählt. Selbst im Winter kommen an Werktagen gerne 12 000 bis 14 000 Radler über die Dronning-Louises-Brücke zwischen Nørrebro und Innenstadt, und dabei werden nur alle die gezählt, die stadtauswärts unterwegs sind!
Apropos Winter: Eigentlich ist Dänemark nicht gerade als Bastion des Wintersports bekannt. Die ersten beiden verschneiten Dezemberwochen in Dänemark belehrten mich aber, dass es durchaus Ausnahmejahre geben kann. Auch die Dänen schienen darauf nicht vorbereitet zu sein, denn auf mich wirkte es, als fehlte es an Streusalz wie Schneepflügen gleichermaßen. Wo Norweger und Schweden aber die Skier hervorholen, fahren die Dänen seelenruhig weiter Fahrrad – getreu der alten skandinavischen Volksweisheit: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Also rein in die langen Unterhosen, dicken Thermohosen, zwei Paar Handschuhe und Ohrenschützer. Der dänische Radfahrerbund Cyklistforbundet bietet auf seiner Website sogar Tipps und Übungen, wie man auf zwei Rädern sicher durch den Winter kommt und ein „ørn“ (Adler) im Radfahren auf Glatteis wird. Wer im Dänischen sprichwörtlich ein Adler ist, gilt als Meister seines Fachs. Interessante Vorstellung, die windschnittig durch den Schnee radelnden Greifvögel! Todesmutig zuckeln die Kopenhagener dann auch durch Schneewehen und über vereiste Kreuzungen. Die meisten Ausländer schauen ihnen dabei aus den Fenstern der beheizten Stadtbusse kopfschüttelnd zu und wünschen einen guten Rutsch.
Während ich noch unsicher in gemäßigtem Tempo auf der rechten Spur des Radwegs schlich, überholten mich Herren in gut sitzenden schwarzen Anzügen und wehenden Schals, die Aktentaschen auf die Gepäckträger geklemmt. Über sechzig Prozent der dänischen Regierungsabgeordneten radeln ihrem Volk mit guten Beispiel voraus, indem sie täglich mit dem Drahtesel zur Arbeit nach Christiansborg kommen. – Überhaupt sind die Dänen sehr „hurtig“ unterwegs, sodass ich manchmal den Eindruck gewann, diesem Völkchen sei im Laufe der Evolution ein zusätzlicher Beinmuskel gewachsen. Sogar Hochschwangere und Rentner rasten erst einmal an mir vorbei.
Kein Wunder, dass die dänischen Hauptstadtradler schnell ungeduldig werden, wenn sie an roten Ampeln halten müssen. Seit einigen Jahren gibt es auf den großen „Bro“-Straßen – Nørrebrogade, Østerbrogade, Vesterbrogade, Amagerbrogade –, die von den Stadtvierteln ins Zentrum führen, für Radfahrer eine grüne Welle. Wer rund zwanzig Stundenkilometer schafft, kommt bei grünem Licht über die Kreuzungen und damit meist sogar schneller als die Stadtbusse in die Innenstadt. Niels drosselte seufzend das Tempo, als wir es mal wieder nicht mehr mit über eine Ampel schafften.
Wer wie wir an diesem Nachmittag in der „myldretid“, der Hauptverkehrszeit, durch Kopenhagen radeln will, muss sich darauf gefasst machen, mit Dutzenden anderen Fahrrädern im Konvoi zu fahren. Anfangs war mir das noch unheimlich, wie ein Tour-de-France-Profi mit so vielen Leuten fast Schulter an Schulter zu rollen, aber ich lernte die ungeschriebenen Regeln schnell: Wer in nächster Zeit anhalten will, hebe die Hand. Beim Überholen unbedingt vorher einen Blick über die Schulter werfen. Für Linksabbieger gibt es an großen Kreuzungen oft gesonderte Fahrspuren, auf gar keinen Fall darf man jedoch der direkten Fahrtlinie der Autos folgen, sondern muss erst einmal geradeaus über die Kreuzung fahren und sich dann auf dem gegenüberliegenden Radweg einordnen. Wer bei roter Ampel einfach rechts abbiegt und erwischt wird, den erwarten 1000 Kronen (rund 135 Euro) Bußgeld – eine Bekannte hat dies bereits ausprobiert und sich auf Facebook, dem aktuellen Lieblingsnetzwerk der Dänen, lautstark über die Folgen beschwert.
Nicht nur langsam nebeneinander fahrende Touristen können den so optimierten Verkehrsfluss auf den Kopenhagener Radwegen ins Stocken bringen, stellte ich fest, als der ganze Konvoi Feierabend-Fahrer vor mir ins Stocken geriet. Eine rote Ampel war nicht in Sicht. Stattdessen überholten die Leute vor mir mühsam einer nach dem anderen eine breite, rollende Holzkiste, die von einer Frau auf einem Fahrradsattel gelenkt wurde. In der Kiste hockten drei Kinder, deren Skaterhelme das Aussehen von Melonen nachahmten, und stritten sich um einen Tablet-Computer, auf dem Ramasjang, der dänische Kinderkanal, lief. Als wir gerade am Märchenschloss-ähnlichen Rosenborg Slott vorbeirollten, in dem heute unter anderem die Kronjuwelen ausgestellt sind, befand ich mich direkt hinter diesem typisch dänischen Fahrzeug. Weil der Radweg in der Gothersgade nicht so breit wie der auf Nørrebro ist, blieb mir zum Überholen nur ein schmaler Streifen. Den Lenker fest umklammert, beeilte ich mich vorbeizufahren.
Die Christiania-Bikes und andere Lastenräder aller Couleur, die mehr als eine Spur des Radwegs einnehmen, sorgen auf dem Kopenhagener „Fahrradhighway“ immer wieder für Stau, weil sie schwer zu überholen sind. Beim Überholen sollte man grundsätzlich auf heraushängende Kinderarme und -beine und herumfliegende Spielsachen gefasst sein. Laut Zahlen der Kopenhagener Touristinformation Visit Copenhagen haben 25 Prozent der Familien mit zwei Kindern ein Lastenrad. Inzwischen wusste ich auch, dass so ein „Christianiacykel“ in meiner neuen Wahlheimat die Familienkutsche schlechthin ist und dass es mit Preisen zwischen 10 000 und 20 000 Kronen, je nach Ausstattung, auch entsprechend kostet. Die geniale Erfindung auf drei Rädern – zwei vorn, eins hinten – kommt direkt aus dem berühmten Auto-freien Hippie-Viertel Christiania, wo die ersten Gepäckräder in den 1970er-Jahren erfunden wurden. Inzwischen sind sie ein mit Designpreisen ausgezeichneter, aber immer noch populärer Klassiker, den es in verschiedensten Varianten („light“ oder mit Elektromotor) und Ausstattungsstufen (mit Kinderbank und Gurten, mit Regendach, rollstuhlgeeignet) gibt. Auch wenn der vor Jahrzehnten besetzte Stadtteil seit 2013 „normalisiert“ und den geltenden dänischen Gesetzen unterworfen wird, ist Christiania nach wie vor eine der größten Touristenattraktionen Kopenhagens.
An der Knippelsbro, einer der nur zwei Autobrücken über den Hafen, erwartete uns ein Stau der ganz anderen Art: Rotes Blinklicht signalisierte uns anzuhalten, als die Brücke für ein größeres Schiff aufklappte. Das geschieht inzwischen extrem selten – typisch, dass es ausgerechnet dann so weit war, als wir darüber fahren wollten. Auf der anderen Seite wartete der Stadtteil Christianshavn. Der Wind fegte mir eisig ins Gesicht, ich biss die Zähne zusammen, damit sie nicht zu klappern anfingen, und schaute nach rechts, wo in der Ferne dunkel der „schwarze Diamant“ am Wasser aufragte. So nennen die Kopenhagener das komplett mit schwarzem Granit verkleidete Gebäude, in dem die königliche Bibliothek untergebracht ist. Ich ließ den Blick weiter schweifen und sah, dass hinter uns mittlerweile eine lange Kette von Fahrrädern mit Blinklichtern wartete, in der Mitte standen tuckernd die Autos. Inzwischen mischten sich diejenigen, die von der Arbeit nach Hause fuhren, mit all denen, die sich bereits ins Nachtleben stürzten. Hinter mir hielten zwei Mädchen, die in schwarzen Miniröcken, grauen Netzstrümpfen und High Heels fröhlich schwatzend der Witterung trotzten. Endlich ging die Brücke auf, und die Karawane setzte sich wieder in Bewegung, geradeaus durch das gesamte Viertel Christianshavn und weiter nach Amager.
Der erste „cykelsti“, sprich: Radweg, eröffnete in Kopenhagen übrigens schon 1910. Inzwischen gibt es aber interessante Variationen, wie die grünen Radwege, die sich durch ruhige Parkanlagen quer durch die Stadt schlängeln, und die extra langen „Supercykelstier“, die Superradwege. Die sind für Pendler gedacht, die sich auch von fünfzehn Kilometern oder mehr in die Innenstadt nicht abschrecken lassen. Ausgestattet sind diese Wege, von denen zwei bereits realisiert und noch viele in Planung sind, im besten Fall mit Servicestationen und Luftpumpen, Stativen zum Füßeausruhen an den Ampeln und grüner Welle. Sollte es einmal schneien, wird auf den Superradwegen auch Schnee geräumt, und wer ein Schlagloch entdeckt, kann das der Stadtverwaltung per App „Giv et praj“ melden.
Jetzt nur noch links in das Vorstadt-Idyll abbiegen und das Rad unter dem großen Apfelbaum abstellen, dann konnte das Fest beginnen. Ich war gespannt, was mich dort erwartete!
Das frühere Einfamilienhaus mit gemütlichem Garten, in dem Niels bis vor kurzem gewohnt hatte, befand sich seit Jahren fest in der Hand einer fünfköpfigen Wohngemeinschaft – in Dänemark „kollektiv“ genannt –, ein seit Hippiezeiten immer noch populäres Konzept. In Kopenhagen existieren eine ganze Reihe solcher alter und neuer Kommunen, wo nicht immer nur Studenten oder Althippies, sondern teilweise auch Familien mit ihren Kindern zusammenwohnen.
In ihrem Inneren versprühte die kleine Villa den holzverkleideten, braunen Charme der 1970er. Die Wände in der Küche zierte eine Tapete, die roten Backstein imitierte. Die Vorbereitungen für ein gehöriges dänisches Weihnachtsessen mit allem Drum und Dran waren schon in vollem Gange, das traditionelle „flæskesteg“ – ein fettiger, gesalzener Schweinekamm – brutzelte im Ofen.
Sarah, die marokkanisch-dänische Wurzeln hat und auch fließend Deutsch spricht, begrüßte uns überschwänglich. An ihren Ohren baumelten türkisgrün glitzernde riesige Kreolen, die der rot blinkenden Weihnachtsmütze auf ihrem Kopf die Show stahlen. Die Hausherrin Tine drückte uns einen dampfenden Begrüßungspunsch in die Hand. Ihre jütländischen Eltern haben das Haus vor Jahren als Studienwohnung für sie und ihre Geschwister gekauft – in weiser Voraussicht schon zur Jahrtausendwende, als die Preise für Wohneigentum in Kopenhagen noch nicht in so schwindelerregende Höhen geklettert waren wie 2007. Als die Kopenhagener Immobilienblase mit der Weltwirtschaftskrise platzte, verloren die Hauptstadt-Immobilien gewaltig an Wert. Inzwischen steigen die Preise langsam wieder an.
Zum „julefrokost“ waren nur die fünf WG-Mitglieder, Niels als Ex-Mitbewohner mit mir als Anhängsel sowie ein paar Freunde des Hauses eingeladen, die Gästeliste war mit elf Leuten überschaubar. Auf der Fensterbank brannten Kerzen und ein skandinavisches Adventslicht, eine Kerze, die ein bisschen wie ein Thermometer aussieht und senkrecht die 24 Dezembertage bis Weihnachten anzeigt. Jeden Tag lässt man sie bis zur nächsten Markierung abbrennen, bis man schließlich am Weihnachtstag ganz unten angekommen ist. Im Radio lief wie zufällig „Last Christmas“, das laut Niels bei keinem dänischen „julefrokost“ fehlen darf.
Ich packte unsere Einkäufe aus und stellte sie auf die Anrichte. Typischerweise tragen alle Gäste mit verschiedenen Gerichten zu einem Weihnachtsessen im Freundeskreis bei, erklärte Niels. Ich holte ein Glas „karry sild“, Hering in Currysoße, und ein Glas „hvide sild“, weiße Heringe, die in Essig und Zucker eingelegt wurden, aus der Tasche. Dazu gab es eine Flasche Walnussschnaps, den Niels’ Opa selbst hergestellt hatte. Außerdem lagen noch mehrere Sixpacks Bier im Rucksack. Auf den dunkelblauen Dosen fielen weiße Schneeflocken auf eine Winterlandschaft. Ihr populäres „julebryg“ – Weihnachtsbier –, das etwas stärker und weihnachtlich gewürzter als normales Pilsner ist, feiert die dänische Brauerei Tuborg jedes Jahr an einem besonderen „J-Dag“. Tausende Dänen begehen den Tag mit dem ersten Weihnachtsbier jedes Jahr Anfang November, was man an den außerordentlichen Mengen Betrunkener in den Straßen erkennen kann. – Sehr bezeichnend für eine Nation, wenn sie die beiden wichtigsten christlichen Feste, Ostern und Weihnachten, mit einem besonders starken Bier und reichlich Schnaps begeht! Weil im Kühlschrank kein Platz mehr war, stellte Niels das Bier raus aufs Fensterbrett.
In der Küche wurde emsig gearbeitet, und jeder schien zu wissen, was zu tun war. Etwas abseits klammerte ich mich an meinen Weihnachtspunsch und beobachtete das Treiben wie ein Ethnologe ein Stammesfest australischer Ureinwohner. Wenn es um Weihnachten geht, verstehen viele Dänen keinen Spaß. Das geliebte Fest und all seine Vor- und Nachfeiern im Freundeskreis, mit Arbeitskollegen, Studienkameraden, Vereinsfreunden usw. feiert man nach festen Regeln – in immer gleichen Abläufen, von denen auch im Freundeskreis nur unmerklich abgewichen wird. Unglaublich, dass die Dänen solche Weihnachtsfeiern gleich mehrmals hintereinander zelebrieren und davon an Heiligabend noch immer nicht genug haben!
Inzwischen deckte Sarah den Tisch, auf dem Kerzen, Tannenzweige und Weihnachtsservietten nicht fehlen durften. Im Wohnzimmer nebenan stand ein geschmückter kleiner, weißer Kunststoffbaum und leuchtete im Dunkeln. Langsam schienen alle Vorbereitungen in der Küche getroffen zu sein, die meisten Gäste unterhielten sich lässig mit einem Bier in der Hand. Tine, die es gern formell und formvollendet mochte, klatschte in die Hände und begrüßte alle noch einmal offiziell zum alljährlichen Weihnachtsfest. Der Reihe nach präsentierte sie mit feierlicher Miene die einzelnen Speisen, die dicht an dicht auf dem Tisch standen.
„Die traditionellen Frikadellen haben Theis und seine Freundin Lone gemacht“, erklärte sie, „die vegetarischen Frikadellen kommen von Sidsel. Sidsel, was ist da genau drin?“
„Die bestehen aus Möhren, Kartoffeln, Bulgur, Mehl und Gewürzen – alles bio“, antwortete Sidsel. Weil sie Vegetarierin ist, durfte ausnahmsweise ein wenig vom traditionellen, fettigen Weihnachtsmenü abgewichen werden.