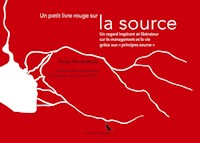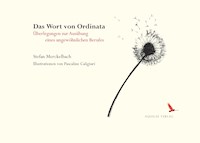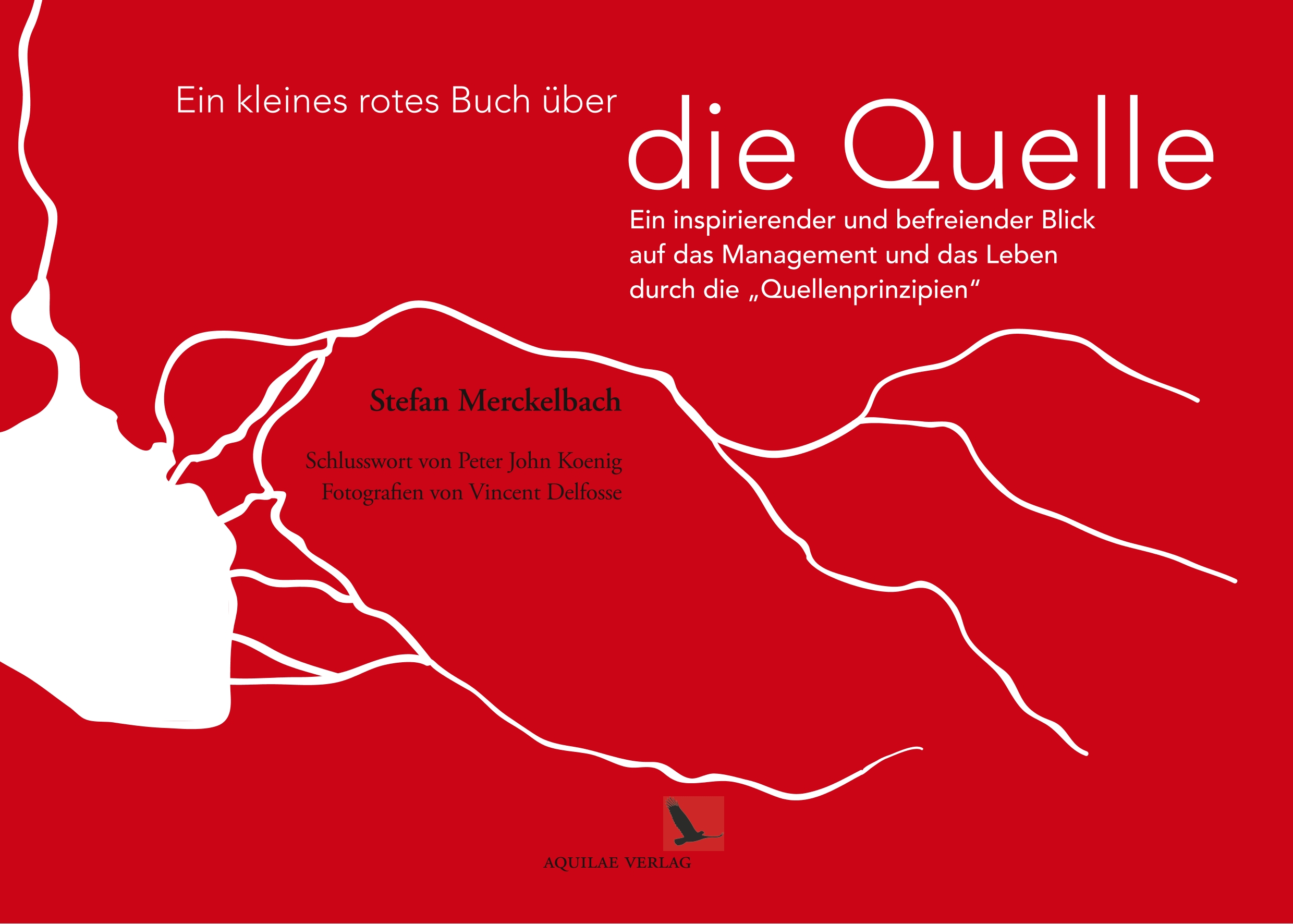
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die hier erstmals in Buchform präsentierten "Quellenprinzipien" bringen Energie, Klarheit und Kreativität in die Entwicklung all unserer Projekte. Die Quelle ist eine Person, die eine Idee hat, Initiativen ergreift und Risiken eingeht, um sie umzusetzen. Ihre Hauptaufgabe ist es zu klären, was der nächste Schritt zur Entwicklung ihres Projekts ist. Wenn sie Unterstützung braucht, lädt sie andere ein, sich zu beteiligen und eine "Quelle" für einen Teil des Projekts zu werden. Alle unsere Kollektive wurden auf diese Weise geboren. Jeder Mensch nimmt in seinem Leben mehrere "Quellenrollen" ein: Der Manager ist eingeladen, die "Quelle" seines Teams zu werden; der Mitarbeiter, die "Quelle" seiner Tätigkeit; die Sportlerin, die "Quelle" ihrer Form. Wo immer es ein Projekt gibt, gibt es eine "Quelle". Die "Quellenprinzipien" helfen uns, uns energisch in alle unsere Initiativen einzubringen und ermutigen die Menschen um uns herum, dasselbe zu tun. Sie laden uns ein, ein inspirierteres Management zu leben, unser kreatives Engagement zu fördern und unseren beruflichen und persönlichen Beziehungen eine neue Bedeutung zu geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Haben Sie „Quelle“ gesagt?
I.
Die Quelle aufnehmen
1. Die „Quelle“ betrifft uns alle
2. Die Arbeit einer Quellenperson
3. Sich als Quelle erkennen und sie leben
II.
Die Quelle teilen
4. Globale und spezifische Quellen
5. Die Quelle entwickelt das Kollektiv
6. Die Quelle im Anderen erkennen
III.
Die Quelle übertragen
7. Weitergeben, wenn die Zeit gekommen ist
8. Wie kann man konkret die Quelle übergeben?
9. Verbreitung der Quellenprinzipien
Nachwort
Prinzipien der Liebe
Schlusswort von Peter John Koenig
Zeiten ändern sich
Vincent Delfosse
Fotos und Quellenwörter
Auch diese Übersetzung ist ein Quellenabenteuer
Ressourcen
Erste Erwähnungen der Quellenprinzipien
Notizen zu den Kapiteln dieses
Kleinen Roten Buches über die Quelle
Ausbildungen zu den Quellenprinzipien bei Ordinata
Index
Sach- und Namenregister
„Die Kraft des Wassers kommt aus der Quelle.“Persisches Sprichwort
„Der Dichter kann nicht erschaffen, bis Gott in ihm ist....“ Grabinschrift von Norbert Moret, Komponist
„Es kommt nicht darauf an, was Führungskräfte tun, noch wie sie es tun, sondern auf ihren inneren Zustand, den inneren Raum, aus dem sie operieren, die Quelle ihres Handelns.“ Otto Scharmer, Theorie U
Einleitung
Haben Sie „Quelle“ gesagt?
ALS ich am 25. September 2013 eine Fortbildung zum Thema „Die Quellenperson“ besuchte, konnte ich mir nicht vorstellen, wie sehr diese Erfahrung mein Berufsleben verändern würde! Der Ausbilder, Peter John Koenig, hatte sich entschieden, die Fortbildung trotz der geringen Teilnehmerzahl durchzuführen, zur Freude der drei Teilnehmer, die dann seine volle Aufmerksamkeit erhielten. Peter Koenig ist Coach und Berater mit britischen Wurzeln und Wohnsitz in Zürich in der Schweiz. Er war damals bereits im Rentenalter; aber ich habe bald verstanden, dass ihn seine Absicht, die „Quellenprinzipien“ zu verbreiten, daran hinderten, sich zurückzuziehen! Angesichts dessen, was ich an diesem Tag entdeckte, meldete ich mich sofort für die Masterclass an, die er im folgenden Jahr organisierte. Seitdem hat der Begriff „Quelle“ schnell seinen Platz gefunden in den Beratungen und Ausbildungen, die wir bei Ordinata, dem von mir 2001 gegründeten Unternehmen, anbieten. Unser Team von Partnern und Partnerinnen ist sehr motiviert, die „Quellenprinzipien“ zu verbreiten, und ich kann heute sagen, dass kein Tag vergeht, an dem diese Prinzipien nicht auf die eine oder andere Weise bei uns auftauchen. Daher können wir uns nicht mehr vorstellen, einen Kunden zu begleiten, ohne im Laufe des Prozesses gemeinsam die Frage nach der „Quelle“ untersucht zu haben. So geht unser Lernprozess über die „Quellenprinzipien“ Tag für Tag weiter: Jede neue „Quellensituation“, der wir begegnen, trägt etwas zu unserem besseren Verständnis dieses grundlegenden Themas bei und bestätigt seine Gültigkeit. Das kleine rote Buch, das Sie in Ihren Händen halten, ist die Frucht dieser Erfahrungen.
Peter Koenig sagt, dass die „Quellenprinzipien“ so alt sind wie die Welt, dass er sie nicht selbst erfunden, sondern entdeckt hat, indem er die Realität beobachtet und sich mit vielen Menschen darüber ausgetauscht hat. Peter Koenig ist jedoch eindeutig die „Quelle“, die dieses Prinzip in Worte fasste, denn er war es, der das Vokabular, das Sie auf diesen Seiten entdecken werden, zuerst entwickelt hat. Seine persönliche Forschung zu diesem Thema begann in den 1980er Jahren, im Jahr 2000 fing er an, öffentlich darüber zu sprechen, und 2009 hielt er seine ersten Vorträge über die „Quellenprinzipien“, zuerst in Quebec, dann in Brüssel und Berlin. Peter Koenigs Idee war es zunächst, einfach mit anderen darüber zu sprechen, wie sie ihre Projekte durchführten; er erkannte schnell, dass seine Gesprächspartner und -partnerinnen genau die gleichen Erfahrungen gemacht hatten wie er und dass die Konstanten, die sie entdeckten, „Prinzipien“ waren. Heute setzt er seine Forschung zu diesem Thema fort, unterstützt von einem Netzwerk internationaler Quellen-Praktikerinnen und -Praktiker (siehe www.workwithsource.com*), dem ich angehöre.
Bisher gibt es nur wenige Schriften über die „Quelle“; der Abschnitt „Ressourcen“ am Ende dieses Buches führt deren magere Liste auf. Die meisten Entwicklungen in diesem Buch basieren auf meinem regelmässigen Austausch mit Peter Koenig selbst sowie mit den Mitgliedern seiner Masterclass zwischen 2013 und 2018, in spannenden Ausbildungseinheiten und Reflexionstagen. Nicht zu vergessen sind unsere persönlichen Begegnungen und der schriftliche Austausch. Ich stütze mich aber auch auf die wichtigen Beiträge meiner Partner und Partnerinnen bei Ordinata, die die „Quelle“ zu einem zentralen Thema ihrer Arbeit gemacht haben, und auf Martine Marenne, mit der ich seit vielen Jahren die Methodik der „Partizipationsdynamik“ entwickelt habe. In Interviews von Peter Koenig konnte ich „zur Quelle der Quelle“ gehen. Ich danke ihm von ganzem Herzen für seine Verfügbarkeit und sein unerschütterliches Wohlwollen, aber auch für das Korrekturlesen und die Verbesserung dieses Buches.
Nachdem Sie etwas über die Entstehung des Begriffs der „Quelle“ gelernt haben, sind Sie wahrscheinlich gespannt, seine Bedeutung zu entdecken! Ich schlage Ihnen vor, dass Sie auf den folgenden Seiten das Thema der „Quelle“ in drei Abschnitten, die dem natürlichen Prozess ihrer Entdeckung und Aneignung entsprechen, untersuchen. Dieses kleine rote Buch ist also in drei Teile gegliedert: Zuerst (I) werden wir versuchen zu verstehen, worum es geht, damit wir die „Quelle“ willkommen heissen können, dann (II) werden wir uns darüber Gedanken machen, wie wir sie mit anderen Menschen teilen können und schliesslich (III), wie wir sie zum gegebenen Zeitpunkt weitergeben können. Aber lassen Sie uns mit dem Vorspiel aufhören, legen wir nun los!
Das Sternchen (*) bezieht sich auf einen Eintrag im Abschnitt Ressourcen am Ende des Buches (ab S. →).
Eine letzte Kleinigkeit: Warum ist dieses kleine Buch rot? Ich sage es Ihnen im Nachwort.
Erster Teil
DIE QUELLE AUFNEHMEN
Kapitel 1
Die „Quelle“ betrifft uns alle
EINE „Quellenperson“ ist jemand, der „an der Quelle“ von etwas ist: Es ist eine Person, die eine Initiative ergriffen hat. Das passiert uns allen, nicht wahr? In meinem Leben habe ich in der Tat viele Initiativen ergriffen: zum Beispiel dieses und jenes Studium begonnen, mich um jene Stelle beworben und mein Unternehmen gegründet, ein Projekt gestartet und mich der Initiative einer anderen Person angeschlossen. Aber ich habe auch die Initiative zu einer Beziehung, einer Freundschaft, der Vermietung oder des Kaufs eines Hauses, der Wahl des Reiseziels unserer nächsten Ferien und zur der Ankunft eines Kindes ergreifen können… In jeder Situation, in der ich eine Initiative ergreife, setze ich etwas in Bewegung, das vorher nicht in Bewegung war. Auf diese Weise werde ich zur „Quelle“ oder „Quellenperson“ dieser Initiative.
Bevor ich anfing, meine Initiative zu konkretisieren, gab es eine Idee, eine Intuition, eine Inspiration, der ich zugehört habe und die ich mir zu eigen machte. Als „Quellenperson“ bin ich zwar die Person, die die Initiative zu ihrer Umsetzung ergriffen hat, aber ich selbst bin nicht der Ursprung dieser Initiative: Die Idee kam zu mir, die Intuition wurde mir gegeben, plötzlich war die Inspiration da. Die Idee ist ein Geschenk. Andere werden wahrscheinlich sagen, dass es meine Idee, meine Intuition, meine Inspiration war, und sie haben Recht, denn ich habe sie mir angeeignet, ich habe sie zu meiner eigenen gemacht, sie hat in mir Gestalt angenommen, und ich war es auch, der sie ausgedrückt und weiter kommuniziert hat. Und gleichzeitig liegen sie falsch, denn diese Intuition war nicht „meine“, ich habe sie empfangen. Die „Quellenperson“ nimmt, indem sie sich dessen bewusst wird, eine demütige Haltung gegenüber der Idee ein, wobei sie sich selbst als ihre Verwalterin und nicht als Eigentümerin erkennt; darauf werden wir später zurückkommen, weil es wichtig ist.
Darüber hinaus ist es nicht notwendig, die Idee der Initiative selbst gehabt zu haben, um „Quelle“ oder „Quellenperson“ zu sein, sie kann auch von jemand anderem kommen. Es gibt sehr kreative Menschen, die, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, fast jeden Moment eine neue Idee haben; das macht sie nicht automatisch zu „Quellen“, es sei denn, sie ergreifen die Initiative, ihre Idee umzusetzen. Wenn sie diese nicht selbst umsetzen, können sie jemand anderen inspirieren, der die Idee aufgreift (dies ist eine andere Art, sie zu empfangen) und sich daransetzt, sie umzusetzen: Wir sagen, dass die letztere und nicht diejenige, die die Idee initiiert hat, die „Quellenperson“ ist.
Das Bild der Wasserquelle, die aus dem Schosse der Erde entspringt, spricht hier für sich: Wasser kommt nie spontan aus dem „Nichts“, sondern immer von irgendwo her. Dies vollständig anzuerkennen, ist bereits eine Weise, es zu respektieren: Ich werde zu einer „Quelle“ oder „Quellenperson“, indem ich an einer Idee festhalte, die ich selbst nicht „fabriziert“ habe (auch wenn sie tatsächlich aus mir herausgekommen ist), und indem ich die Initiative ergreife, sie zu verwirklichen, sie zu konkretisieren, sie in der Welt existent zu machen. Dabei darf ich mich oft auf andere Menschen verlassen, die mir helfen, sie umzusetzen. Kurz gesagt, die „Quelle“ bezeichnet die Person, die eine Initiative auf der Grundlage einer Idee ergreift, welche sie sich angeeignet hat.
Dieser Prozess wird für die „Quellenperson“ stark erleichtert, weil die Idee (die selbst ein Geschenk ist) mit einem anderen Geschenk unter dem Arm kommt, nämlich der Energie, die benötigt wird, um die Initiative zu ergreifen. Es ist, als ob der Kommunikationskanal der Idee, den Peter Koenig unseren „Quellenkanal“ nennt, auch den Saft des Lebens trägt, den die „Quellenperson“ braucht, um die Idee in die Realität umzusetzen. Diese Energie entspringt dem Inneren des Menschen, entzündet seine Tugenden und multipliziert seine Handlungsfähigkeit, vorausgesetzt, er entscheidet sich durch einen Akt des freien Willens, sich die Idee anzueignen, die Energie aufzunehmen und sich in Bewegung zu setzen.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine „Quelle“ oder „Quellenperson“ zu sein: Entweder ergreife ich die Initiative von etwas Neuem (ich werde dann als „globale Quelle“ dieser Initiative bezeichnet), oder ich schliesse mich der Initiative eines anderen an (in diesem Fall werde ich zu einer „spezifischen Quelle“); darauf werden wir in Kapitel 4 im Detail zurückkommen. Was wir uns ab jetzt vor Augen halten müssen, ist, dass ich in beiden Fällen die „Quellenperson“ meiner Präsenz innerhalb der Initiative bin: Meine Teilnahme ist ein authentischer Ausdruck meiner Freiheit, Handlungsfähigkeit und Kreativität.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Andreas war auf der Suche nach einem neuen Job, also antwortete er auf eine Anzeige und befindet sich nun in einem Vorstellungsgespräch. Das Unternehmen war die „Quelle“ der Anzeige; Andreas ist die „Quelle“ seiner Bewerbung und seiner Anwesenheit beim Interview, niemand hat ihn dazu gezwungen. Der Personalvermittler des Unternehmens ist die „Quelle“ eines konkreten Anstellungs-Vorschlags, während Andreas die „Quelle“ seiner Antwort ist. Wenn er akzeptiert, hoffen wir, dass er schnell zur „Quelle“ seiner neuen Position werden kann, d.h. zu einer Person, die auf Intuitionen hört und Initiativen ergreift, um diese Position im Einklang mit der ihr anvertrauten Mission zu entwickeln.
Eine „Quellenperson“ für seine neue Position zu werden, bedeutet für Andreas schrittweise:
sich zu verpflichten, seine Handlungsbefugnis auszufüllen, indem er den Verantwortungsbereich und den Entscheidungsspielraum für seine Position in vollem Umfang in Übereinstimmung mit dem vom Unternehmen vorgegebenen Gesamtrahmen übernimmt;
seiner Freiheit und Kreativität basierend auf seinen Intuitionen auszuüben, um neue Wege zu finden, um die Mission der Position zu entwickeln, was wiederum zu neuen Initiativen führt;
seine „Quelle“ als starke Motivation, als eine Leidenschaft leben, bis er zur Überzeugung gelangt, dass er diese „Quelle“ an jemand anderes weitergeben und seine Leidenschaft selbst woanders einsetzen sollte.
In den folgenden Kapiteln werden wir unser Verständnis dafür vertiefen, was es bedeutet, eine „Quelle“ oder „Quellenperson“ der eigenen Arbeit, Rollen und Funktionen, Verantwortungsbereiche, Beziehungen, dessen, was man besitzt oder gebraucht, seiner Projekte.... zu sein, um unsere Rolle als „Quellenperson“ besser zu leben.
Aber bevor wir weitergehen, ein paar Klarstellungen des Vokabulars. Nach Peter Koenig unterscheiden wir zwischen „Quelle“, „Quellenperson“ und „Quellenprinzipien“.
Die „Quellenperson“, wir haben sie gerade definiert, ist die Person, die auf der Grundlage einer Idee eine Initiative ergreift.
Der Begriff „Quelle“ kann auf zwei verschiedene Arten verstanden werden:
auf der
Subjektseite
ist „Quelle“ gleichbedeutend mit „Quellenperson“, der Person, die die Initiative ergreift; das Wort „Quelle“ drückt insbesondere die Rolle aus, die diese Person in Bezug auf ihre Initiative spielt; in diesem Sinne verwendet Peter Koenig diesen Begriff;
auf der
Objektseite
kann sich „Quelle“ auch auf die Essenz dessen beziehen, wovon diese Person „Quellenperson“ ist, d.h. die Vision und die Werte, die das Herz ihrer Initiative bilden (unabhängig davon, ob es sich um eine Funktion, eine Beziehung, ein Haus oder ein Projekt handelt). Dies ist gewissermassen die „Quelle“ der „Quellenperson“; diese Vision und diese Werte werden von einer „Quellenperson“ auf eine andere bei der Weitergabe der Rolle der Quelle übertragen, ein wenig wie ein Stab bei einem Staffellauf. Für Peter Koenig bedeutet „seine Quelle aufnehmen“, mit dieser inneren Quelle in Kontakt zu treten, sich mit ihr zu verbinden und während der Umsetzung der Initiative mit ihr verbunden zu bleiben.
Schlussendlich bezeichnen die „Quellenprinzipien“ sowohl die Aktivität der „Quellenperson“ als Subjekt als auch die Umsetzung der „Quelle“ als Objekt. Im Laufe seiner Forschungen entdeckte Peter Koenig bestimmte Konstanten in der richtigen Ausübung der „Quelle“ und auch einige zu vermeidende Stolpersteine: Alle diese Beobachtungen und Feststellungen über das Funktionieren der „Quelle“ und der „Quellenperson“ sind in den „Quellenprinzipien“ zusammengefasst.
Jetzt, da das Vokabular ausreichend geklärt ist, können wir Quelle, Quellenperson und Quellenprinzipien ohne die Anführungszeichen verwenden!
Kapitel 2
Die Arbeit einer Quellenperson
VERSTEHEN, was die Wörter bedeuten, ist ein wesentlicher und unverzichtbarer erster Schritt; aber die eigentliche Herausforderung liegt in ihrer Umsetzung. Dies gilt umso mehr für die Quellenperson, als diese sich genau durch ihre Initiative definiert, die in hohem Masse ein Einleiten von Handlungen ist. Anstatt angesichts ihrer Idee regungslos zu bleiben, macht sich die Quellenperson auf, sie zu verwirklichen. Sie hat ein Werk zu vollbringen, ein „Ergon“, wie die alten Griechen sagen würden, d.h. eine Arbeit, eine Handlung, eine Aufgabe, ein Tun, ein Akt, die zu einem Werk führen — zumindest symbolisch — wie das eines Dichters oder Malers. Das Ergon der Quellenperson hat zwei Dimensionen: Es beinhaltet sowohl den Weg der Umsetzung (die Arbeit) als auch das Ergebnis (das realisierte Werk). Die Arbeit der Quellenperson ist jedoch nie eine reine Herstellung von etwas, das mechanisch gemäss einer Anleitung ausgeführt wird. Es ist vielmehr ein Tun, das es erfordert, einen Kurs festzulegen, diesen Kurs den Risiken, denen man ausgesetzt ist, anzupassen und die Umsetzung ständig dem gewählten Kurs anzugleichen. Infolgedessen ist das Handeln der Quellenperson sowohl sehr stark als auch zugleich zerbrechlich: Es ist zuerst eine gewaltige Kraft, die die Quellenperson nach vorne drängt, um ihre Initiative zu initiieren, umzusetzen und zu vollenden. Ihr Handeln kann jedoch auch sehr zerbrechlich sein, da sich Initiativen oft unvorhersehbar und unkontrollierbar entwickeln. Die Quellenperson muss sich diesen Entwicklungen ständig anpassen. Zusätzlich muss sie sich mit ihren persönlichen Schwächen bei der Ausübung der Rolle der Quellenperson auseinandersetzen, die das gute Erreichen ihres Werkes ebenfalls beeinträchtigen können. Die Erforschung der eigenen Handlungsstärke und die Bekämpfung der eigenen (handlungsbedingten und persönlichen) Schwächen ist ein Schlüsselerlebnis für jede Quellenperson, die ihre Initiative vorantreiben möchte.
Woraus besteht nun genau diese Arbeit, dieses Werk der Quellenperson? Im Wesentlichen erfüllt sie drei Hauptaufgaben, die den drei Hauptrollen der Quellenperson entsprechen:
Sie empfängt Intuitionen (Ideen, Visionen) und bringt sich in deren Umsetzung durch Initiativen und Eingehen von Risiken ein — das ist ihre Rolle als „Unternehmerin“;
Sie setzt ihre Initiative in einen zukünftigen Kontext, indem sie die nächsten Schritte zu deren Entwicklung klärt, und diese Klarheit jedes Mal an die anderen kommuniziert — das ist ihre Rolle als „Führerin“;
Sie achtet darauf, dass der Rahmen der Initiative, der sich in Werten und einer Vision ausdrückt, eingehalten wird — das ist ihre Rolle als „Hüterin“.
Betrachten wir diese drei Rollen und ihre entsprechenden Aufgaben etwas genauer.
1. Die Quellenperson als Unternehmerin. Wir haben diese Rolle im vorigen Kapitel bereits angesprochen: die Quellenperson ist definitionsgemäss jemand, die eine Initiative auf der Grundlage einer Idee ergreift. Peter Koenig stellt fest, dass die Quellenperson während des gesamten Bestehens ihrer Initiative laufend Ideen, Intuitionen, Inspirationen und auch die zu deren Umsetzung nötige Energie empfängt. Fügen wir nun noch die Dimension der Risikobereitschaft hinzu. Diese geht unvermeidlich mit der Initiative einher, die immer mehr oder weniger ein „Sprung ins Leere“ ist. Im Inneren jeder Quelle schlummert ein „kühner Verrückter“, der an seine Initiative mit einem Glauben glaubt, der manchmal sogar ein wenig überzogen scheint, und der sich auch mit einer gewissen Naivität schmückt. Es ist, als ob er den Ausdruck „Wir wussten nicht, dass es unmöglich war, deshalb haben wir es getan“ beweisen wollte! Die Risikobereitschaft ist so sehr Teil seiner Rolle als Unternehmer, dass eine Person, die kein Risiko (mehr) eingeht, aufhört, eine Ressource für ihre Initiative zu sein und so zu einem Hindernis und einer Bremse wird.
Was das Risiko betrifft, so ist meine langjährige Erfahrung mit Ordinata, wo ich seit der Gründung im Jahr 2001 die Quellenperson bin, für mich eine bedeutende Lehre: a posteriori stelle ich fest, dass Initiativen während der Entwicklungsphasen des Unternehmens systematisch von zuweilen erheblichen Risiken begleitet oder sogar ausgelöst wurden, während Initiativen während der Stagnationsphasen alle von fehlenden Risiken gekennzeichnet waren. Das Bewusstsein dafür half mir sehr, mich bei Bedarf wieder mit dem Risiko zu beschäftigen. Dieser Zusammenhang zwischen Initiative, Risiko und Entwicklung lässt mich sagen, dass das grösste Risiko für ein Unternehmen in Wirklichkeit ist, … keine Risiken mehr einzugehen! Das ist es, was seinen Niedergang beschleunigt, zwangsläufig, obgleich selbstverständlich auch viele andere Faktoren im Spiel sein können.
Natürlich wird das Risiko nicht für sich selbst gesucht, es hat keinen Wert an sich, aber es gibt der Initiative einen Wert, indem es ihr erlaubt das Unbekannte zu erforschen, wo die Quellenperson oder ihr Projekt noch nicht hingegangen ist. Eine Initiative bringt immer etwas Neues, wenigstens für denjenigen, der sie ergreift, wo und wann auch immer er sie ergreift. Das Risiko ist der Preis, den man für den Zugang zum Neuen zahlen muss. In diesem Sinne sollte es eher wie eine Investition betrachtet werden, da jeder Unternehmer weiss, dass man, wenn man etwas verdienen will, zuerst investieren muss. Das erklärt, warum Unternehmen mit viel Liquidität gesund erscheinen, sich aber in Wirklichkeit in einer Krise befinden: Sie lassen ihre Ressourcen schlafen, anstatt sie in die Zukunft des Unternehmens zu investieren.
Allerdings ist das Risiko, das die Quellenperson bei der Umsetzung ihrer Initiative eingeht, nicht nur finanzieller Natur, sondern kann noch viele weitere Formen annehmen: Ich kann zum Beispiel meinen Ruf riskieren, eine Beförderung, sogar meinen Job, die Fortsetzung einer