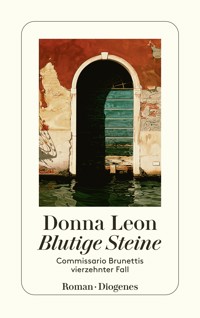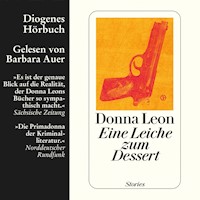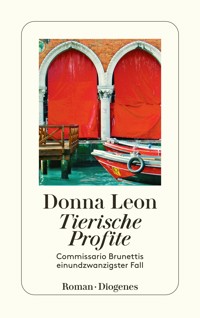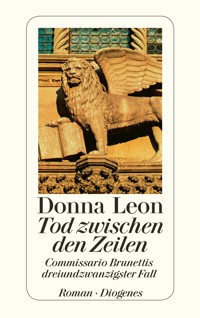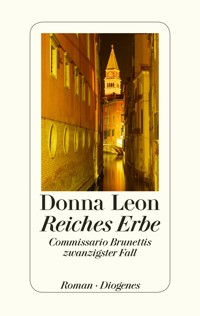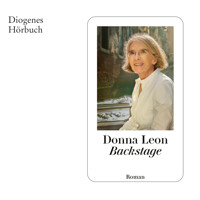11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Donna Leon hat viel erlebt, in Amerika, dem Iran, Saudi-Arabien, Italien natürlich oder in der Schweiz. Kaum aber passiert ihr ein Abenteuer, wird auch schon eine spannende Geschichte daraus. Sie erzählt uns von ihrer Jugend auf der Farm und von Sperrstunden-Pyjamapartys im Iran, Geldnot und einem Fiat 600. Davon, wie sie als »Anstandsdame« nach Italien kam, von der Jagd nach dem perfekten Cappuccino und kleinen Wundern in den Bergen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Donna Leon
Ein Leben in Geschichten
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz, Christa E. Seibicke u. a.
Diogenes
Vorwort
Wie die meisten Dinge in meinem Leben kam mir die Idee für dieses Buch eher zufällig. Vor ein paar Jahren saß ich bei einem Dinner in Venedig neben einem Kollegen aus meiner Zeit im Iran; wir plauderten über Freunde, die wir dort kennengelernt hatten, Freunde, mit denen wir immer noch in Kontakt standen, schwelgten in Erinnerungen – und plötzlich sah ich das alles mit neuen Augen. Damals war es für mich einfach nur alltäglich gewesen. Doch sowie in unserem Gespräch das Stichwort ›armenischer Zirkus‹ fiel, hockten wir beide auch schon auf dem Boden und begannen zur sichtlichen Bestürzung der anderen Gäste mit unseren mittlerweile viel älteren Knien wie die Kaninchen durch den Raum zu hüpfen.
Die anderen dachten, wir hätten den Verstand verloren. Für uns hingegen war dies der Höhepunkt des ›armenischen Zirkus‹, eines Spiels, das wir uns während der Ausgangssperre erdacht hatten, die Ende der Siebziger in den letzten Monaten meiner Zeit im Iran über Isfahan verhängt worden war. Natürlich hatten wir damals Kostüme, aber die waren, als wir den Iran wegen der zunehmenden Ausschreitungen verlassen mussten, irgendwie abhandengekommen. Wirklich ein Jammer, wenn man bedenkt, wie wir sie aus unzähligen Seidenbahnen und Federn zusammengebastelt hatten, um uns damit zu verkleiden. Untermalt wurde das Ganze vom Rattern der Maschinengewehre und einer gelegentlichen Bombenexplosion.
Unser Zirkus war aus den Pyjama-Partys hervorgegangen, welche wir während der Ausgangssperren veranstalteten, die bald die eine, bald die andere Seite während der Islamischen Revolution verhängte. Wer nach der Sperrstunde auf der Straße angetroffen wurde, riskierte, erschossen zu werden. Wenn wir nach der Arbeit auf einen Drink oder eine Tasse Tee bei Freunden vorbeigingen, überraschte uns immer wieder lautes Sirenengeheul, zwang uns zu übernachten, wo wir gerade waren, und erst nach 6 Uhr morgens, am Ende der Ausgangssperre, nach Hause zurückzukehren. Wie auf einer Zauberinsel gestrandete Kinder erdachten wir uns einen Zeitvertreib, und so entstand der »armenische Zirkus«, auch wenn ich nicht mehr weiß, woher der Name kam oder worin das Spiel sonst noch bestand.
All dies versuchten wir jenen am Tisch zu erklären, die Maschinengewehrknattern als Hintergrundmusik nicht kannten, und dabei fiel mir auf, dass ich in meinem Leben allerlei Ungewöhnliches erlebt und getan hatte.
Ich fackle von Natur aus nie lange und habe bei all meinem Tun nie mehr als den ersten Schritt bedacht. Mach den ersten Schritt – unterschreib den Vertrag, geh zum Vorstellungsgespräch, nimm den Job, miete die Wohnung –, und dann warte ab, was geschieht. Irgendetwas muss doch geschehen? Du weißt vielleicht nicht, wohin die Reise geht, aber irgendwohin muss sie doch gehen?
Nun werde ich achtzig, was mich selbst überrascht, denn mit achtzig sollte man doch allmählich angekommen sein. Doch leider hat die Vorstellung, mich endgültig an einem Ort niederzulassen und nur noch eine Sache zu tun oder – schlimmer – gar nichts mehr zu tun, keinen Reiz für mich. Das Orchester, mit dem ich arbeite, Il Pomo d’Oro, plant Aufzeichnungen von Händels Jephtha, Giulio Cesare, Berenice sowie Semele. Das dürfte mich für einige Zeit beschäftigen (und in den Himmel der Musik versetzen). Das Allerbeste aber, zumindest für mich, ist das weitere Zusammensein mit Brunetti, seiner Familie und seinen Freunden, und dass ich ihm Gelegenheit geben kann, noch mehr von sich und seiner Vergangenheit, von seinen Gedanken und Gefühlen zu erzählen.
Amerika
Nolls Farm
Mein Großvater mütterlicherseits, Joseph A. Noll, kam vor über hundert Jahren in Nürnberg zur Welt. Damit hat es sich auch schon. Nun ja, damit hat es sich für jeden, der mehr über ihn wissen will. Mein anderer Großvater, Alberto de León, stammt aus Lateinamerika, aus welchem Land, hat er offenbar nie erwähnt. Tatsächlich habe ich keinen meiner Großväter jemals über das Land sprechen hören, in dem sie geboren wurden. Als seien sie, der eine als Deutscher, der andere als Bürger jenes vergessen gegangenen Landes, dem Schiff entstiegen und als Amerikaner an Land gegangen.
Für beide war Englisch nicht die Muttersprache, nie aber habe ich sie ein Wort in einer anderen Sprache sagen hören, und nur mein Großvater väterlicherseits hatte einen Akzent. Mein deutscher Großvater war in Deutschland Bauer gewesen, und Bauer wurde er in Clifton, New Jersey. Er besaß vierzehn Hektar Land, und wann immer ich als Kind zu Besuch kam, war es das Paradies, ein Paradies voller Wunder.
Da gab es an die fünfzig Kühe, zwei Arbeitspferde – die Kaltblüter Duke und Squire –, das Reitpferd meines Cousins, mehrere Gänse (bösartig wie Schlangen), eine Hühnerschar, ein paar Schweine und zwei Enten, die – so wurde mir erzählt – auf ihrem Zug nach Süden zwischengelandet waren, sich umgeschaut hatten und zu bleiben beschlossen.
Acht irische Arbeiter versorgten und melkten die Kühe. Mit der Zeit kam ich dahinter, dass sie Durchreisende waren. Sie lebten auf der Farm, keine Stunde von New York City entfernt, schufteten von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Am Letzten eines jeden Monats bekamen sie ihren Lohn, und noch am selben Abend machten sie sich aus dem Staub. Zwei Tage später, egal, welcher Wochentag war, fuhr mein Großvater mit seinem Pritschenwagen nach New York City in die Bowery; in diesem für seine Bars, Absteigen und Bordelle bekannten Viertel suchte er eine bestimmte Straßenecke auf und sammelte seine Farmarbeiter ein, schwer angeschlagen, manche von Schlägereien gezeichnet, anderen fehlte ein Schuh, eine Jacke oder ein Zahn, samt und sonders ohne einen Cent in der Tasche, und die meisten sturzbetrunken.
Meinem Onkel Lawrence zufolge, der immer mit dabei war, begrüßten die Arbeiter meinen Großvater mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Erleichterung und kehrten auf die Farm zurück. Zurück zur Arbeit. Für einen Monat.
Mein Bruder und ich waren oft auf der Farm, kannten die Arbeiter und wurden von ihnen verwöhnt. Viele von ihnen hatten Frau und Kinder in Irland, einige jüngere Brüder und Schwestern. Wie ich später erfuhr, stellte mein Großvater sie nur ein, wenn er ein Viertel ihres Lohns einbehalten durfte, das an ihre Familien floss.
Als ich sieben war, zogen wir in ein kleines Haus auf dem Farmgelände und wohnten dort ein oder zwei Jahre. Dort wurde ich wohl mit dem Geruch des Dunghaufens so vertraut, dass ich ihn noch heute als aromatisch, nicht als unangenehm empfinde. Ich sah auch seine magische Wirkung: Im Herbst wurde der Dung auf dem kahlen Acker ausgebracht, und im Sommer darauf wuchs das Korn.
Ja, ich bekam den ganzen Jahreszyklus mit: Im Frühling Mais und Weizen säen, im Sommer Unkraut jäten, im Herbst den Weizen mähen und den Mais ernten.
Im Herbst wurden auch die Truthähne für Thanksgiving geschlachtet, und einen Monat später wurde für Weihnachten geschlachtet. Mein Großvater verkaufte die Truthähne und dazu Hühner, Milch, Butter, Sahne und – kurz nachdem ich zehn geworden war – Eiscreme, denn mit seinem Mut für Neues hatte er einen Eiscremestand eröffnet. Was hätte man mit der Milch von fünfzig Kühen Besseres anfangen können?
Ebenfalls im Herbst kam der Horror des Schweineschlachtens. Hühner hatten für eine Siebenjährige wenigstens ein bisschen etwas Lustiges, wenn sie kopflos in der Gegend herumliefen. Heute klingt das grotesk, aber mein Bruder und ich fanden es komisch, vielleicht weil es so jenseitig war.
Mit dem Schwein war es etwas anderes. Jedes Jahr wurde es auf einen Namen getauft, wir fütterten es mit den Küchenabfällen und freundeten uns mit ihm an, kraulten es hinter den Ohren und lachten uns krumm, wenn es sich an Sommertagen im Schlamm wälzte. Was dann geschah, war schockierend, und nach dem ersten Mal sah keiner von uns mehr dabei zu. Ich erinnere mich an das Blut. Und dass ich Großvater für ein Ungeheuer hielt, mindestens eine Woche lang.
Der Ärmste wurde für noch eine weitere Woche zum Ungeheuer, als wir erfuhren, dass die Kälber ins Schlachthaus gebracht wurden und nicht, wovon wir ausgegangen waren, zu einer anderen Farm, wo sie heranwachsen würden. Und doch: Das Schicksal der Truthähne, Hühner, Schweine und Kälber hatte keine Auswirkung darauf, was mein Bruder und ich gern aßen. In unserer Familie gab es nur eine Vegetarierin, meine Tante Jean, und sie war nicht nur Vegetarierin, sondern stand auch politisch weiter links als der Rest der Familie, wahrscheinlich links von allen in ganz New Jersey. Mein Großvater nannte sie ›die Agitatorin‹, nichtsdestoweniger war sie diejenige, mit der er sich am liebsten unterhielt und deren Meinung er am meisten schätzte.
Ich erinnere mich auch an Sal, den Hufschmied, der alle zwei, drei Monate vorbeikam, um die Pferde neu zu beschlagen. Er fuhr einen altersschwachen Pick-up, auf dessen Ladefläche er, weiß der Himmel wie, eine Esse installiert hatte. Sobald er eintraf, entfachte er mit Holz ein Feuer, in das er nach und nach Kohle legte. Während es kleiner und heißer wurde, führten die Farmarbeiter alle Pferde heran, die neue Hufe brauchten, sowohl Pferde meines Großvaters als auch Pferde aus der Nachbarschaft, die in seinem Stall untergebracht waren.
Mein Bruder und ich mussten immer mindestens eine Pferdebeinlänge entfernt von dem Wagen stehen, falls eins mit seinen neuen Hufen nicht einverstanden war und austrat. Was selten geschah: Sal schien mit ihnen eine geradezu magische Einheit zu bilden, es war wie ein Ballett zwischen Mensch und Tier. Sal lenkte ihre Beine und Füße, als seien sie Teile seines eigenen Körpers, klemmte sie zwischen seine mit Leder beschürzten Knie und hämmerte, stemmte, kratzte, schnitt, grub und feilte, bis der Huf frei von Schmutz und Nägeln war, absolut flach und das Horn an allen Seiten glattgeschliffen.
In meiner Erinnerung nimmt Sal das neue Hufeisen mit einer Zange aus dem Feuer, hämmert es eben und stößt es zum Abkühlen in ein Wasserfass – in neuerer Zeit habe ich, wann immer ich einem Hufschmied zusah, kein Feuer mehr gesehen und auch das Zischsch nicht mehr gehört, wenn das rotglühende Eisen auf das kalte Wasser traf.
Vor ein paar Jahren entdeckten Archäologen im Norden Britanniens zwei Paar ›Hipposandalen‹, metallische Platten, die irgendwie an den Füßen eines Pferdes befestigt wurden, ohne alle Nägel. Auf dem Foto sahen sie für mich eher aus wie Kerzenhalter, aber die Archäologen werden es schon wissen. Dank meiner lebhaften Erinnerung an Sal und die Pferde stelle ich mir gerne vor, die Tiere und die Menschen damals im Römischen Reich hätten eine ebenso magische Einheit gebildet.
Irgendwann musste mein Großvater die Farm aufgeben und verkaufte sie – verflucht sei der Tag – an einen Bauunternehmer, der das steinerne Farmhaus und die Scheunen abreißen und stattdessen moderne, nicht sonderlich interessante Häuser errichten ließ. Mitten auf dem Feld vor dem Haus hatte schon Jahrhunderte bevor mein Großvater das Haus baute eine gewaltige Rotbuche gestanden. Für meinen Bruder und mich und unsere neunundzwanzig Cousinen und Cousins war der Baum ein Versteck, ein Klettergerüst, ein Ort, wo man sitzen und nachdenken konnte, und ein Treffpunkt. Er überlebte den Bau der neuen Häuser und stand dort unangetastet bis mindestens in die 1970er-Jahre, als ich auf dem Weg nach New York das letzte Mal vorbeikam. Seitdem bin ich nie mehr zurück, weil ich nicht möchte, dass er nicht mehr da ist.
Meine Familie
Am Anfang von Anna Karenina heißt es, alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich. Da der Satz von Tolstoi stammt und er vermutlich einschlägige Erfahrungen hatte, will ich ihn gelten lassen, auch wenn ich finde, dass Familien, egal, ob glücklich oder unglücklich, sich vor allem durch ihre Macken unterscheiden. In der Kindheit sehen wir die eigene Sippe noch als Maßstab an, was ganz natürlich ist, schließlich wachsen wir darin auf, übernehmen ihre Redeweise, ihre gesellschaftlichen und finanzpolitischen Ansichten, ihre Art, mit Stress umzugehen, mit Alkohol oder dem Gesetz. Da liegt es nahe, ihr Verhalten normal zu finden, so verschroben es in Wahrheit auch sein mag.
In anderen Familien nehmen wir dagegen durchaus Absonderlichkeiten wahr: Ich habe in dieser Hinsicht als Kind weiß Gott einiges erlebt. Aber wohl aus Mangel an Erfahrung kommen uns auch die Macken anderer Leute erst zum Bewusstsein, wenn wir älter werden. Anfangs sind wir noch so damit beschäftigt, zu lernen und Eindrücke zu sammeln, dass kaum Zeit bleibt für Wertung und Zensur: Kinder sind zunächst einmal nichts weiter als unbefangene Beobachter.
Erst später beginnen wir zu richten oder zumindest eine kritische Haltung einzunehmen; oder vielleicht betrachten wir auch nur das vormals vermeintlich Normale aus objektiver Distanz und erkennen so unsere früheren Irrtümer.
In diesem Zusammenhang denke ich unwillkürlich an Dickens und all die bizarren Nebenfiguren, die seine Bücher bevölkern: an den alten Mann, der, um die Aufmerksamkeit seiner Frau zu erringen, mit Sofakissen nach ihr wirft; an Wemmick und seinen betagten Vater aus Große Erwartungen oder Uriah Heep aus David Copperfield. Als Kind, bei der ersten Lektüre, erscheinen uns diese Figuren fast so unwirklich wie Geschöpfe von einem anderen Stern. Erst der Erwachsene entdeckt beim Wiederlesen, wie viele Uriah Heeps die Welt bevölkern und in wie vielen Ehen unterschwellig aggressiv miteinander umgegangen wird. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn man aus der Erwachsenen- oder gar Altersperspektive auf die eigene Familie zurückschaut und einem aufgeht, dass manches von dem, was sich dort zutrug, wohl ganz schön abgedreht war.
Zu den skurrilen Figuren aus meiner Kindheit gehörten drei Tanten meiner Mutter, die gemeinsam ein Haus mit zwölf Zimmern bewohnten. Die verwitwete Tante Trace war mit einem Apotheker verheiratet gewesen (was den Spekulationen darüber, woran er gestorben war, Tür und Tor öffnete). Ihre beiden Schwestern hießen Tante Gert und Tante Mad und hatten nie geheiratet. Diese drei Frauen lebten in schönster Eintracht zusammen, und als ich alt genug war, um zu ihnen auf Besuch fahren zu dürfen, waren sie bereits im Ruhestand, falls sie überhaupt je gearbeitet hatten.
Zusammen mit ein paar Freundinnen spielten sie von morgens bis abends Karten, mit Vorliebe Bridge. Sonntags gingen sie zur Kirche, folglich wurde da nicht gespielt, es sei denn, die Kirche veranstaltete einen Bridgeabend. Und Gert schummelte. Meine Mutter steckte mir das genüsslich, denn Gert war eine eifrige Kirchgängerin. Mit den Jahren hatte sie sich eine Taktik des Zauderns und Schwankens zurechtgelegt, die ihrem Partner so deutlich signalisierte, was Sache war, als hätte sie ihr Blatt offen auf den Tisch gelegt. »Oh, ich denke, ich riskiere mal ein Herz.« – »Also ich weiß nicht, ob ich’s wagen kann, mit zwei Kreuz rauszukommen?« Da ich nie Bridge gespielt habe, kann ich diese Botschaften nicht entschlüsseln; uns genügte es zu wissen, dass die Tante schummelte. Mit einer Partie, die vier Stunden dauerte, ließ sich gerade mal ein Dollar gewinnen. Aber sie schummelte. Andererseits spendete sie Jahr für Jahr mehrere Tausend Dollar für wohltätige Zwecke und war unheimlich großzügig gegenüber jedem Mitglied ihrer weitverzweigten und in der Regel undankbaren Familie; trotzdem schummelte sie.
Gert hatte außerdem eine farbige Freundin, eine ziemliche Seltenheit im New Jersey der 1950er-Jahre, aber unsere Tante hatte es durchgesetzt, dass diese Frau in ihre Bridgerunde aufgenommen wurde. Da keine der anderen Damen sie als Partnerin wollte, spielte sie immer mit Gert zusammen, und weil sie schlecht spielte, verloren die beiden regelmäßig. Trotzdem hielt Gert an ihr als Partnerin fest. Und natürlich durfte sie auch bei keinem Weihnachtsessen fehlen.
Wenn ich an Gert denke, fallen mir lauter kleine Eigenheiten ein: Blumen legte sie nachts immer in den Kühlschrank, damit sie länger hielten; wenn ein Kind über ihren Rasen lief, griff sie prompt zum Telefon und beschwerte sich bei den Eltern; sie ging nie ohne Hut aus dem Haus. Als sie nach dem Tod von Mad und Trace allein zurückblieb, ließ sie sich nicht dazu bewegen, das große Haus zu verkaufen und sich eine kleinere Wohnung zu suchen. Zumindest nicht bis zu den Rassenkrawallen in Newark, bei deren Ausbruch Gert sich einredete, als Nächstes würden die aufgewiegelten Massen aus dem Schwarzenviertel sich zusammenrotten, raubend und plündernd die Hauptstraße stürmen und schließlich ihr Haus zerstören. Und obwohl sie in Wahrheit sichere fünfzehn Kilometer vom Ghetto entfernt lebte, verkaufte sie nun doch ihr stolzes Eigenheim und zog in eine mickrige kleine Sechszimmerwohnung. Kurz darauf starb sie und hinterließ einen Schrank voll Laken und Handtücher, die zu ihrer Aussteuer gehört hatten. Allesamt ungebraucht, genau wie die wunderschöne handbestickte Tischwäsche, von der ich heute noch sechs Servietten besitze.
Onkel Joe, der Klempner, war auch so ein Original aus unserer Familie. In seiner Jugend hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht, als Farmer zu werden, aber sein Vater bestand darauf, dass er ein Handwerk erlernte, also wurde Joe Klempner, und zwar ein guter, obwohl der Beruf ihm keinen Spaß machte. Als ich ihn einmal fragte, was man als Klempner denn so alles wissen müsse, antwortete er lapidar: »Dass Freitag Zahltag ist und Scheiße nicht bergauf fließt.«
Er war wohl um die vierzig, als er der Stadt den Rücken kehrte und hinauszog auf eine Farm im Norden New Jerseys, wo er, statt sich mit Abflussrohren und Ausgüssen abzugeben, den ganzen Tag auf seinem Traktor saß, säte und erntete und dabei glücklich war wie ein Kind. Vor seinem Haus errichtete er einen kleinen Holzstand zum Verkauf von Schnittblumen und Gemüse. Abends studierte er Samenkataloge und wohl auch den Kurs seiner Wertpapiere, denn er starb als Multimillionär.
Mein drei Jahre älterer Bruder und ich, wir haben beide die lebensbejahende Einstellung unserer Mutter geerbt, und auch der fast völlige Mangel an Ehrgeiz, der unser Leben bestimmt hat, stammt wohl von ihr. Mein Bruder verfügt zudem in hohem Maße über jenes Talent, das die Italiener als arte di arrangiarsi bezeichnen – die Kunst, sich zu helfen zu wissen, ein Problem zu umschiffen, immer wieder auf die Füße zu fallen.
Nichts belegt das besser als die Geschichte vom Erdaushub. Vor seiner Pensionierung verwaltete mein Bruder zuletzt eine Wohnanlage mit etwa hundert Einheiten. Er kümmerte sich um Mietverträge und -zahlungen und war verantwortlich für den Unterhalt der Gebäude. Irgendwann beschlossen die Eigentümer, die Anlage auf Gasheizung umzustellen, was bedeutete, dass die alte Ölheizung mitsamt dem Vorratstank unter einem der Parkplätze entfernt werden musste.
Das Abrissteam rückte an, montierte die alte Heizung ab, grub den Tank aus und schaffte ihn fort. Und dann standen auch schon die Inspektoren vom Umweltschutzverband vor der Tür und behaupteten, der Tank habe ein Leck gehabt, durch das Öl in den Boden gesickert sei; mithin sei das ringsum aufgehäufte Erdreich erstens verunreinigt und zweitens beschlagnahmt und könne nur gebührenpflichtig von einer eigens darauf spezialisierten Speditionsfirma abtransportiert werden.
Mein Bruder war schon länger in der Stadt ansässig und daher etwas besser über die Beziehungen zwischen den Inspektoren und jener Speditionsfirma informiert als vielleicht der Durchschnittsbürger; diese Kenntnisse verdankte er seinen Jagdfreunden, von denen einige einem Verband angehörten, der – hm, wie soll man das unverfänglich formulieren? –, also der in seinen Geschäftspraktiken nicht immer ganz gesetzestreu war. (Wir befinden uns in New Jersey, liebe Italiener, und es geht ums Baugewerbe, capito?) Und so hegte mein Bruder denn seine Zweifel, was den tatsächlichen Verunreinigungsgrad des Erdaushubs betraf.
Durch einen glücklichen Zufall hatte er gerade zwei Wochen Urlaub vor sich, und am Abend vor der Abreise rief er einen seiner Jagdfreunde an, der als Fuhrunternehmer zufällig diverse Bauprojekte mit Füllmaterial belieferte und zufällig auch dem bewussten Verband angehörte. Mein Bruder erzählte ihm, dass er für einige Zeit verreisen würde, und bedeutete dem Freund, dessen Namen er mir nie verraten hat, er könne sich während der nächsten vierzehn Tage gerne den Erdaushub rings um den Schacht seines ehemaligen Öltanks abholen. Er müsse lediglich dafür Sorge tragen, dass die Laster ohne Kennzeichen und nur bei Nacht führen.
Mein Bruder und seine Frau kehrten zwei Wochen später braun gebrannt und gut erholt aus ihren Ferien zurück. Als er aus dem Taxi stieg, das sie vom Flughafen nach Hause gebracht hatte, nahm er als gewissenhafter Verwalter als Erstes die Gebäude und den Grund in Augenschein, die seiner Obhut unterlagen.
Schockiert über den Anblick, der sich ihm bot, schlug er sich an die Stirn und rief: »O Gott, man hat mir meine Erde gestohlen!« Worauf er hineinging, die Polizei anrief und den Diebstahl anzeigte.
Solche Originale gab es auch in der Familie meines Vaters, wenngleich mein Eindruck sich da eher auf Erzählungen stützt als auf eigene Anschauung. Da war zum Beispiel sein Onkel Raoul, der zweisprachig, mit Spanisch und Englisch, aufgewachsen war, sich aber am Telefon stets nur in sehr holprigem Englisch meldete und sich, wenn er selbst verlangt wurde, für den Butler ausgab, der gern nachfragen wolle, »ob Miister Leon sein libero«. Raoul war es auch, der einmal vor seinem New Yorker Hotel ein Taxi bestieg und sich bis nach Boston fahren ließ.
Vaters Onkel Bill residierte in einem großzügigen Landhaus etwa fünfzig Meilen nördlich von New York und verschwand oft für mal kürzere, mal längere Aufenthalte in den diversen Bananenrepubliken Süd- und Mittelamerikas. Offiziell hieß es, er sei im Kaffeehandel tätig, aber warum dann all diese Geschichten über seine Treffen mit Staatsoberhäuptern, umzingelt von Leibwächtern mit Maschinengewehr im Anschlag?
Bills Frau, Tante Florence, war ein wandelnder Farbtopf und zugleich das schwarze Schaf in der Familie: Sie litt unter dem zweifachen Makel, nicht nur eine Geschiedene, sondern auch Jüdin zu sein. Außerdem hatten sie und Onkel Bill »in Sünde« zusammengelebt, wie man damals sagte, bevor ihre Verbindung legalisiert wurde, und auch das nur staatlicherseits: Die Kirche wollte nichts mit ihnen zu schaffen haben. Angesichts so vieler Hindernisse sahen wir alle großzügig darüber hinweg, dass Florence erschreckende Ähnlichkeit mit einem Pferd hatte, leider jedoch nicht über dessen Intelligenz verfügte.
Ihr Leitspruch, den sie bei jedem unserer Besuche zum Besten gab, lautete, als Frau müsse man sich dumm stellen, um einen Mann zu ködern. Mein Bruder und ich hatten nie den Eindruck, dass Florence sich verstellte.
Ach, und jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein: Da war ja auch noch Henry, ihr japanischer Koch. Henry war so eine Art Phantom: Angeblich hielt er sich in der Küche auf, aber keiner von uns hat ihn je zu Gesicht bekommen. Es ist Teil der Familiensaga, dass Henry testamentarisch verfügt habe, seine gesamten Ersparnisse sollten den Vereinigten Staaten zugutekommen. Da er weder ein Testament noch irgendwelche lebenden Angehörigen hinterließ, ging sein Wunsch wohl in Erfüllung.
Der Bruder meines Vaters – nach den Fotos, die wir noch von ihm haben, ein atemberaubend schöner Mann – war Offizier der Handelsmarine. Einem Gerücht zufolge soll er der Geliebte von Isadora Duncan gewesen sein. Wer das aufgebracht hat, ist allerdings weder meinem Bruder noch mir in Erinnerung geblieben, und als ich zum ersten Mal davon hörte, wusste ich bestimmt noch nicht, wer Isadora Duncan war.
Familiengeschichten, Familiengeheimnisse.