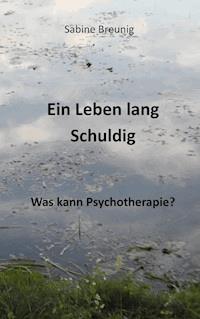
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ein wichtiges und mutiges Buch, das Grenzen sprengt, weil es Situationen in der Psychotherapie gibt, die das erfordern..." (Prof. Dr. med. Luise Reddemann) Frau S. hat mit 15 Jahren ihren Vater umgebracht, ihr wird "Schuldunfähigkeit" attestiert, sie kam in Erziehungsheimen nicht zurecht und verbrachte ihre Jugend im Gefängnis. Eine sogenannte Systemsprengerin. Mit aller Kraft wollte sie eine Familie, wollte sie "dazugehören". Sie hat geheiratet, zwei Kinder bekommen und alles wieder verloren. Schuld und Psychiatrie bestimmten fast ihr ganzes Leben. Mit fast 50 Jahren beginnt sie eine Psychotherapie. Was kann Psychotherapie? Die Beantwortung dieser Frage ist der zweite Strang dieses Buches. Die Therapeutin lässt sich auf diese Frage ebenso offen und vorbehaltlos ein wie auf die Beziehung zur Klientin. Unsicherheiten und offene Fragen werden benannt und ausgehalten. Anstelle therapeutischer Leitlinien, Heilsversprechungen oder Normen entsteht Raum für den Einzelnen. Die Herausforderung von Beziehung zwischen zwei Menschen in einem psychotherapeutischen Rahmen wird ausgeleuchtet. Die therapeutische Beziehung ist der dritte und wichtigste Strang dieses Buches. Wie Therapeutin und Klientin um Kontakt ringen um Würde und Selbstbestimmung, wie sie auf den Trümmern der Folgen der erlittenen Traumata, nach sexuellem Missbrauch und emotionaler Vernachlässigung, mit Ängsten vor erneuter Verletzung, den fehlenden Erfahrungen von Wert, Würde und Selbstbestimmung aber leider gut eingeübten Selbsthass etwas Gemeinsames aufbauen, dass wirklich beide Anwesenden berücksichtigt, das wird hautnah, berührend und spannend erzählt. Die Geschichte berührt und ermutigt sich selbst ehrlich zu fragen, was hindert mich, das zu tun, was ich wirklich will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke allen, die mir geholfen haben dieses Buch zu schreiben, meinem Mann, meinen Freundinnen, meinen Kolleginnen, meinem Supervisor und allen anderen, denen ich das Buch zu lesen gab und die mir Mut machten es zu veröffentlichen, weil sie diese Geschichte und mein Ansatz gepackt hat. Für meine therapeutische Ausbildung danke ich meinem Lehrtherapeuten aus tiefstem Herzen. Seine klare und kompromisslose Frage nach meiner Sichtweise hat mir meinen therapeutischen Weg eröffnet.
Das Vertrauensverhältnis in einer Psychotherapie ist ein hohes Gut. Ich bitte um Verständnis, dass die vorliegende Lebensgeschichte keine Dokumentation ist, sondern zum Schutze der Patientin einiges hinzu erfunden, anderes weggelassen und wieder anderes deutlich verändert wurde. Es geht nicht darum, ob alles genau so passiert ist, sondern darum, ob es genau so passiert sein könnte.
Eine Lebensgeschichte, ein Therapiebericht
und Gedanken über Psychotherapie
Inhalt
Vorwort
Frau S. - Meine Mutter
Therapie - Erstgespräch
Die Therapeutin - Psychotherapie
Frau S. Meine Familie
Die Therapie - Anfang
Die Therapeutin - Psychologiestudium
Frau S. - Die Männer
Die Therapie - Selbstbild
Die Therapeutin - Suche, Würde und Krokodile
Frau S. - Im Heim
Die Therapie - Die Fassade bröckelt
Die Therapeutin - Rund ums Studium
Frau S. - Die Tat
Die Therapie - Zweiter Anfang, Schuldgefühle wegen Tod der Katze
Die Therapeutin - Therapieausbildung
Frau S. - Heim für Schwererziehbare und Gefängnis
Die Therapie - Sich wehren können? Was habe ich verdient?
Die Therapeutin - Im Blick der Theorien
Frau S. - Der Vormund
Die Therapie - Differenzierung, Erwartung und Tatsache
Die Therapeutin - Kindheit
Frau S. - Leben in Freiheit, Sohn und Mann
Die Therapie - Erstes Hoch, Normalität im Krankenhaus
Die Therapeutin - Lehrtherapie
Frau S. - Meine Familie
Die Therapie - Erster Einbruch
Die Therapeutin - Zuwendung im Kontext
Frau S. - Im Frauenwohnheim
Die Therapie - Intensive Arbeit
Die Therapeutin - Sicherheit im Kontakt
Frau S. - Therapie im Frauenwohnheim
Die Therapie - Weihnachten und Runder Tisch
Die Therapeutin - Vertrauen
Frau S. - Selber leben mit Psychiatrie
Die Therapie - Ein längeres Hoch
Die Therapeutin - Interesse und Erkenntnis
Frau S. - Meine eigene Wohnung
Die Therapie - Geborgenheit, zwei Jahre nach Therapiebeginn
Die Therapeutin - Verdrängen und Kräfte
Frau S. - Übergangshaus und Therapiebeginn
Die Therapie - Das dritte und bis ins vierte Jahr
Die Therapeutin - Veränderung und neue Wege
Frau S. - Familie heute
Die Therapie - Idee zum Buch
Die Therapeutin - Veröffentlichen?
Frau S. - Zeitungsartikel
Die Therapie - Zwei weitere Jahre
Die Therapeutin - Zweifel
Frau S. - Eine Nachbarin
Die Therapie - Irritation
Die Therapeutin - Sexueller Missbrauch
Frau S. - Therapie - Heute
Die Therapie - Sechstes und siebtes Jahr
Die Therapeutin - Missbrauch und Klarheit
Frau S. - Was ist möglich?
Die Therapie - Abgrenzung Tanja
Die Therapeutin - Psychotherapie und Politik
Frau S. - Missbrauch, Selbstverletzung und veränderte Rollen
Die Therapie - Revolution, Neues und Verwirrung
Die Therapeutin - Integration
Frau S. - Lust zu leben
Die Therapie - Wie weiter?
Frau S. - Was ich sagen wollte
Vorwort
Dieses Buch zu schreiben ist nicht einfach. Ich möchte die Geschichte von Susanne S.1 erzählen. Aber es ist nicht meine Geschichte. Ich bin die Therapeutin von Frau S. und sie hat mir so viel von sich erzählt wie niemandem sonst. Ich weiß, wie schmerzhaft und entbehrungsreich ihre Kindheit war und ich weiß, dass auch heute noch viele andere Kinder Vergleichbares erleben.
Ich möchte diese Geschichte erzählen, weil man an ihr viel verstehen kann. Was Kinder immer wieder erleben, wie ihre Erfahrungen sie prägen, welche Folgen die Kinder tragen aber auch das Gemeinwesen, und was in einer Psychotherapie wichtig ist.
Nach dem Mord an ihrem Stiefvater hat Frau S. mehrere Jahre im Gefängnis gesessen und weiter fast Jahrzehnte in psychiatrischen Kliniken oder anderen Einrichtungen verbracht. All die Jahre hat sie sich beinahe täglich selbst verletzt. Heute lebt sie in einer eigenen Wohnung und hat ein Gespür für ihre Würde. Sie bekommt Unterstützung in Form von Gesprächen, Organisation der Finanzen und des Alltages, die sie sehr schätzt. Über Jahrzehnte hat diese Frau den Staat viel Geld gekostet. Dass sich dies verändert hat, ist ein Ergebnis mehrerer Voraussetzungen. Zuallererst ist Frau S. eine starke Persönlichkeit, die es geschafft hat, trotz all der Belastungen nicht durch Drogen ihre Persönlichkeit und ihre kognitiven Fähigkeiten zu ruinieren. Während der unzähligen Klinikaufenthalte hat sie auf eine gewisse, wenn auch verquere Weise eine Art Geborgenheit gesucht und gefunden. Sie hat immer wieder von „professionellen Helfern“ Interesse und Zuwendung erfahren. Viele Jahre sie auf „Rettung“ von außen gewartet und heute weiß sie, dass das nicht funktioniert.
Sich selber zu reflektieren, sich selber auszuhalten hatte Frau S. lange Jahre nicht gewollt und nicht gekonnt. Aufgrund der besonderen Bedingungen einer ambulanten Psychotherapie war es mir möglich, nicht in den Strudel von Frau S.’s Missbrauchserwartungen und Spaltungen zwischen Gut und Böse gerissen zu werden, sondern immer wieder frei zu bleiben und Raum für Erkenntnis zu haben. Die ständige, sehr genaue Arbeit an dem, was ihr gefehlt hat – Zuwendung, Wohlwollen, Respekt und Grenzen -, hat ihr ermöglicht, ihre Lebensgeschichte zu verstehen und Verständnis für sich selbst zu entwickeln. So konnte sie beginnen zu wachsen. Es ist nicht alles gut. Aber es hat sich etwas Entscheidendes verbessert.
Frau S. ist in einem Ausmaß psychisch verletzt worden, das die Vorstellungskraft von vielen übersteigt. Die Bearbeitung dieser Verletzungen setzt für die Betroffene unbedingte Freiwilligkeit und die Möglichkeit, jederzeit die eigenen Grenzen bestimmen zu können, voraus. Diese Geschichte anderen zu erzählen macht es jedoch nötig Details zu recherchieren und sich intensiv mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und zwar nicht aus therapeutischen Gründen, um der Klientin2 besser helfen zu können, sondern um fremden Menschen, dem Leser oder der Leserin ein anschauliches Bild zu vermitteln. Eine solche Arbeit stößt immer wieder die schweren verletzenden Erinnerungen an. Und Frau S. muss sie aushalten. Dies ist ein Dilemma, in dem sich dieses Buch bewegt. Dabei haben die Gesundheit von Frau S. und ihre Grenzen absoluten Vorrang.
Den Anstoß zu diesem Buch gab Frau S. selber. Nachdem sie durch die Psychotherapie erfahren hatte, wie wichtig das Gefühl einer persönlichen Bedeutung für ihr Erleben und die Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten ist, und ihr klar wurde, dass nicht ihre höchstpersönliche „angeborene Schlechtigkeit“ für lange Jahre gesellschaftlichen Scheiterns verantwortlich war, äußerte sie immer wieder das Bedürfnis, ihre Erfahrung anderen weiterzugeben, um so anderen Frauen zu helfen. Wir verabredeten, diese Idee zu verfolgen, wobei ihr Wohlergehen im Vordergrund stehen sollte.
Diese Therapie war von vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten begleitet, aber sie hat mich auch immer wieder sehr berührt. Sie ist für mich ein beeindruckendes Beispiel, wie sehr es sich lohnt, an den Menschen zu glauben und das Gegenüber als jemanden zu sehen, den man verstehen kann! Nie vollständig, aber immer wieder voll und ganz.
Ich wünsche mir und Ihnen, dass das Vorhaben gelingt, die Geschichte von Frau S. zu erzählen. Dass Frau S. es aushält und selber davon profitiert. Dass sie möglicherweise mit ihren Geschwistern ins Gespräch kommt. Ich weiß aber, dass die Konfrontation mit der alten Geschichte sie unglaublich verletzen und überfordern kann. Das soll nicht geschehen und hat Priorität.
***
Dieses Vorwort habe ich geschrieben, bevor ich und Frau S. begonnen haben, an diesem Buch zu arbeiten. Während des Schreibens fragte ich mich immer wieder, was denn mein Antrieb ist, dieses Buch zu schreiben.
So war diese Therapie, trotz aller Schwierigkeiten und obwohl einiges definitiv nicht einer klassischen ambulanten Psychotherapie entspricht - wie die sehr schwere Symptomatik, die vielen ausgefallenen Stunden und die teils wenig strukturierte, sondern mehr suchende und hinfühlende Arbeit während der Stunden –, für mich immer wieder auch ein Beispiel einer gelungenen Psychotherapie. Dieser Widerspruch hat mich beschäftigt und schien mir lohnenswert genauer betrachtet zu werden.
Und weiter zeigt sich in dieser Therapie etwas, was mich während meiner ganzen Ausbildung immer wieder beschäftigt hat. Laut Lehrbuch wäre diese Therapie nie zustande gekommen, zu viele Terminabsagen, zu viele Selbstverletzungen. Und doch, viele Aspekte, die in anderen Therapien ebenfalls eine Rolle spielen, waren bei dieser Therapie überaus deutlich: Meine eigene Unsicherheit, die Risiken, die Fragen: Was hilft? Was ist wichtig? Was schadet? Wie gehe ich vor? Die Konzentration auf den Kontakt, auf die Beziehung! Die Einzigartigkeit des therapeutischen Kontaktes. Ein Lehrbuch oder eine Methode tragen nie durchgehend. Aber so offensichtlich begrenzt ist es selten. Vielleicht haben mich gerade diese Umstände frei gemacht auszuprobieren und nicht so schnell aufzugeben.
Ich habe Psychologie studiert, eine Gestalttherapieausbildung und Weiterbildungen in Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch fundierter Therapie absolviert. Immer wieder hatte ich Zweifel am Lehrstoff oder den Lehrpersonen. Die Schwachstellen oder gar das Nichtzutreffen schienen mir so offensichtlich, dass ich nicht verstand, warum andere so wenig ein Problem damit zu haben schienen. Gerne hätte ich gewusst: Was haben diese Therapeuten eigentlich erlebt? Hat ihre Erfahrung ihre Theorie beeinflusst und können sie ihre Methode an sich selbst bestätigen? Ich argwöhnte, ob meine Kritik und mein Zweifel Ausdruck einer eigenen psychischen Problematik seien? Konnte ich nicht zustimmen, weil ich ein Problem mit Autoritäten hatte oder damit, etwas von anderen anzunehmen? Und falls ja, was folgt daraus? Doch zustimmen?
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, meine Kritik und meine Zweifel ernst zu nehmen, und genau diese Erfahrung hat mir viel eröffnet. Sie ist mir eine wichtige Grundlage in meiner Arbeit geworden und von ihr und meinem Weg möchte ich erzählen. Mein persönlicher Werdegang bot mir viel Material, um Frau S., und nicht nur sie, verstehen und unterstützen zu können.
Die Anerkennung der Psychotherapie als gesetzlich geregelter Krankenbehandlung, analog zu medizinischer Behandlung, legt nahe, dass ein Patient bei jedem Therapeuten einer bestimmten Richtung dieselbe Behandlung bekommt. Das ist natürlich nicht so. Psychotherapie ist eine sehr spezielle Begegnung zwischen zwei Menschen. Ein einzigartiger Klient trifft auf einen einzigartigen Psychotherapeuten. Und in dieser Begegnung liegt eine große Kraft. Was hilft Patienten und Therapeuten, sich hier zurechtzufinden? An meinem Beispiel können Sie Einblick in die Persönlichkeit einer Psychotherapeutin gewinnen. Möglicherweise haben Sie anschließend mehr Fragen als vorher und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
***
Da eine Therapie also aus einem Therapiesuchenden, einem Therapeuten und einem neu entstehenden, gemeinsamen Prozess besteht, ist auch dieses Buch durchgehend in drei Perspektiven geschrieben: 1. der mehr oder weniger chronologischen Geschichte von Frau S., ergänzt durch Sichtweisen Dritter; 2. dem Therapieprozess in Auszügen; und 3. meinen Reflexionen über Psychotherapie. Ausgehend von meinem eigenen psychotherapeutischen und persönlichen Werdegang versuche ich einige grundlegende Faktoren meiner Arbeitsweise zu benennen und weiter das Ringen um Unterstützung, Veränderung, Wahrheit, Gemeinsamkeit und Professionalität zu beschreiben, nicht zuletzt unter dem Aspekt „sexueller Kindesmissbrauch“.
Es ist möglich, die einzelnen Teile für sich und hintereinander zu lesen oder während des Lesens dem Wechsel zu den verschiedenen Blickpunkten zu folgen und sich quasi spiralförmig dem Prozess und dem Thema zu nähern. Teilweise ließen sich Doppelungen in den verschiedenen Teilen nicht vermeiden. Wenn Sie eine Sichtweise nicht interessiert, lassen Sie sie einfach weg. Vielleicht interessiert sie Sie ja später noch.
Frau S. - Meine Mutter
Ich bin immer meiner Mutter hinterher gelaufen. Wenn sie zum Friseur ging oder auch nur zur Telefonzelle, um die Polizei zu rufen, weil mein Vater sie wieder geschlagen hat. Auch wenn meine Mutter mich immer weggeschickt hat.
Ich glaube, ich habe meine Mutter am meisten geliebt, von uns allen. Sie müssen wissen, bei uns war es nicht so wie bei anderen. Meine Mutter hat ja fast nicht gesprochen. Bei uns wurde überhaupt nicht geredet. Sie hat auch nicht gekocht. Gar nichts gemacht hat sie. Nur auf dem Sofa gelegen.
Mein Vater war Fabrikarbeiter, im Schichtdienst. Er war oft nachts weg. Er hat ja irgendwie für uns gearbeitet. Aber lieb war er nur zur Barbara und zum Stefan. Wir waren ja alle von anderen Männern. Das war bei uns so. Da wurde gar nicht drüber geredet.
Das Schlimmste war für mich, als meine Mutter gestorben ist. Ich war neun Jahre alt. Mein Vater hatte sie in den Bauch getreten, obwohl sie im achten Monat schwanger war. Sie kam ins Krankenhaus und dann nie mehr wieder. Sie haben gesagt, dass sie an Thrombose gestorben sei, aber ich habe immer geglaubt, weil mein Vater sie getreten hatte, in den Bauch. Ich habe lange geglaubt, dass sie nicht gestorben ist, sondern zu einer anderen Familie gegangen ist. Und dass sie mich irgendwann holen kommt.
Ich durfte auch nicht zur Beerdigung. Weil ich so jung war und so ungehorsam. Nur Barbara und Monika. Mich wollten Sie nicht dabei haben. Manchmal denke ich heute noch, dass sie irgendwann kommt. Dann bin ich so traurig und habe große Sehnsucht.
Ich weiß nicht, warum ich meine Mutter so geliebt habe. Meine Mutter hat mich ja nie in Arm genommen oder so etwas. Sowas gab‘s bei uns nicht. Vielleicht, weil ich ihr ähnlich sah. Meine Schwester sah mehr meinem Vater ähnlich.
Wir waren sechs Kinder. Barbara, Monika, ich – ich sollte wohl ein Junge werden -, dann die Kleinen, Gudrun, Stefan und Ulrike. Bei uns wurde sich wenig um uns gekümmert. Die Barbara hat sich um alle gekümmert.
Therapie - Erstgespräch
Frau S. kommt an einem warmen Spätsommertag mit ihrer Betreuerin3 in meine Praxis. Zuvor hatte die Betreuerin angerufen und um einen Therapieplatz für Frau S. nachgefragt. Ihr war bewusst, dass dies nicht üblich ist, da der eigene Wunsch, eine Psychotherapie zu machen, eine große Kraft und Motivation darstellt, ohne die eine Therapie häufig nicht zustande kommt. Deswegen achten wir Therapeuten meist darauf, dass die Klienten selber anrufen. Die Betreuerin erklärte, dass Frau S. für die ersten Schritte Unterstützung bräuchte, dann aber sicher bald alleine in die Stunde kommen könnte.
Im Erstgespräch berichtet Frau S., dass sie „seit 25 Jahren Borderline4“ habe: „Die Schnitte werden immer länger und tiefer. Vor kurzem bin ich wieder in die Klinik gekommen, bin fixiert worden, weil ich autoaggressiv war.“ Sie sagt, sie sei seit fünfzehn Jahren immer wieder in psychiatrischen Kliniken gewesen: Berlin, Hamburg, Lüneburg, …
Frau S. hat dunkle, dichte, krause Locken, frisch gewaschen, kaum grau. Sie sitzt aufrecht im Stuhl, leicht zurückgelehnt. Ihr ist anzusehen, dass sie einiges erlebt hat, aber sie ist auch sehr präsent, wirkt klar und lebendig. So wirkt sie gleichzeitig jünger und älter als ihre 49 Jahre. Sie wird mir dadurch sympathisch. Ihre Kleidung fällt auf, Kleidung, die wenig Geld gekostet hat, aber ausgewählt ist. Sie schaut zwar häufig weg, blickt mich aber auch immer wieder an.
Auf die Frage, ob sie etwas darüber wisse, wieso es ihr so schlecht gehe, sprudelt es aus ihr heraus: Ihre Mutter sei an Thrombose gestorben, im achten Monat schwanger. Sie habe ihren Vater umgebracht. Auch weil er sie missbraucht habe. „Immer kam der Spruch: Ich geh mit der Susanne spazieren, und dann endete das im Wald.“ Auch der Onkel habe es gemacht. Dabei schaut sie mich nicht an, spricht teilweise in kurzen, unzusammenhängenden Sätzen, teilweise in einem harten, lockeren, lässigen Ton.
Ich bin elektrisiert. Stimmt das? Jemanden umgebracht? So viel Missbrauch auf einmal. Lange Jahre in Kliniken. So eine schwere Geschichte habe ich noch nie so nah erlebt. Ich frage nicht weiter, sondern frage erst nach ihrem Alltag, um zu sehen, wie stabil der ist.
Sie sagt, dass sie jetzt allein lebe, der ambulante Pflegedienst bringe drei Mal am Tag die Medikamente, weil sie damit Mist gebaut habe, alle auf einmal genommen. Es sei ihr ein paar Jahre gut gegangen, bis sie obdachlos geworden sei. Dann habe sie im Übergangshotel gelebt. Nach der Vergewaltigung – sie sagt nichts Genaues - sei es ihr sehr schlecht gegangen. Es habe sich alles nur um den Mann gedreht, der eine Psychose habe.
Psychotherapie habe sie noch nie gemacht, nur während der Kliniken viele Gespräche.
Sie spricht schnell, in kurzen Sätzen, mit wenig Emotion: „Mein Mann hat nicht verstanden, dass ich psychisch krank war. Depressiv war ich, ich konnte nicht arbeiten. Die ersten Jahre waren eine schöne Zeit. Aber als die Kinder in die Schule gekommen sind, war ich mit allem überfordert. Ich habe die Kinder mit einem Bügel geschlagen. Die Scheidung war sehr schlimm. Mein Ältester kam in eine Pflegefamilie. Seit fünfzehn Jahren habe ich nichts von ihm gehört.“
Sie schaut noch mehr zur Seite, hört kurz auf weiter zu sprechen. Und weiter geht es mit ihrer irgendwie harten und gleichzeitig unbeteiligten Stimme. Tanja mache Sorgen. Sie habe versucht, sich das Leben zu nehmen und kratze an sich herum.
„Sieben Jahre habe ich bekommen. Fast die ganze Zeit habe ich gesessen. Fünf Jahre und zwei Monate war ich drin. Ich war ja immer nur in der A- oder B- Zelle5.“
Sie redet so schnell. Ich kann nicht nachfragen, was A-oder B-Zelle bedeutet. Die Informationen sind wichtig, aber viel zu viel.
Zur ältesten Schwester habe sie Kontakt. Die sei verheiratet, habe ein Haus, einen Hund, drei Kinder. Ihr gehe es besser.
Oberflächlich berichtet sie eine Leidensgeschichte, sie klagt auch an, aber unter der Spitze des Eisberges befindet sich eine nicht zu ermessende Menge an schlechten Selbstzuschreibungen. Sie ist so schlecht, dass sie diese Tat getan hat, dass sie im Gefängnis gewesen ist, dass sie ihre Kinder nicht erziehen konnte und keine guten Menschen aus ihnen machen konnte.
Nach der Stunde bin ich erschlagen und gleichzeitig elektrisiert. Was stimmt? Kann ich das bei ihrer Betreuerin nachfragen? Eigentlich nicht, die Schweigepflicht in der Therapie ist ein hohes Gut. Was bedeutet das alles? Was hat sie davon selber verstanden, sind ihr die Zusammenhänge bewusst? Das klingt nach einem ziemlich zerdepperten Leben. Was ist hier an Psychotherapie möglich?
Die Therapeutin - Psychotherapie
Seit fast zwei Jahrzehnten arbeite ich als Psychotherapeutin, an meiner Tür ein Schild: „Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ und „Alle Kassen“. Begriffe, die nahelegen, eine Psychotherapie sei klar und übersichtlich, nachprüfbar und gut geregelt. Das ist natürlich nicht so. Schon bei Medizinern ist eine Behandlung nicht eine Behandlung. Bei Psychotherapeuten aber erst recht nicht.
Zwar kommen Patienten immer wieder mit klaren Vorstellungen und wissen bereits ihre Diagnosen: „Ich habe eine Angststörung und soll eine Verhaltenstherapie machen“, oder: „Ich bin Borderline und brauche eine Traumatherapie.“ Frei übersetzt heißt das dann aber eher: „Mach meine Störung weg, aber lass mich in Ruhe,“ oder „Ich hab zwar keine Ahnung, aber eine klare Vorstellung, und wenn die nicht erfüllt wird, werde ich nervös.“ Hier können wir beginnen daran zu arbeiten, uns gegenseitig zu verstehen. „Was bedeutet Angststörung? Was ist eine Verhaltenstherapie? Wissen Sie, wie es Ihnen geht? Wissen Sie, was Sie wollen, was Sie brauchen und was möglich ist?“
In den ersten Stunden versuche ich zu zeigen, wie ich arbeite und erkläre manches: Hier in Deutschland finden wir heute eine im Vergleich großzügige Finanzierung durch die Krankenkassen von ambulanten, teils auch längeren Psychotherapien, allerdings nur bei drei Verfahren: der Verhaltenstherapie, der Psychoanalyse und deren abgespeckter Variante, der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Ein Recht auf Therapie hat nur jemand, der krank ist nach einer internationalen Definitionsliste, zum Beispiel eine Depression, Angststörung, Zwänge, psychosomatische Probleme, Borderline oder eine Traumafolgestörung hat.
Die Begrenzung auf diese Verfahren kam zustande, nachdem sich im langen Ringen zwischen Therapeuten, Ärzten, Vertretern der Krankenkassen und Gesundheitspolitikern um eine erste gesetzliche Regelung der Psychotherapie6, die drei Verfahren behaupten konnten, die bei der Ärzteschaft bereits vorhanden waren und dem klassisch naturwissenschaftlichen Medizinverständnis entsprachen.
Dies war die von Freud im traditionsreichen Europa und vor dem Hintergrund erdrückender moralischer Normen des viktorianischen Zeitalters entwickelte Psychoanalyse, die ein reiches aber eingeengtes Innenleben erforschen und befreien wollte; ihre Weiterentwicklung zur praktikableren kürzeren tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie; sowie die nach Pawlows Beobachtungen zum sabbernden Hund vor allem von J.B. Watson als Gegenreaktion zur ausufernden Psychoanalyse aufgestellte Verhaltenstherapie, welche als rein naturwissenschaftliche Lehre nur beobachtbare, äußere Bedingungen für Verhaltensänderungen gelten lassen wollte. Psychologen hatten sich jedoch auch sehr für eine dritte Richtung, die Humanistischen Psychotherapien, interessiert.
Nach Flucht und Emigration vieler Psychoanalytiker aus dem faschistischen Deutschland nach Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, interessierten sich dort viele Therapeuten stärker für den Wert und die Würde des Menschen und für die Bedingungen, unter denen jemand sein eigenes Potential nutzen kann, um sein Leben aktiv zu gestalten. Die Humanistischen Therapien, die entstanden, wie zum Beispiel Gesprächspsychotherapie nach C. Rogers, Gestalttherapie und später die Systemische Psychotherapie, fanden keinen Eingang in das deutsche Gesundheitssystem.
Wir Psychologen mussten uns entscheiden, in welchem der drei Verfahren wir zugelassen werden wollten und entsprechende Nachweise in Theorie und Praxis vorweisen. Viele meiner Kollegen aus der Gestalttherapieausbildung wendeten sich der tiefenpsychologisch fundierten Therapie zu, andere der Verhaltenstherapie. Ich hatte nach Studium und Ausbildung in zwei verschiedenen Praxen in beiden Verfahren gearbeitet und entschied mich für eine Zulassung als Verhaltenstherapeutin, da ich dieses Verfahren zwar als begrenzter und weniger weitreichend, jedoch auch als weniger bestimmend und offener für eigene Ideen erlebt hatte. Fünfzehn Jahre später entschied ich mich, die Zulassung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie nachzuholen, da ich mich in einigen Punkten diesem Verfahren stärker verbunden fühle und für manche Patienten das etwas längere Behandlungskontingent gut gebrauchen kann.
Auch der Krankheitsbegriff hat seine Tücken. Ein Armbruch ist sichtbar und berührt mein Selbstverständnis kaum. Eher führt er zu einer Distanzierung und zu Passivität. Der Arzt soll ihn reparieren und ich halte ihn ruhig oder mache später Gymnastik. In einer Psychotherapie geht es aber im Gegenteil oft darum, aktiver zu werden und zwar gerade in Bereichen, die ich bis dahin ängstlich gemieden habe.
Eine Depression umfasst viel mehr Aspekte und ist schwerer zu fassen. Die Aussage „Ich habe eine Depression“ meint oft etwas ganz anderes als „Ich bin depressiv“ oder „Mir geht es sehr schlecht“ oder „Ich halte es bald nicht mehr aus“.
Patienten, die eine Depression „haben“, mögen sich zunächst gut in eine Praxis einfügen und bereitwillig Tipps annehmen, sich selber beobachten, etwas unternehmen oder Sport treiben. Aber häufig tritt man nach einer Weile auf der Stelle. In der Therapie bleiben sie einem fern, man erlebt keine Gemeinsamkeit. Die scheinbar fremde Depression bleibt fern. Wenn jemand hingegen etwas kaum aushält, kann ich fragen und vielleicht verstehen. Wenn ich wirklich verstehe und der andere sich durch mich selber besser versteht, dann entsteht etwas Besonderes im Therapiezimmer.
Frau S. - Meine Familie
Wir waren viel draußen. Eigentlich den ganzen Tag. Bei uns gab es ja nichts, wir hatten kein Spielzeug. Es war anders als bei anderen. Bei uns wurde nichts geredet. Gar nichts. Eigentlich war jeder für sich.
Wir waren alle von verschiedenen Vätern. Das war klar, auch ohne dass darüber gesprochen wurde. Barbara, die Älteste, und Stefan, der Zweitjüngste, waren die Kinder von unserem Vater, und von mir und Monika war der Mattner der Vater. Aber der Vater, also der mein Stiefvater war, hat ja für uns gesorgt. Es war so, aber es spielte auch keine Rolle. Monika und ich sahen anders aus als mein Vater und die Barbara, die waren blond. Ich wollte immer meiner Mutter ähnlich sehen. Gudrun und Ulrike waren von jeweils ganz anderen Männern.
Wir waren wohl viel zusammen, aber irgendwie war auch jeder für sich allein. Ich bin viel rumgelaufen, habe auch geklaut. Es gab ja nichts zu essen bei uns. Barbara und Monika haben sich mehr um die Kleinen gekümmert. Ich hatte nicht so viel Geduld.
Mit sieben bin ich in die Schule gekommen. Das war nicht gut. Vorher wollte ich immer hin, wie die Großen, aber ich war nicht gut in der Schule, musste schon das erste Schuljahr wiederholen. Ich bin oft weggelaufen. Hingegangen bin ich schon, aber immer weggelaufen und irgendwann nach Hause gekommen. Erst gab es Ärger, dass ich nicht in der Schule war, aber danach konnte ich da sein. Bei meiner Mutter sein.
Wenn ich Fotos sehe, … die Barbara und die Monika hatten die Haare immer so schön. So um den Kopf herum gelegt, wie es damals modern war. Ich sah ganz anders aus, hatte kurze Haare, gar nicht schön. Weil ich ein Junge werden sollte? Sie müssen mich gehasst haben.
Irgendwann hat die Frau von unserem Hauswart, im Vorderhaus, mal für uns gekocht. Sie war sehr nett, eine ältere Frau und ihr Mann. Sie hat dann öfter für uns gekocht. Manchmal habe ich zugeguckt. Sie hat ja auch später bei Gericht gesagt, dass sich keiner um uns gekümmert hat.
Großeltern hatte ich nicht. Von meinem Vater, die kenne ich gar nicht, und von meiner Mutter, die kamen vielleicht einmal im Jahr. Sie waren böse, haben nur geschimpft mit uns und der Mutter. Wir waren eigentlich froh, wenn sie wieder weg waren.
Es gab auch keinen Geburtstag oder Weihnachten. Ich kann mich nicht erinnern, mal etwas geschenkt bekommen zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in den Arm genommen worden zu sein. Nicht von der Mutter und vom Vater auch nicht. Aber bei Barbara war es auch nicht anders. Also der Vater hat sie auch nie in den Arm genommen, obwohl sie ja sein Kind war. Aber sie haben sich schon gut verstanden. Er hat mit ihr gesprochen.
Es war immer eine Totenstille bei uns. Keiner hat etwas gesagt. Vater und Mutter haben schon gestritten, ja, er hat sie ja auch geschlagen. Uns nicht. Keinen von uns. Aber es wurde nicht gesprochen.
Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern. Die Barbara hat mal erzählt, … die weiß dass noch alles. Wir hatten eine Puppenstube ohne Puppen, für alle zusammen. Und im Keller fangen sie doch die Mäuse mit so Fallen. Da habe ich (lacht etwas verlegen) mal die toten Mäuse geholt, um damit in der Puppenstube zu spielen.





























