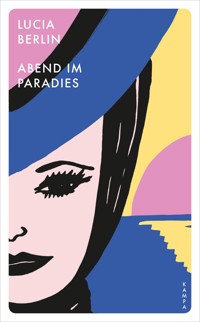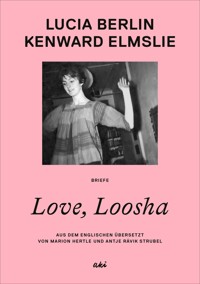18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucia Berlin zählt zu den außergewöhnlichsten Stimmen der modernen amerikanischen Literatur. Mit Ein neues Leben erscheinen ihre letzten, bisher unveröffentlichten Storys, die ihr Auge fürs Detail und ihre Fähigkeit, aus dem Alltag das Besondere herauszukristallisieren, eindrucksvoll zeigen. Die Titelgeschichte »Ein neues Leben« ist eine fein beobachtete Geschichte über Sehnsucht und den Traum von einem Neuanfang. »Die Grube« beleuchtet den Kampf mit Sucht und Selbstzerstörung, erzählt aber auch von Gemeinschaft und Hoffnung. Sämtliche ihrer Geschichten, egal ob sie das Alltägliche oder das Außergewöhnliche behandeln, spiegeln die bittersüße Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens wider. Unprätentiös tiefgründig. Seit Lucia Berlins Tod im Jahr 2004 sind die meisten ihrer Geschichten übersetzt und neu veröffentlicht worden. Ein neues Leben versammelt nun die zwölf verbleibenden Storys sowie zwei bisher ganz unveröffentlichte Erzählungen. Außerdem enthält der Band verschiedene essayistische Texte sowie einige Tagebucheinträge. Ein neues Leben ist ein unerwartetes Geschenk für alle, die in den vergangenen Jahren eifrig gelesen und sich weitere Geschichten von Lucia Berlin gewünscht haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lucia Berlin
Ein neues Leben
Storys, Essays, Tagebücher
Aus dem Englischen von Antje Rávik Strubel
AKI
Vorwort von Jeff Berlin
»Ich bin eine Frau mit Vergangenheit … mit vielen.«
Lucia Berlin
Der Titel dieses Buches Ein neues Leben ist einer Erzählung in diesem Band entnommen; eine witzige Geschichte über eine ältere Frau, die aus einer Laune heraus beschließt, aus ihrem Leben zu verschwinden, das sie öde und unerträglich findet. Die Geschichte beginnt mit einem Tschechow-Zitat: »Könnte ich doch für den Rest meiner Zeit mein Leben irgendwie ändern. Erwachen möchte man an einem klaren, stillen Morgen, spüren, dass ein neues Leben begonnen hat, dass alles Vergangene vergessen ist, verflogen wie Rauch.«[1] Als ich die Erzählung 1993 zum ersten Mal las, sagte ich zu Lucia: »Das ist deine erste völlig fiktive Geschichte.« Das hat sie sehr geärgert. Ich fand die Geschichte lustig. Traurig war nur, dass das neue Leben, das sie für ihre Hauptfigur erfunden hatte, so fantasielos war; sie nahm die U-Bahn in die Stadt, checkte in ein Hotel ein und saß zusammen mit anderen liebenswürdigen Verlierern in einer Bar herum. Als ich die Erzählung später erneut las, wurde mir klar, dass sie mein Kommentar so verärgert hatte, weil ihre Hauptfigur, die verzweifelte Frau, eindeutig sie selbst war, sie in ihrem gegenwärtigen Leben, die davon träumte, der Plackerei ihrer Alltagsroutine zu entkommen. Damals arbeitete sie als Arzthelferin für mehrere Chirurgen, plante Operationen und assistierte bei einfachen Eingriffen. Das war ihr jüngster Job in einer langen Reihe unbefriedigender Jobs im medizinischen Bereich im Laufe von zwanzig Jahren. Sie hatte lange Arbeitszeiten und wurde schlecht bezahlt, und sie wollte dringend etwas (irgendetwas) anderes machen.
Mal ein paar Tage nicht zu arbeiten und stattdessen mit zwielichtigen Leuten in einer Bar herumzusitzen, war genau das, was sie wollte. Mir war es gar nicht in den Sinn gekommen, dass es ihr schlecht gehen könnte. Sie war stabiler, als ich sie je erlebt hatte – war seit Jahren trocken und hatte eine regelmäßige Arbeit. Sie wohnte in einer schönen Wohnung, und ihr letztes Buch (So Long) war gerade bei Black Sparrow Press erschienen. Ihre größte Klage war damals, dass sie »nie wieder schreiben würde«. Sie hatte es satt, über die Verletzungen der Vergangenheit zu schreiben, und behauptete daher, es gäbe nichts mehr, worüber sie schreiben könne. Diese Probleme kannte ich schon, und ich wischte sie beiseite, weil ich wusste, dass sie es nie satthaben würde, über ihre Vergangenheit zu schreiben.
Kurz darauf, noch bevor sie die Geschichte wirklich beendet hatte, fragte ihr Freund Ed Dorn sie, ob sie Lust habe, an der University of Colorado kreatives Schreiben zu unterrichten. Im Grunde war das im »wirklichen Leben« der Traumjob, den sie sich wünschte – wenn auch nicht haargenau ein neues Leben, war es doch ein neues Kapitel. Ihr gesamtes Leben war voller solcher Neuanfänge – ihr Leben änderte sich drastisch, und sie musste ganz von vorn anfangen, nur dass diesmal wirklich ein Traum wahr wurde. Sie nahm den Lehrauftrag an, zog nach Colorado und unterrichtete sechs Jahre lang, ehe sie im Frühjahr 2000 in Rente ging. Das war die längste Zeit in ihrem Leben, die sie je am selben Ort wohnte und arbeitete.
Die meisten anderen Kapitel in ihrem Leben haben kein Happy End. Sie fing nie von vorne an, als wäre die Vergangenheit vollkommen vergessen, »verflogen wie Rauch«. Jeder Neuanfang war von Reue begleitet und von Was-wäre-wenns. Nach solchen großen Veränderungen im Leben war das Schreiben für sie eine Art und Weise, die Verletzungen, die sie erlebt hatte, zu verarbeiten. In mehreren Interviews sagte sie: »Im Schreiben finde ich zu mir selbst.«
»Das Schreiben ist eine Freude. Es ist ein Ort, an den ich gehen kann. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich … an dem ich mein wahres Ich spüre. Als ich zu schreiben anfing, war ich allein. Mein erster Ehemann hatte mich verlassen, ich hatte Heimweh, meine Eltern hatten mich enterbt, weil ich so jung geheiratet hatte und geschieden war. Ich schrieb einfach, um … um nach Hause zu gehen. Es war wie ein Ort, an dem ich mich sicher fühlte. Also schreibe ich, um mir eine Wirklichkeit zu schaffen.«
Aus einem Interview, 1996
Ihre erste Erzählung schrieb Lucia im Sommer 1957, als sie ihren ersten Kurs in kreativem Schreiben am College besuchte. Sie schrieb zwei Geschichten über ihren Alltag, in denen es um das leere, gefühlsarme Leben einer jungen Ehefrau geht, deren Mann abwesend ist. Ihr Mann war damals tatsächlich weg, besuchte ebenfalls eine Sommerschule, allerdings in einem anderen Bundesstaat. Als er auf Besuch zurückkam, teilte sie ihm mit, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, und kurz darauf verließ er sie. Er fehlte ihr nicht (sehr), und sie hatte nun ihre eigene Obsession – ihr Schreiben. Im Dezember 1957 reichte sie die Scheidung ein, kurz nach ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag.
Ihr schriftstellerisches Leben verbrachte sie damit, ihre eigene unglaubliche Lebensgeschichte glaubwürdig zu machen, erträglich und sogar lustig – indem sie ihre Erinnerungen zu nachvollziehbaren Selbstporträts umgestaltete und neu fasste. Wenn Leute sie fragten, ob eine bestimmte Geschichte wahr wäre, sagte sie oft: »Nun, ja … und nein.« Ihre Geschichten sind stilisierte Erinnerungen, Gedächtniscollagen – nicht streng autobiographisch – doch fast immer handeln sie von ihr.
Diese ersten beiden Geschichten wurden nicht publiziert, aber im Laufe ihres Lebens veröffentlichte sie achtundsiebzig Geschichten und acht Bücher. Es ist unmöglich, ihre vielen Adressen oder verschiedenen Jobs und Beschäftigungen exakt aufzulisten – ganz zu schweigen von ihren Haustieren oder Liebhabern, doch sie hatte noch drei weitere Kinder mit zwei weiteren Ehemännern. Sie war eine Frau mit Vergangenheit. Mit vielen. Und sie hatte mehr als die üblichen neun Leben.
»Ich habe beschlossen, mich für einen Phönix aus der Asche zu halten oder für einen Don Quijote … viel einfacher, als die volle Verantwortung für die riesigen Desaster zu übernehmen, in die ich gerate.«
Aus einem Brief an einen Freund, Januar 1972
Seit ihrem Tod 2004 wurden fünfundsechzig ihrer Erzählungen neu veröffentlicht. Dieser Band versammelt zwölf noch verbliebene Erzählungen sowie die beiden ersten unveröffentlichten Geschichten, die sie als Studentin geschrieben hatte. Hinzugefügt wurden außerdem der Rohentwurf einer weiteren Geschichte, verschiedene essayistische Texte und eine Auswahl von Tagebucheinträgen. Der Band enthält sämtliche noch verfügbaren (vorzeigbaren) schriftlichen Arbeiten von Lucia Berlin, die nicht in den Bänden Was ich sonst noch verpasst habe (2016), Was wirst du tun, wenn du gehst (2017), Abend im Paradies (2019) und Welcome Home (2019) veröffentlicht wurden.
Da ich (gemeinsam mit meinen Brüdern) einen Großteil des Lebens meiner Mutter miterlebt habe und bei einigen der schlimmsten (und der besten) Ereignisse dabei gewesen bin, befinde ich mich, denke ich, in einer einzigartigen Position, in der ich dazu beitragen kann, ein wenig Licht in ihre wahre Geschichte zu bringen. Während ich an diesem Erzählband arbeitete, die Geschichten kommentierte, sah ich mich mit einem von Lucias zentralen Schreibdilemmas konfrontiert: Wie kann man Erinnerungen wahrheitsgetreu, mitfühlend und objektiv beschreiben und gleichzeitig ihr Geheimnis bewahren?
Jeff Berlin, März 2023
Storys
1957 erhielt Lucias erster Ehemann, Paul Suttman, ein Stipendium, um im Herbstsemester Bildhauerei an der Cranbrook Academy in Michigan zu studieren. Sie beschlossen, dass er schon früher hinfahren und Lucia mit ihrem Sohn Mark (9 Monate alt) im Dezember folgen würde, wenn ihr Herbstsemester an der U.N.M. zu Ende war. Paul reiste im Frühsommer ab, und während seiner Abwesenheit belegte Lucia einen Kurs für kreatives Schreiben, für den diese Erzählung geschrieben wurde. Weder der Lehrer noch die Freunde, denen sie sie zeigte, hielten sie für besonders gut, aber sie mochte sie trotzdem, hatte sie gerne geschrieben und glaubte an sie. Sie hatte zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, ein traumatisches Erlebnis in eine schöne Erinnerung zu verwandeln. Kurz zuvor war Lucias Nachbar, ein alter Mann, mit dem sie befreundet gewesen war, in seinem Garten tot umgefallen. »Äpfel« ist die erste Kurzgeschichte von Lucia Berlin. (Geschrieben 1957, im Alter von zwanzig Jahren. Unveröffentlicht.)
Äpfel
Als sie mit dem Putzen des Hauses fertig war, brachte sie den Müll raus. Sie warf den Hausmüll in eine Tonne mit Deckel und die Tüte mit Papier in eine Metalltonne. Sie hielt ein Streichholz ans Papier, und als es Feuer fing, ging sie ins Haus.
Dann saß sie am Fenster und schaute durch den wässrigen Dunst über der Tonne in die Apfelbäume. Es gab nichts weiter zu tun, bis ihr Mann am Abend nach Hause kommen würde. Manchmal las sie oder bügelte oder ging über den Hof, um bei der Vermieterin vorbeizusehen.
Meistens schaute sie in die Bäume. Jeden Tag dachte sie an ihren Mann. Sie sprach mit ihm, während sie in die Bäume sah, und manchmal lachte sie mit ihm. Sie saß am Fenster und wartete und hörte das Geräusch der Äpfel, die aufs Dach fielen und zu Boden rollten.
Eines Morgens sah sie den Vater der Vermieterin auf der hinteren Veranda stehen, den vertrockneten Aprikosenkopf in die Sonne haltend. Er hieß Mr. Hanraty. Er war sehr alt, achtundneunzig – den ganzen Sommer war er krank gewesen. Sie wollte vom Fenster weggehen, aber dann sah sie seine Schuhe und lachte. Es waren knallrote Bowling-Schuhe.
Sie beobachtete ihn, wie er von der Veranda herunterging und wie ein kleines Kind auf jeder Stufe anhielt. Er stand am Fuß der Treppe, schwankte leicht, und es sah aus, als würde er singen. In seinen roten Schuhen ging er durchs Gras, geführt von einem Stock, der ebenfalls zitterte, wenn er ging, weil er noch grün war und Blätter hatte. Der alte Mann erreichte den Picknicktisch in der Mitte des Hofs. Er legte seinen Stock auf den Tisch und ruhte sich aus, sein Kopf nickte vor und zurück. Sie schaute ihm zu, und da hörte sie, dass er sang.
Er zog sich auf den Tisch hoch, sein Mund schnappte nach Luft, seine Beine lösten sich zuckend vom Boden. Er klammerte sich fest und wand sich, bis er endlich oben war. Er lächelte. Seine Beine baumelten, und er schwang die roten Schuhe vor und zurück wie ein Kind auf einem Stuhl. Er murmelte vor sich hin, klopfte mit dem Stock auf den Tisch und schwenkte ihn durch die Luft. Manchmal warf er den Kopf zurück und lachte laut auf.
Er kletterte wieder herunter. Sie hörte ihn singen, als er über den Hof zu einem Apfelbaum humpelte. Er blieb stehen, und während er sich mit seinem Stock um sich selbst drehte, schob er alle Äpfel, die er erreichen konnte, zu einem kleinen Haufen zusammen. Er baute noch drei weitere kleine Haufen, wobei er sich langsam um den Baum herumbewegte. Das tat er unter jedem Baum im Hof, bis es aussah wie auf einem Friedhof. Doch er war langsam, immer wieder rollten Äpfel vom Dach und fielen mit einem Plumps von den Bäumen. Er musste von vorn anfangen, beim ersten Baum. Viel später keuchte er die Stufen hoch ins Haus.
Jeden Morgen wartete sie auf Mr. Hanraty. Sie hoffte, er würde nicht auftauchen, wartete aber jeden Tag, bis er in seinen roten Schuhen über den Hof zitterte und nach den Äpfeln stocherte.
Als sie eines Morgens sehr früh Papier verbrannte, rief Mr. Hanraty von der Veranda. Er kam über den Hof. Er gackerte, schwenkte seinen Stock und trug ein paar Zeitungen. Er gab sie ihr, und sie deutete auf einen mit Blättern gefüllten Korb. Er zog sich auf den Tisch hoch, während sie das Paket zur Tonne schleppte. Sie warf das Papier ins Feuer, und als es in Flammen aufging, schüttete sie die Blätter hinein. Mr. Hanraty schrie, er heulte und Tränen rannen ihm aus den Augen. Er schaukelte auf dem Tisch vor und zurück, strampelte mit den Beinen.
Dann ging sie hinein und schaute ihm zu, wie er schrie und mit dem Stock schlug und lachte. Als das Feuer ausging, kletterte er herunter. Er ging über den Hof. Er war müde und beendete seine Arbeit nicht.
Kaum war ihr Mann am nächsten Morgen gegangen, sah sie Mr. Hanraty schon auf dem Tisch sitzen. Sie rannte in die Küche und suchte zusammen, was sie verbrennen konnte. Zweimal ging sie mit den Armen voller Papier zur Tonne hinaus, der alte Mann rührte sich nicht. Er schaute schweigend zu, mit offenem Mund, während sie das Papier in die Tonne stopfte. Sie hielt ein brennendes Streichholz an die Milchtüten und an das Zellophan. Zuletzt schüttete sie einen Becher altes Jolly-Time-Popcorn hinein, das an den Seiten der Tonne hinabrasselte.
»Hagel!«, kreischte er. »Sie hat Hagel ins Feuer geworfen!« Er lachte gellend, als sie ins Haus ging. Während sie das Haus putzte, konnte sie ihn wieder und wieder singen hören: »Hagel ins Feuer! Hagel ins Feuer, ins Feu-er!«
Es klopfte. Mr. Hanraty stand gebückt vor der Tür, er war blass und zitterte. Sie dachte, ihm sei etwas passiert, und versuchte, ihm ins Haus zu helfen. »Nein, nein«, wimmerte er. Er weinte, zog verzweifelt an ihrem Ärmel. Sie folgte ihm nach draußen. Als sie die Tonne erreichten, hielt er an und lehnte sich an sie, und sie fingen an zu lachen.
Das Popcorn war überall. Peng-peng-peng platzte es gegen die Tonne und wurde wie Blütenblätter hinaus in den Rauch gepustet. Es schwebte hinauf in die Bäume, trieb mit dem Wind in all die Apfelhaufen. Popcorn prallte ihnen ins Gesicht und landete sanft in ihren Haaren. Sie lachten und brüllten, lehnten aneinander, bis es auf einmal aufhörte.
Sie half dem alten Mann auf den Tisch. Sie setzte sich neben ihn, während er vor sich hin kicherte und den Kopf schüttelte. Sie hörten das stille Geräusch, mit dem die Äpfel zu Boden fielen.
Mr. Hanraty kletterte vom Tisch herunter und ging über den Hof zum ersten Baum. Sie stand ebenfalls auf und suchte einen Stock. Sie begann mit dem Baum auf der anderen Seite des Hofs. Lange Zeit arbeiteten sie schweigend. Dann lief sie durch ihre Äpfel in seine Ecke hinüber. Er lächelte sie an und seine Wangen waren rosig.
»Lassen Sie uns einen großen Haufen machen«, sagte sie.
Der alte Mann nickte. »Ja«, flüsterte er. Während sie arbeiteten, sang er vor sich hin: »Ja, Mensch, ja ja ja …«
Lucias zweite Kurzgeschichte, die sie 1957 für denselben Schreibkurs verfasste, beruht auf Tatsachen, die sich während Lucias Ehe mit Paul ereigneten. Lucia schrieb diese Geschichte in der Hoffnung, dass er sie lesen und verstehen würde, was sie von den Vögeln hielt, aber er hatte nie die Gelegenheit, sie zu lesen. Wie die Geschichte ursprünglich endete, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich hatte sie ein Happy End. Im wirklichen Leben, erzählte sie, ließ sie an jenem Tag, an dem er zur Uni fuhr (und nicht mehr zurückkehrte), als Erstes die Vögel frei. In ihren Memoiren Welcome Home schrieb sie Jahre später, sie habe die Vögel an eine alte Dame auf der anderen Straßenseite verschenkt. (Geschrieben 1957. Ebenfalls unveröffentlicht.)
Die Reisfinken
Er hängte die Vögel zwischen die tropischen Pflanzen im Wohnzimmer. Sie gefallen mir, sagte er. Das sagte er immer, wenn er etwas geschmackvoll fand. Sie sehen wirklich gut aus, sagte seine Frau, obwohl sie Vögel nicht wirklich mochte. Aber es waren hübsche Vögel, schwarz und grau mit rosa Muschelschnäbeln.
Und dann vergaß der Mann die Vögel, dabei hatte er ihren Käfig mühevoll selbst gebaut. Er hatte viel zu tun.
Und die Frau vergaß die Vögel auch. Nicht, dass sie keine Zeit gehabt hätte – sie hatte überhaupt nichts zu tun.
Es lag daran, dass die Vögel nicht zwitscherten. Sie machten überhaupt kein Geräusch, nicht einmal den leisesten Flügelschlag. Die Frau bemerkte sie nicht, und sie vergaß, sie zu füttern.
Eines Abends saßen sie und ihr Mann im Wohnzimmer. Die Vögel, rief sie und rannte los und füllte ihren Napf mit Körnern und gab ihnen eine Schüssel voll Wasser. Etwas später ging sie noch einmal zum Käfig. Die Vögel saßen einander gegenüber, und zuerst nahm sie an, sie hätten nichts von den Körnern gefressen, aber doch, es waren etwas weniger geworden. Sie haben sie kaum angerührt, sagte sie, haben sie so gut wie nicht angerührt, und sie setzte sich wieder neben ihren Mann. Diese verrückten Vögel fressen sowieso nicht gern.
Doch sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie sie vergessen hatte, und am nächsten Tag kaufte sie ihnen neue Körner – besondere Körner – Sesam und Koriander und Sonnenblumen und Anis. Sie öffnete die Tüte und roch daran. Oh ja, sagte sie zu sich selbst, die werden sie mögen.
Aber die Vögel ignorierten die Körner. Sie überprüfte mehrmals den Napf, doch sie hatten ihn gemieden. Sie streute weitere Körner auf den Boden des Käfigs. Guckt mal, ihr Trottel, Lakritze. Aber sie rührten sich nicht. Dann eben nicht, sagte sie und warf den Rest der Körner nach draußen.
An diesem Abend erzählte sie ihrem Mann von den Vögeln, und er sagte, sie hätte die Körner in den Laden zurückbringen sollen.
Sie fütterte die Vögel fast eine Woche lang nicht. Einmal wachte sie mitten in der Nacht auf und rüttelte ihren Mann. Was ist los, fragte er. Ich glaube, die Vögel sind tot. Verdammt, sagte ihr Mann und drehte sich um. Sie stand auf, und obwohl es kalt war, zog sie keinen Morgenmantel an. Sie ging ins Wohnzimmer. Nein, natürlich waren die Vögel nicht tot. Sie füllte ihren Napf mit Körnern und die Schale mit Wasser und stand eine Weile am Käfig. Doch sie fraßen nicht, solange sie in der Nähe war, also ging sie zurück ins Bett.
Als sie die Vögel das nächste Mal füttern wollte, waren keine Körner mehr da. Sie legte ein Stück Roggenbrot in den Napf. Als sie wenig später zurückkehrte, hockten die Vögel vor ihrem Napf und rissen geräuschlos am Brot. Oh, rief sie, was die Vögel erschreckte, also ging sie weg.
Sie setzte sich in einen Sessel und lächelte. Als ihr Mann nach Hause kam, erzählte sie ihm von den Vögeln. Sie haben das Brot gemocht, sagte sie, das war zu sehen, weil sie beide gleichzeitig fraßen. Ist das nicht schön, ich meine, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt reagiert haben. Ja, vermutlich, sagte ihr Mann und erklärte ihr, dass er zurück zur Arbeit müsse und keine Zeit zum Essen habe.
Sie erwachte, als er ins Zimmer kam, und fragte ihn, wie es gewesen sei. Gut, antwortete er, zog sich schnell aus und sank ins Bett. Ich bin müde, sagte er, gute Nacht, und er legte seinen Arm um die Schulter seiner Frau.
Nach einer Weile lachte sie leise und redete mit ihm. Weißt du, ich wollte einen Spiegel kaufen – es heißt, Vögel zwitschern, wenn sie einen Spiegel haben, aber mir ist gerade aufgefallen, dass es für Vögel, die nicht allein sind, keine Rolle spielt. Er schlief.
Für eine Weile vergaßen sie die Vögel.
Dann fiel eines Tages einer der Vögel von seiner Stange und kam nicht wieder hoch. Er lag auf dem Käfigboden und flatterte panisch umher, bis er endlich wieder oben war. Irgendetwas stimmte mit den Vogelfüßen nicht, mit seinen Krallen.
Die Vogelkrallen waren weit in die Füße hineingewachsen, hatten sich dann wieder nach vorn gedreht und formten ein schuppiges beigefarbenes S. Ihre Nägel sind einfach gewachsen, sagte er, das liegt daran, dass sie nicht laufen oder nach Futter scharren. Schneide sie, es sieht eklig aus.
Stimmt es, fragte sie, dass die Nägel noch wachsen, wenn die Menschen schon tot sind? Aber er hörte sie nicht. Sie fragte ihn, ob er ihr helfen würde, die Nägel zu schneiden. Nein, antwortete er.
Die Nägel wurden immer schlimmer. Sie verhakten und verdrehten sich ineinander, und die Vögel wirkten grotesk und unbeholfen und konnten sich bald kaum noch auf ihrer Stange bewegen, um an das Futter zu gelangen. Die Frau ging zu Mrs. Dawson, einer alten Dame, die auf der anderen Straßenseite wohnte. Mrs. Dawson hielt die Vögel fest, und die Frau schnitt ihnen die Nägel. Sie versuchte, sie nicht zu berühren, und als sie es doch tat, wurde ihr fast schlecht, denn die Beine der Vögel waren schuppig, trocken und kalt. Mrs. Dawson hatte Tränen in den Augen. Wie konntest du, meine Liebe, wie konntest du es mit den armen Dingern nur so weit kommen lassen? Die Frau schämte sich und sagte etwas wie, sie habe geglaubt, das sei natürlich, wie die Mauser.
Es war eine Erleichterung. Die Vögel waren glücklicher, dachte sie, obwohl sie sich immer noch nicht bewegten, außer, um zu fressen. Als die Tage wärmer wurden, sahen sie auch besser aus, die Augen hell und die Federn glatt und glänzend.
Sie versuchte, sich mit ihnen anzufreunden. Jeden Tag pfiff sie und schnalzte mit der Zunge und klopfte an den Käfig und schob ihren Finger hinein …
Die folgende Kurzgeschichte ist die sechste, die Lucia schrieb – die erste nach ihrem Umzug nach New York 1959. Sie bezieht sich lose auf die Eltern ihres ersten Mannes und erschien erstmals im Oktober 1961 in Saul Bellows Zeitschrift The Noble Savage.
Mama und Dad
Die Frauen unterhielten sich über ihre gipsverputzten Häuser und die Häuser, die sie hatten, bevor sie nach Enid gezogen waren.
Esther war die Einzige, die über ihren Mann redete. Dad nannte sie ihn, und er nannte sie Mama, obwohl sie keine Kinder hatten. Er war neunundsiebzig, konnte sich mittlerweile kaum noch selbst behelfen mit Asthma und Geschwüren. Bevor er so krank wurde, war er Autoverkäufer gewesen. Eine Schwarze Haushaltshilfe kam zweimal die Woche, und sie hatten einen Duncan Phyfe im Speisezimmer. »Dad war damals ein Bild von einem Mann«, sagte Esther oft, und die anderen Frauen waren peinlich berührt.
Sie war nicht wie die drei anderen mit ihren vergilbten Dauerwellen und Kalendern im Wohnzimmer. Sie trug Lippenstift und tönte ihr Haar, nähte im Winter helle Wollkleider, pastellfarbene Chambrays im Sommer. Sie machte das jedes Jahr wieder, malte und machte Schonbezüge und Caféhaus-Vorhänge. »Ich muss mich beschäftigen«, sagte sie. »Das lenkt mich von mir selbst ab.«
Evelyn und Vera, die verwitwet waren, verzogen jedes Mal das Gesicht, wenn sie das sagte. »Sie ist schon ziemlich eingebildet«, sagte Vera.
Nellie war die Einzige, die sie wirklich mochte. Nellie respektierte Arbeit, Einsatz. Sie und Owen hatten jeden Tag ihres Ehelebens an ihrer Tankstelle gearbeitet … »und als wir damit aufhörten, hätten wir genauso gut sterben können«.
Owen war tatsächlich gestorben, im Frühling, an einer Lungenentzündung. Vera und Evelyn gingen nach der Beerdigung zu Nellie, um zu sehen, ob sie irgendwie behilflich sein konnten. Nellie schaute fern, als wäre nichts gewesen. Während der Werbung beugte Vera sich zu Nellie.
»Vielleicht geht es dir besser, wenn du darüber redest, Nellie. Bei mir war es so.«
»Hat keinen Sinn, drüber zu reden. Wir wussten beide, dass es passieren würde.«
»Na ja, es ist ein Schock, egal wie es passiert«, sagte Evelyn. Sie und Vera standen auf. Vera seufzte. »Es ist schrecklich hart für dich … Ich weiß noch, als mein Edwin …«
Nellie zündete sich eine Zigarette an, die Flamme des Streichholzes beleuchtete ihre schweren Gesichtsknochen. »Es ist nicht hart. Es ändert nichts an dem, was vorher war, und ich nehme an, es wird nichts an dem ändern, was jetzt kommt.«
Esther traf ein, als die beiden Frauen gerade gingen. Sie nickten ihr nur zu.
»Ich habe einen Kanne voll Kaffee mitgebracht, Nellie. Dachte, du wirst sowieso kaum schlafen.«
Vera und Evelyn blieben auf dem Gehweg stehen, um sich zu verabschieden. »Also, ich habe noch nie gesehen, dass …«
»Aber Vera, du kennst doch Nellie, sie ist keine, die ihre Gefühle zeigt.«
»Sie könnte wenigstens ein bisschen Anstand zeigen, Respekt.« Stimmt. Sie wünschten sich eine gute Nacht.
Esther und Nellie schauten Ed Sullivan und die Chevy Show. Esther, die immer darauf achtete, dass sie nicht geschmacklos war, sagte nichts, und Nellie redete nicht mit ihr.
»Dad wird sich fragen, wo ich bin«, sagte Esther und stand auf.
Nellie blieb sitzen. »Willst du die Kanne wieder mitnehmen?«
»Keine Eile. Ich mache morgens nur Instantkaffee.«
»Ich glaube, ich nehme noch eine Tasse. Das war eine gute Idee, Esther.«
»Ach, ich weiß, du und dein Kaffee.« Auf dem Nachhauseweg weinte Esther, um Nellie.
Narzissen blühten. »Nun, das ist meine Schuld!«, sagte Dad. Er hatte vergessen, dass er die Zwiebeln gesteckt hatte. Er war sehr glücklich, wollte mehr Blumen pflanzen, Zinnien und Zuckererbsen und Astern. Er war mit ein paar Samen hinausgegangen, als er umfiel, vor Schmerz.
Esther fuhr mit ihm im Krankenwagen zum County Krankenhaus. Er hatte einen Herzinfarkt gehabt, und in seinem Bein war ein Blutgerinnsel. Der Arzt sagte zu Esther, sie solle sich keine Sorgen machen.
Als sie nach Hause kam, kamen Evelyn und Vera mit einem Hackbraten und einer Ladung Toll House Cookies vorbei. Nellie kam und machte Instantkaffee, um sie aufzuheitern.
»Ich weiß nicht, wie ich mich jemals bei euch erkenntlich zeigen kann«, sagte Esther.
Am nächsten Tag rief sie jede von ihnen an und lud sie für Samstag um zehn auf einen Kaffee ein. »Sie hätte auch einfach zur Tür raus rufen können«, kicherte Nellie. Aber die Frauen freuten sich.
Sie trafen gleichzeitig auf Esthers Veranda ein. Nellie klingelte.
»Hallo, Mädels! Kommt rein!«
Esther war in Gold gekleidet, dieselbe Farbe wie die Tischdecke. »Und schaut euch nur die Forsythie an!«
»Mensch, Esther, was für ein Anblick!«
Es gab Bananenbrot und einen gestürzten Ananaskuchen. »Ich liebe Gelb«, sagte Esther.
Die Frauen saßen im Wohnzimmer; schüchtern, verlegen, Tassen und kleine Servietten in den Händen. Wenn sie lächelten, legten sie sich die fleckigen Hände vor den Mund, um ihre falschen Zähne zu verbergen.
Esther bedeutete ihnen, sitzen zu bleiben, während sie das Geschirr in die Küche brachte. Sie setzte noch mal Kaffee auf, und sie schauten Dough Re Mi und December Bride. Dann waren sie alle sehr müde. An der Tür sagten sie Esther noch einmal, wie hübsch alles aussah und wie gut der Kuchen war.
Ein paar Wochen später veranstaltete Vera ein Kaffeetrinken und dann Evelyn und dann Nellie.
Es war Esthers Idee, dass sie jeden ersten Samstag im Monat zusammen Kaffee trinken sollten, dass sich jede von ihnen drei bestimmte Monate für ihr Kaffeekränzchen aussuchen sollte. Damit wir vorausplanen können. Esther suchte sich Oktober und April aus, wegen der Blumen, und Dezember wegen ihres kleinen silbernen Weihnachtsbaums.
Vera wählte Februar, Juni und Juli – in den anderen Monaten hatte sie eine zu starke Nebenhöhlenentzündung. Nellie war es egal, abgesehen vom November, weil sie guten Kürbiskuchen machte. Evelyn sagte, dass sie einverstanden sei mit dem, was die anderen entschieden.
In den nächsten Monaten, die von den Samstagen geprägt waren, fingen die Frauen an, Zeitschriften wegen der Tischdekorationen und der Rezepte zu kaufen; sie rollten ihre Haare zu Locken auf und puderten sich die Gesichter. Sie rülpsten jetzt voreinander, witzelten und stritten, und sie fingen an zu lachen.
Dad war fünf Monate lang im County Krankenhaus. Sein Bein war jetzt in Ordnung, aber er war sehr schwach; sein Asthma und die Geschwüre hatten sich sichtlich verschlimmert. Sie hatten viele Tests gemacht. Zuerst war Esther ihn zweimal in der Woche besuchen gefahren. Aber es war so weit weg, zwei Busse und ein Fußweg. Sie gab zu, dass sie nicht gern hinfuhr, nicht gern hörte, was es zu essen gegeben hatte, wie seine Verdauung war. Sie hasste es, durch die Station zu gehen, die nach Desinfektionsmittel, Urin und schmutzigen Haaren roch, an den Reihen magerer alter Männer vorbei, die auf dem Rücken lagen und an die Decke starrten. Sie hasste es, das Rascheln, das Kotzen hinter den Vorhängen zu hören, die kranken Männer zu sehen, die zahnlos ihre Verwandten angrinsten, denen es zu heiß war, die nicht wussten, was sie sagen sollten.
Einer der Ärzte sprach mit Esther über Dads Entlassung. Es gehe ihm nicht wirklich gut, sagte der Arzt. Aber er sei niedergeschlagen und gelangweilt und wolle nach Hause. Esther müsse viel Geduld haben, ihm helfen.
»Ja«, sagte sie, »obwohl es nicht einfach ist, sich um ihn zu kümmern, allein und so, ich …«
Der Arzt hatte es eilig. »Es wird nicht für lange sein«, sagte er.
Verärgert nahm Esther ihm den Stift aus der Hand und unterschrieb das Entlassungspapier.
Ein Praktikant hob ihn ins Taxi. Dad konnte seinen Kopf nicht oben halten. Er war dünn neben Esther im Auto. Sie streckte ihre Hand nach ihm aus, und er weinte.
Wenige Tage nachdem Dad nach Hause gekommen war, kamen die Mädels mit Keksen und Törtchen für ihn vorbei, obwohl er nichts davon essen konnte. Sie schienen ihn nicht zu beachten. Ihre Stimmen waren schrill, und Nellie rauchte. Dad fing an zu husten, rappelte sich auf. Keuchend und würgend humpelte er in sein Zimmer.
»Arme Esther … es ist schrecklich schwer für dich«, sagte Evelyn. Sie verstummten, als Dad auf seinem knarrenden Bett stöhnte, mit sich selbst sprach.
Jeden Morgen nahm er ein Ei und ein Glas Milch zu sich. Er wusch Teller, Gabel und Glas ab.
Dann machte er Wackelpudding, lehnte seinen Körper an die Spüle. Während der Wackelpudding andickte, saß er auf einem Stuhl am Kühlschrank und öffnete hin und wieder die Tür, um nach dem Pudding zu sehen. Sobald er anfing zu gelieren, gab er Birnenstücke aus der Dose und etwas Hüttenkäse hinein. Jeden Tag machte er einen andersfarbigen Wackelpudding. Manchmal gab er Marshmallows dazu.
Esther half ihm auf die Veranda. Dort saß er den restlichen Vormittag, schaute hinaus auf die Straße, seine Augen waren mit einem schimmernden Schleier überzogen, ähnlich dem über einem Feuer. Er aß Wackelpudding und Toast zum Mittag und trank eine Tasse Tee. Den ganzen Nachmittag lang schlief er, und dann aß er Eier oder gekochtes Huhn und Wackelpudding und trank eine Tasse Tee von einem Tablett vor dem Fernseher.
In der ersten Woche im Oktober war Esther mit dem Kaffeekränzchen an der Reihe. Sie würde Baiserkuchen machen. Am Tag zuvor putzte sie die Fenster, saugte, polierte Silber und Möbel. Am Tag des Kaffeekränzchens stand sie früh auf und saugte noch einmal. Sie legte eine prächtige, orangefarbene Decke auf den Tisch, arrangierte orangefarbene Kerzen und braune Herbstblätter und Gräser als Dekoration in der Mitte. Als sie den Tisch betrachtete, empfand sie Freude.
Dann wachte Dad auf. Sie wusch ihn, wechselte den elastischen Strumpf an seinem fleckigen Bein, wechselte die Verbände an seinen Händen und Armen und an den Wunden am Hals. Er atmete ein kleines Lied, während sie sich um ihn kümmerte. Sie zog ihm hellbraune Hosen und ein neues Hemd an. Er war wütend. Er wollte in seinem Morgenmantel bleiben. »Scht, reg dich nicht auf.« Sie zog ihm die Schuhe an. »So, nun bist du fertig«, sagte sie, aber er lag erschöpft ins schmutzige Kissen gelehnt, sein Atem heulte schwach aus der Tiefe seiner Brust, das Geräusch ferner Sirenen.
»Ich bringe dir das Frühstück hierher.«
»Nein.« Er fuhr aus dem Bett auf.
»Du bleibst hier. Du wirst mir sonst nur im Weg sein. Ich mache Baisers.«
Er schloss die Augen. Strähnen seines grauen stumpfen Haars klebten auf dem Kissen. Seine Zähne fielen ihm vom Gaumen.
»Siehst du. Du kannst nicht aufstehen.«
Esther machte Piment-Käse-Sandwiches, als er in die Küche kam.
»Also wirklich, Dad, du kannst nicht aufstehen. Die wasch ich schnell ab.« Er schüttelte den Kopf. Er hielt sein Geschirr unter den Wasserhahn und stellte es in den Abtropfkorb. »Wackelpudding«, flüsterte er. Sie langte über sich in den Hängeschrank und schob ihm eine Schachtel Zitronen-Wackelpudding über das Küchenbord hin. Sie nahm eine Schüssel heraus, öffnete eine Dose Birnen und einen Becher Hüttenkäse.
»Weißt du, was ich möchte?«, fragte er. »Rippchen und Sauerkraut. Und Karamell mit Nüssen.« Er drehte sich grinsend zu ihr um. Sie hatte es nicht gehört. Sie wollte, dass er ging, dass er der Küche fernblieb, während sie die Sachen vorbereitete. Sie wollte, dass alles schön war. Er setzte sich auf den Stuhl am Kühlschrank und wartete auf den Wackelpudding.
Sie setzte Kaffee auf und ging sich umziehen. Brauner Pullover, korallenfarbener Lippenstift.
Der Kaffee kochte über. »Hast du das nicht gesehen?«
»Nein.«
»Geh, geh schon, raus. Sie werden gleich hier sein.« Sie standen auf der Veranda und warteten, dass Esther die Tür aufmachte. Dad nickte ihnen von seinem Stuhl aus zu.
»Die Vögel fressen deine Feuerdornbeeren«, sagte Nellie zu ihm.
»Machen sie immer, Nellie.«
»Wie geht’s dir, Dad?«
Er wurde rot, freute sich, wollte ihr antworten, aber Esther hatte die Tür geöffnet. »Ach, hallo, Mädels, kommt rein! Kommt rein!«
»Was für ein schöner herbstlicher Tisch!«
»Esther, seit wann trägst du Farben … ein Anblick!«
Baisers! Keine von ihnen hatte je Baiserkuchen gegessen. »Hast du die alle selbst gemacht?«
»Merci, nein. Eine Backmischung«, log sie. So sah es aus, als hätte sie keine zusätzliche Mühe gehabt. Sie aßen schweigend. Das Schneegeräusch von Baiser. Auf der anderen Seite des Spiegelglasfensters hustete und spuckte Dad, rang nach Luft. Sie waren erleichtert, als es Zeit war für Dough Re Mi. Der Showmaster winkte.
»Mir gefällt er besser in seiner Night Show, wo er seinem kleinen Jungen gute Nacht sagt.« Vera sagte das jedes Mal.
Etwas schlug sanft gegen das Fenster. Dad schrie auf, sein Stuhl schabte über den Zementboden. Er öffnete die Haustür.
Er lachte. In seinen bandagierten Händen hielt er einen toten Spatz.
»Er hat im Fenster den Himmel gesehen. Dachte, es wäre der Himmel! Gottdammich, nie gehört so was. Ist direkt reingeflogen.«
Die Frauen wichen vor dem warmen Vogel zurück, vor den Wunden an Dads Händen. Sie wandten die Blicke ab von dem alten Mann, der im Türrahmen hing, von dem dunklen Fleck, der an seiner Hose heruntersickerte und auf den Zement tropfte.
»Wollt ihr wissen, was er dachte? Das Ende vom Himmel!« Dad rang nach Luft. Keuchend ließ er sich neben Nellie auf das Sofa fallen. Federn schwebten auf den Läufer.
»Bring ihn raus!«, sagte Esther.
»Hier, Dad, gib mir das arme Ding.« Nellie brachte den Vogel hinaus, rannte mit ihm zum Korb voller Blätter im Hof. »Komm in dein Zimmer, Dad.« Esther war blass im Gesicht, ihr Lippenstift war zu kleinen Linien rings um den Mund zerronnen, wie Nadelstiche an einer Flickenpuppe.
Ihre Tränen fielen auf Dads Bein, als sie sich hinkniete, um ihm die Schuhe auszuziehen.
»Meine schöne Party! Ich habe dich gebeten, uns nicht zu stören. Und du saust dir deine Hosen ein!«
Dad lag still, während sie ihm die nassen Sachen auszog.
»Dachte, er hätte das Ende vom Himmel erreicht!«, flüsterte er. Sie rollte seine Sachen zusammen und legte sie in die Ecke. Sie würde sie später hinausschaffen. Dad war eingeschlafen, sein Mund stand offen. Sie deckte ihn zu.
Die Frauen hatten ihr Geschirr in die Küche gebracht. Nellie wusch ab und Evelyn und Vera trockneten ab. Esther war schwindlig. Ihre Stimme war trocken. »Das sollt ihr doch nicht machen.«
»Aber, Esther, du hast schon genug zu tun«, sagte Evelyn.
»Wir dachten, wir machen das fertig, trinken noch einen Kaffee und bleiben noch ein bisschen«, sagte Nellie.
»Dann husch. Setzt euch hin, und ich serviere ihn anständig.«
Esther schenkte Kaffee aus. »Bin keine so gute Gesellschaft«, murmelte sie. »Aber Esther«, sagten sie.
Evelyn sagte, es sei Zeit für ihren Mittagsschlaf. Sie waren alle müde, gingen erschöpft zur Tür.
»Dein Tisch war einfach herrlich!«
»… und Baisers!«
»Wer ist nächsten Monat dran?«
»Ich«, sagte Nellie, »aber ich werde so tun, als wäre es noch Oktober und einen Halloweenkürbis machen.«
Die anderen schüttelten den Kopf. Diese Nellie.
Für ihr Weihnachtskaffeekränzchen wollte Esther eine tiefblaue Tischdecke nehmen, Kiefernnadeln und weiße Kerzen, kleine weiße Törtchen und Bonbons. Ihr silberner Baum im Fenster würde mit blauen und silbernen Kugeln geschmückt sein. Als sie den Baum tags zuvor aus dem Schrank holen wollte, hatte sie einen Herzinfarkt.
Es war kein schwerer Infarkt, doch der Arzt verschrieb ihr Tabletten und Bettruhe. »Erschöpfung«, sagte er und trug Dad auf, sich eine Hilfe zu suchen.
Als der Arzt gegangen war, stand Esther auf und ging zum Schrank, um ihren Bademantel zu holen. Sie war sehr schwach, wurde ohnmächtig. Schluchzend versuchte Dad, sie aufzuheben, sie zum Bett zu ziehen, aber sie war zu schwer.
Er legte sich neben sie auf den grünen Baumwollläufer. Er legte die Arme um sie. Sie war warm, elastisch wie Weißbrot; ihr Bauch bewegte sich sanft mit ihrem Atem. Er legte sein Gesicht in ihren Nacken, presste seinen Mund an die feuchte Haut, die immer nach Jergen’s Creme roch.
Nellie kam vorbei. Sie machte Hühnernudelsuppe und Vanillepudding. Als Esther aufwachte, betrat Dad das Zimmer nicht. Er machte orangefarbenen Wackelpudding. Er saß am Kühlschrank, als Nellie mit Esthers Tablett hereinkam.
»Sie schläft … das wird ihr mehr helfen als alles andere.«
»Nellie …«
»Mach dir keine Sorgen, Dad. Sie lässt sich nicht unterkriegen.« Nellie nahm die Dose mit Birnen. »Also, von all dem Blödsinn ausgerechnet den Saft zu verschwenden … nimm den Saft anstelle von Wasser.«
»Nun, meine Schuld, hab nie daran gedacht.«
»Mach dir keine Sorgen, Dad. Du gehst jetzt ins Bett.«
Dad ging in sein Zimmer, saß auf der Bettkante. Er konnte seine Schuhe nicht ausziehen. Er hörte, wie Nellie das Geschirr verräumte, die Schranktüren zuschnappten. Der Abtropfkorb bumste ans Regal.
Sie betrat den Flur zwischen den beiden Zimmern, stand still, lauschte. »Ich gehe jetzt nach Hause«, sagte sie.
Als sie die Haustür zugemacht hatte, stand Dad auf und ging zu Esther ins Zimmer. Sie schlief. Seit sie ganz jung gewesen waren, hatte er sie nicht mehr ohne Make-up gesehen. Jetzt sah sie jung aus, ihr faltiges Gesicht weich und voll. Er setzte sich auf die Bank an der Kommode und betrachtete sie.
Sie schlief bis zum späten Nachmittag. Als sie aufwachte, bemerkte sie ihn nicht, drehte ihr Gesicht zur Wand und seufzte. Dad schlich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer.
»Mama.«
Sie erschrak, wandte sich zu ihm um, ohne sich im Bett aufzurichten.
»Hier, Mama, ich habe dir etwas Wackelpudding und Toast gebracht.« Sie starrte ihn panisch an. Er nahm den Teller vom Tablett und stellte ihn auf den Nachttisch. Er lächelte sie an, das Tablett zitterte in seinen Händen.
»Hab Teewasser aufgesetzt«, sagte er.
Als er zurückkam, hatte sie sich aufgesetzt, die Falten ihrer Haut wie gefrorene Wäsche, steif, verzerrt in ihrem zerknitterten weißen Nachthemd.
»Dachte, ich esse auch was, mit dir.« Er stellte die überschwappenden, klappernden Tassen neben den unberührten Teller mit Wackelpudding. Vorgebeugt stopfte er die Kissen in ihrem Rücken fest.
Sie nahm die Tasse, die er ihr hinhielt. »Trink was, Mama«, sagte er.
»Das Mädchen« begann 1969 als Schreibübung. Der erste Teil des Romans Tess von den d’Urbervilles von Thomas Hardy aus dem Jahr 1892 wird in dieser Bearbeitung in die Stadt Corrales, New Mexico, verlegt, wo Lucia von 1966 bis 1969 lebte. Für Lucia waren das Umschreiben und Neuinterpretieren ihrer liebsten Klassiker sowohl eine Übung als auch ein Hilfsmittel, um den Schreibprozess in Gang zu bringen. Tess von den d’Urbervilles gehörte zu Lucias Lieblingsbüchern. Sie sah eine Parallele zwischen sich und Tess, dem unschuldigen Mädchen, dessen Leben sich für immer verändert, nachdem es von einem älteren Mann verführt und vergewaltigt wird. Der Bearbeitung liegt der Gedanke zugrunde, dass sie eines Tages ihre eigene Geschichte der Verführung und Vergewaltigung durch den Geschäftspartner ihres Vaters in Form eines Schauerromans schreiben würde. Die ursprüngliche Version ging bei einem Brand verloren, doch 1983 schrieb sie die Geschichte noch einmal für ihren zweiten Erzählband Phantom Pain (erschienen im Verlag Tombouctou, 1984).
Das Mädchen
Nach Tess von den d’Urbervilles von Thomas Hardy
Juan Delayo folgte der unbefestigten Straße von Vivians Tijuana Bar hinunter zu seinem Haus in Corrales. Als er an der Kirche vorbeikam, bekreuzigte er sich und verfehlte betrunken Stirn und Brust, wobei seine Hand ein wackliges Trapez vor seinem Körper beschrieb.
Pater Ramirez goss die Bäume vor dem Pfarrhaus, obwohl sie schon lange tot waren. Die Frauen, die freitags Bingo spielten, hatten sie gekauft und gepflanzt, und er hatte sie gesegnet. Pfirsichbäume.
»Buenas, padre!«, rief Juan.
»Buenas tarde, Don Juan.«
Juan ging weiter, hielt dann inne und kehrte zum Priester zurück.
»Wieso haben Sie mich ›Don‹ genannt?«
»Tut mir leid – nur aus Spaß.«
»Verarschen Sie mich?«
»Überhaupt nicht. Ich habe mit den Leuten von der staatlichen Landzuteilung gearbeitet – wir sind alte Unterlagen durchgegangen. Ziemlich viel Recherche – faszinierendes Geschäft. Ich habe entdeckt, dass Sie der einzige leibliche Nachkomme von General de la Osa sind, dem einmal das ganze Valley von Corrales gehörte.«
»Das ganze Valley?«
»Ja.«
»Y? Qué pasó, pues?«
»Es wurde verkauft, nach und nach. 1870 gehörte es den Armijos, Sandovals und Pereas.«
»Er hieß de la Osa? Ein General?«
»Ja und ein Adliger. Er hat das Land vom spanischen König erhalten.«
»¡Híjole! Der König!« Juan schwankte, grinsend und kratzend.
»Pater, sagen Sie mir noch mal … meine Vorfahren besaßen Gus’ Farm?«
»Ja, die Farm und mehr.«
»Fíjese! Y ese chingado lässt mich und Tesa für fünfundsiebzig Cent die Stunde arbeiten.«
»Stimmt. Aber die eigentliche Ironie, mein Freund, ist die, dass die Heimat Ihrer Vorfahren jetzt die Territorial Bar ist.«
»Das Territorial! Chees … da lassen sie mich nicht mal mehr rein.«
»Nun, Sie machen den Besitzern kaum Ehre – früher oder heute. Juan, ich habe Teresa um sechs Uhr morgens auf den Feldern arbeiten sehen. Waren Sie heute arbeiten?«
»Arbeiten?« Juan überlegte, dann fiel es ihm wieder ein. »Nein, ich arbeite heute Abend, lade Honig für Moises auf. Chees, die wollen mir in meinem eigenen Haus nicht mal ein Bier verkaufen.«
»Großer Gott, was habe ich getan?« Pater Ramirez knickte den letzten Meter des Schlauchs ab, um das Wasser zu stoppen. »Ich sagte, es habe einst Ihrer Familie gehört. Jetzt nicht mehr. Entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt reingehen.«
»Bis dann, Pater«, sagte Juan, dann rief er dem Priester nach: »Hey, diese Bäume sind tot, Mann.« Doch der Priester hörte ihn nicht.
Als Juan zurück auf die Straße kam, wankte er und konnte sich nicht erinnern, ob er auf dem Weg zu Vivians Bar gewesen war oder von dort zurückkam. So oder so war es zu heiß, und er war zu aufgeregt, um darüber nachzudenken. Er legte sich in den wilden Kürbis neben der Straße und starrte zu Gus’ Maisfeld hinüber und hinauf zu den blauen Sandia Mountains.
Tesa? Er begriff nicht, warum sie und die anderen nicht im Packschuppen waren. Auch das Geräusch von Gus’ Traktor fehlte. Nur das Rascheln der herbstlichen Pappelblätter war zu hören, ein Flugzeug hoch oben, ein Motorrad.
Es war Napoleon Suarez. Juan begrüßte ihn.
»Oye, Napie – hol Mauricio. Er ist bei Vivian oder unten im Saguaro. Sag ihm, er soll Gallo-Wein besorgen und mich abholen.«
»Mach es selbst, viejo desgraciado!«
»Nenn mich Don Juan. Ándale.« Lässig reichte Juan Napie einen schäbigen Dollarschein. »Oye … wo sind alle? Ist heute nicht Ernte?«
»Klar, aber nur vormittags. Weißt du, Gus macht am ersten Tag der Ernte immer eine Party. Unten in der Obstplantage gibt es ein großes BBQ. Juan, wozu ist dieser Dollar, Mann?«