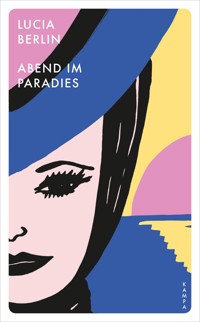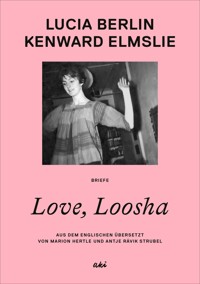Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lucia Berlins Erzählungen, die zu den schönsten literarischen Wiederentdeckungen der letzten Jahre gehören, gehen auch deshalb so unter die Haut, weil sich in ihnen ihr eigenes wechselvolles Leben spiegelt. 18 Mal zog sie um, wurde mit 32 Jahren als Mutter von vier Söhnen bereits zum dritten Mal geschieden, war nirgends richtig zu Hause. Kurz vor ihrem Tod 2004 schrieb sie an einem Buch, das mehr als 20 kurze autobiografische Texte enthält, chronologisch geordnete Erinnerungen an die Orte, die sie prägten und an denen auch ihre Geschichten spielen. Sie beginnen 1936 in Alaska und enden (viel zu früh) 1966 im Süden Mexikos, mehr Zeit blieb ihr nicht. Ergänzt durch eine Auswahl von Fotos und Briefen, gibt der von ihrem Sohn Jeff herausgegebene Band einen faszinierenden Einblick in den Lebensstoff, aus dem Lucia Berlin ihre einzigartige Literatur geschaffen hat: »Da waren sie, die Geschichten ihrer Kindheit, die wir so oft gehört hatten, als wir noch klein waren. Nur geordnet und nicht mehr als Fiktion getarnt«. (Jeff Berlin im Vorwort)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Lucia Berlin
Welcome Home
Erinnerungen, Bilder und Briefe
Aus dem amerikanischen Englisch von Antje Rávik Strubel
Kampa
In Erinnerung an Fred Buck und Helene Dorn
Vorwort
»Es ist absurd, an wie vielen Orten ich gelebt habe … und weil ich so oft umgezogen bin, sind Orte sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin immer auf der Suche … auf der Suche nach einem Zuhause.«
Lucia Berlin, 2003 in einem Interview
Die erste Schriftstellerin, der ich je bei der Arbeit zusah, war meine Mutter Lucia Berlin. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die, wie Mark und ich mit unseren Dreirädern in unserem Loft in Greenwich Village herumfahren, während Mom auf ihre Olympia-Schreibmaschine einhämmert. Wir dachten, sie würde Briefe schreiben – sie schrieb eine Menge Briefe. Auf unseren langen Spaziergängen durch die Stadt blieben wir fast jeden Tag an einem Briefkasten stehen, wo sie uns ihre Umschläge durch den Schlitz werfen ließ. Wir mochten es, sie verschwinden zu sehen und herunterfallen zu hören. Wann immer sie einen Brief bekam, las sie ihn uns vor, oft erfand sie eine Geschichte anhand dessen, was an diesem Tag geschickt worden war.
Wir wuchsen damit auf, ihren Geschichten zuzuhören. Wir hörten viele, und manchmal waren sie unsere Gute-Nacht-Geschichten: ihre Abenteuer mit ihrem besten Freund Kentshereve; der Bär, der sie beim Zelten gefangen hielt; die Hütte mit der Tapete aus Zeitungsseiten; Tante Tiny auf dem Dach; Onkel Johns zahmer Berglöwe – wir hörten sie alle mehr als einmal. Es waren Geschichten aus ihrem Leben, und viele fanden Verwendung in den Geschichten, die sie später schrieb und veröffentlichte.
Als ich sechs war und einen Schrank erkundete, entdeckte ich eine Schreibmaschinenhülle. Darin befand sich eine Mappe, auf deren Deckel »Ein friedliches Königreich« stand. Es war die Geschichte von zwei kleinen Mädchen, die überall in El Paso Spieldosen verkauften. Es war das erste Mal, dass ich etwas las, das kein Kinderbuch war. Damals begriff ich, dass sie nicht einfach nur Briefe tippte, sondern Geschichten schrieb. Sie erklärte mir, dass ihre Arbeiten einige Jahre zuvor in Zeitschriften veröffentlicht worden waren. Sie zeigte mir die Ausgaben und ließ sie mich lesen. Danach bedrängte ich sie oft, mich lesen zu lassen, was sie schrieb, worauf sie entgegnete: »Wenn ich fertig bin.«
Es dauerte weitere sieben oder acht Jahre, ehe sie begann, die Sachen so weit fertigzustellen, dass ich sie lesen durfte. Da hatte sie bereits zwei weitere Söhne (meine Brüder David und Dan), war von ihrem dritten Ehemann geschieden (unserem Dad, Buddy Berlin), nach Berkeley gezogen und mühte sich damit ab, als Lehrerin an einer kleinen privaten Highschool über die Runden zu kommen. Inmitten des Chaos (oder aufgrund dessen) schrieb sie mehr als je zuvor. An den meisten Abenden setzte sie sich nach dem Essen und unserer Lieblingssendung im Fernsehen mit einem Glas Bourbon an den Küchentisch und fing an zu schreiben, wobei sie oft bis spätnachts weitermachte. Gewöhnlich kritzelte sie handschriftlich mit Kugelschreiber in Notizbücher mit Spiralbindung, doch gelegentlich wachten wir vom Klang ihrer Schreibmaschine auf, häufig übertönt von ihrem jeweiligen Lieblingslied, das wieder und wieder in der Stereoanlage lief.
Die ersten Geschichten, die sie zur damaligen Zeit beendete, waren die, die sie in den frühen 1960er Jahren in New York und Albuquerque zu schreiben begonnen hatte. Darauf folgten bald eher persönliche Geschichten, die von eigenen Tragödien herrührten, die wiederum aus ihrem sich verschlimmernden Alkoholproblem resultierten. Nachdem sie ihre Stelle als Lehrerin verloren hatte, nahm sie eine Reihe unterschiedlicher Jobs an (Putzfrau, Telefonistin, Sekretärin auf einer Krankenstation), die ein ebenso reiches Recherchematerial für neue Geschichten boten wie die Zeit, die sie in Ausnüchterungszellen und Entzugsanstalten verbrachte. Trotz der Rückschläge machte sie mit dem Schreiben weiter und begann langsam, wieder zu veröffentlichen.
Jahre später war eine frühe Fassung von Welcome Home das Letzte, was sie mir zu lesen gab; eine Reihe von Erinnerungen an die Orte, die sie ihr Zuhause genannt hatte. Ursprünglich hatte sie einfache Skizzen der Orte selbst geplant, ohne Figuren oder Dialog. Hier gab es nun die Geschichten aus ihrer Kindheit, die wir so oft gehört hatten, als wir noch klein waren, aber jetzt chronologisch geordnet und nicht länger als Fiktion verkleidet. Leider reichte die Zeit nicht mehr, und die letzte Fassung des Manuskripts bricht 1965 mit einem unbeendeten Satz ab.
Im Laufe ihres Lebens schrieb Lucia Hunderte, wenn nicht Tausende Briefe. Einige unserer Lieblingsbriefe aus der Zeit, die Welcome Home umfasst, wurden hier beigefügt. Die meisten davon sind Briefe an ihre guten Freunde Ed Dorn und Helene Dorn datiert zwischen 1959 und 1965. Es war eine dramatische Zeit, eine Zeit voller Entwicklungen und Umbrüche, und die Briefe bieten einen faszinierenden Einblick in die Psyche einer jungen Mutter und aufstrebenden Schriftstellerin inmitten ihrer Selbstfindung.
Wir überreichen Ihnen Welcome Home; Erinnerungen, Bilder und Briefe aus den ersten neunundzwanzig Lebensjahren einer einzigartigen amerikanischen Stimme.
Jeff Berlin, Mai 2018
Welcome Home
Lucia, geboren am 12 November 1936
Alaska, 1935
Juneau, Alaska 1935
Ted und Mary Brown, Juneau 1935
Das Haus der Browns in Juneau
Juneau, Alaska
Sie sagten, es war ein süßes kleines Haus mit vielen Fenstern, robusten Holzöfen und Fliegengittern gegen die Mücken. Es zeigte zur Bucht, zum Sonnenuntergang, zu den Sternen und den hell leuchtenden Nordlichtern. Meine Mutter wiegte mich, während sie zum Hafen hinuntersah, der immer voller Fischerboote und Schlepper war, mit Erz beladene amerikanische und russische Schiffe.
Mary Brown und Lucia, Juneau 1937
Ted und Mary Brown, Mullan, Idaho 1937
Meine Wiege stand im Schlafzimmer, wo es immer sehr dunkel oder sehr hell war, erzählte sie mir, ohne die langen und kurzen Phasen der Jahreszeiten weiter zu erklären. Das erste Wort, das ich sprach, war Licht.
Mullan, Idaho
Meine erste Erinnerung besteht aus Kiefernzweigen, die über eine Fensterscheibe streifen. Dieses Haus befand sich in Coeur d’Alene in Idaho, an der Sunshine Mine. Gewaltige Eichen streckten ihre Äste fast parallel über dem Boden aus, und Eichhörnchen rasten auf ihnen hin und her wie auf Highways.
Kürzlich las ich, dass der Geruch von Blumen, besonders von Rosen und Flieder, vor Jahren tatsächlich viel intensiver war und ihr Duft mittlerweile durch Hybridisierung verdünnt ist. Das mag stimmen oder nicht; meine erinnerten Idaho-Düfte sind heftiger als die jeder heutigen Blume. Die Apfelblüten und die Hyazinthen waren buchstäblich berauschend. Ich lag im Gras unterm Flieder und atmete, bis mir schwummrig war. In jenen Tagen drehte und drehte ich mich, bis mir so schwindlig wurde, dass ich nicht mehr stehen konnte. Vielleicht waren das die ersten Warnzeichen und der Flieder meine erste Sucht.
Das Haus der Browns in Mullan 1937
Lucia, Mullan
Ich hatte noch nie von Weidenkätzchen gehört und war erstaunt, Fell an einem Stängel wachsen zu sehen. Ich watete durch den eisigen Fluss, um zu ihnen zu gelangen, meine Kleidung und Schuhe waren durchnässt. Danach durfte ich nicht mehr hinausgehen; ich hätte ertrinken oder fortgerissen werden können.
Ich schlief in einem Schrankbett. Die gab es damals häufig, Betten, die tagsüber in den Schrank geklappt wurden. In diesem großen Haus gab es keine Läufer und sehr wenige Möbel. Knarren. Echo des Windes in den Bäumen, das Plätschern von Regen auf Glas. Schluchzen im Bad.
Abends spielten meine Eltern manchmal mit Nachbarn Doppelkopf. Gelächter und Rauch trieben die Treppe herauf in mein Zimmer. Ausrufe auf Finnisch und Schwedisch. Wunderbar, der Wasserfall aus Pokerchips und Maracas-Eiswürfeln. Die spezielle Art, wie meine Mutter die Karten ausgab. Rasches Gezisch des Mischens, ein forsches Klatsch-Klatsch-Klatsch, mit dem sie die Karten verteilte.
Jeden Morgen sah ich die Kinder in die Schule gehen, und später konnte ich sie Kickball oder Jacks spielen, Kreisel drehen hören. Ich spielte im Haus mit meinem »Hund« Skippy, einer kleinen Kaffeemaschine, die mit dem Gürtel eines Bademantels angeleint war. Meine Mutter las Krimis. Beide sahen wir durch das Fenster dem Regen zu. Zuerst ist es erschreckend, dann schön, am Tag des ersten Schnees zu erwachen.
Mein Vater kam müde und rußbedeckt nach Hause, seine Augen weiße Schreckringe mit grünen Smaragden im Inneren.
An Samstagabenden gingen wir den Berg hinunter in die Stadt. Ein Gemischtwarenladen und eine Post, Gefängnis, Friseur, ein Drugstore und drei Bars. Wir kauften eine Saturday Evening Post und einen großen Hershey-Schokoladenriegel. Hörbares Knirschen des Schnees unter unseren Gummiüberschuhen. Wir kehrten nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurück, aber unter den Idaho-Sternen, die den Himmel zersplittern ließen, war es hell wie am Tag. Das Licht der Sterne war damals mit Sicherheit ebenfalls heller.
Marion, Kentucky
Schnee und Kälte, aus der schnell ein schwüler, südlicher Frühling mit Trompetenbäumen, Pfirsichen und Apfelblüten wurde. Überall Vögel, unbändig jubilierend. Schmetterlinge. Ich musste auf der Veranda der Pension bleiben, die glänzend schwarz gestrichen war und von glänzenden nigras gewischt wurde. »Erlaube ihr nicht, sie so zu nennen«, sagte mein Vater zu meiner Mutter.
»Ich bin aus Texas. Soll ich Bimbo sagen?«
»Farbige, mein Gott.«
Die farbigen Putzfrauen und Köche und Kellner unterhielten sich alle mit mir.
In der Pension gab es keine anderen Kinder. Die Bergarbeiter in Marion waren alleinstehende Männer, meistens Mexikaner, Hunderte, die in Kasernen wohnten. Die Leute in der Pension waren Ingenieure wie mein Vater, Edelmetallprüfer, Geologen, ein Maurer mit Schnauzbart, mit dem meine Mutter auf der Veranda lachte. Der einzige andere weibliche Gast war eine Krankenpflegerin. Ihre Brüste waren so enorm, dass sie seitlich sitzend essen musste. Ich konnte nicht aufhören, sie anzuschauen, bis mein Vater mir eine verpasste, weil ich ihren Busen anstarrte. Daraufhin kriegte ich allein bei dem Wort Busen schon einen Lachanfall, aber ich konnte nicht aufhören, es zu sagen, zu singen: »Busen, Busen, Busen«. Die Pflegerin besuchte verschiedene Schulen, behandelte Eiterflechte mit Enzianviolett.
Lucia, Marion, Kentucky 1939
Die Pension, Marion 1939
Wir wohnten in einem heißen Zimmer mit Deckenventilator und Mückennetz und einem Balkon, der nur für mich groß genug war. Alle Bewohner benutzten gemeinsam ein schimmeliges und übel riechendes Bad am Ende des Flurs. Manchmal weinte meine Mutter, wenn ich ins Zimmer kam, aber sie sagte: »Nein, tue ich nicht, hörst du?« Sie lag in einem pfirsichfarbenen Slip auf dem Bett und las Krimis.
Von der Pension sind wir nur dreimal ausgegangen. Einmal nahm uns der Maurer zu einer Fahrt aufs Land mit. Sanfte grüne Hügel mit Kühen und Pferden und dann eine Farm mit Schweinen. Riesige Schweine, so groß wie Autos mit gemeinen kleinen Menschenaugen. Mein Vater fuhr mit uns über den Mississippi. Er weinte, als er über die Weite blickte, und sagte, wir könnten uns glücklich schätzen, in Amerika zu leben. Meine Mutter nannte ihn einen rührseligen Trottel. Er nahm uns in eine große Stadt mit, wo wir Rolltreppe fuhren. Ich bekam Jacks, mit denen ich auf der Ve- randa spielen konnte, ohne zu begreifen, wie. Ich versuchte Skippy in Enzianviolett umzubenennen, aber es klappte nicht. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Glühwürmchen.
Deer Lodge, Montana
In Deer Lodge wohnten wir in einer Holzhütte mit zwei Zimmern am Lonesome Pine Motor Court. Gemütlich, mit Westernstimmung. Handelsmarken auf den Lampenschirmen. Cowboys und Indianer auf Vorhängen und Laken. Gemälde von Zureitern und indianischen Kriegern. Häuptling Hiawatha in einem Kanu. Ich schlief auf einer ausziehbaren Couch neben einem wunderschönen Radio. Bei Bibelsendungen rief ich dem kleinen Sprecher zu: »Ja, Jesus ist mein gesegneter Erlöser!« The Shadow, Fibber McGee, Jack Benny, Let’s Pretend1 Ich kriegte einen Lachanfall, sobald ich das Lied »I Ain’t Got Nobody« hörte, weil meine Mutter meine Vagina meinen body nannte, sagte, ich solle nie damit spielen.
In Deer Lodge hatte meine Mutter eine Freundin, Georgia, deren Ehemann Joe in der gleichen Schicht in der Mine arbeitete wie mein Vater. Sie wohnten nebenan, kamen jeden Sonntag zum Kaffee und zu einem Kaffeekuchen, den meine Mutter buk. Normalerweise kochte sie nicht, deshalb war sie auf diesen Kuchen richtig stolz. Draußen schneite es immer; glühende Hitze kam aus dem Küchenofen. Im Haus hing Dampf, der nach Zimt und Vanille roch. Alle hatten glänzend rosige Gesichter und lachten.
In der Woche waren die Männer so müde, dass sie kaum ihre Stiefel ausbekamen. Sie aßen, ohne zu reden, und fielen ins Bett. Samstags tranken sie Bourbon und spielten Bridge und lachten. Sonntags lasen Joe und mein Vater beim Frühstück abwechselnd die Witzseiten vor, lagen dann auf meinem Bett und lasen den Rest der Zeitung, während die Frauen spülten und sich frisierten, große Locken über Gummiröhren rollten, den Rest mit Haarklammern in Wellen legten. Sie zupften ihre Augenbrauen und manikürten ihre Nägel, während sich die Männer Football-Spiele im Radio anhörten.
Lucia, November 1940
Ich lag zwischen ihnen auf der Bettcouch, malte, mochte den Jubel der Menge, die fieberhaften Ansager, das Gebrüll der Männer oder ihr gegenseitiges Auf-die-Schulter-Schlagen, ihren Bergarbeitergeruch aus Camel-Zigaretten, Bier und Seife. Bergarbeiter riechen immer nach Seife, bestimmt, weil sie so schmutzig werden.
Helena, Montana
In Helena wohnten wir in einer lauten Wohnung, in der meine Eltern im Schrankbett schliefen und ich auf einem Feldbett aus Segeltuch. Draußen vor der Hintertür stieg jeden Morgen der Rahm über die Milchflaschen. Es gab einen Eissturm, und die Bäume klangen wie splitterndes Glas. Ich lernte lesen. Woran ich mich wirklich erinnere in Helena, ist die Bibliothek, der grüne Buchdeckel von Old Mother West Wind,2 der verschlissene blaue von Understood Betsy.3 Ich glaubte, dass Understood Betsy nur für mich geschrieben worden war, dass es irgendwo eine Person gab, die mir von ihr erzählen wollte.
Wochen vor dem ersten Schnee nahm mich mein Vater jeden Samstag mit hinauf in die Berge. Wir brachten Wintervorräte zu einem alten Schürfer, der seit etwa fünfzig Jahren allein dort oben lebte.
Lucia, Blue und der alte Mr. Johnson vor seiner Hütte 1941
Camping und Forellenfischen oberhalb von Helena
Mehl und Kaffee, Tabak, Zucker, getrocknete Bohnen, gepökeltes Schweinefleisch, Haferflocken, Kerzen. Stapelweise schwere Zeitschriften: The Saturday Evening Post, Redbook, Field and Stream.
Es war eine lange Wanderung über einen Pfad, den wir am ersten Tag markiert hatten. Er ließ mich die Rinde anschneiden; in meiner Erinnerung riecht der Saft immer noch stark. In eine Ecke der üppigen, saftig grünen Wiese gedrückt, stand Johnsons Waldhütte. Es war eigentlich nur eine ungestrichene Hütte mit Fenstern, die wie Augen aussahen, und einer Tür, die ein dümmlich schiefes Grinsen war. Hohe Gräser und Wildblumen bedeckten das Dach wie ein festlicher Hut. Ich lag oft auf dem Dach unter dem blauen Himmel, angestupst und geleckt von Hunden und Ziegen. Mein Vater und der alte Mann saßen unterhalb von mir auf Nagelkisten, tranken Kaffee, prüften Goldklumpen, die er geschürft hatte, schauten sich alle möglichen Gesteinsarten an, hmmmten und riefen laut auf bei ihrer Betrachtung. Mein Vater hörte sich stundenlang die Geschichten des alten Mannes an. Jetzt wünschte ich, ich hätte hingehört, aber damals wollte ich einfach auf dem Dach liegen, in einer Stille, die nur von Raben und den verspielten Ziegen und Hunden unterbrochen wurde.
Bevor wir aufbrachen, ging mein Vater in den Wald, zog Stämme und Zweige beim Herauskommen hinter sich her, spaltete sie zu ordentlichen Stapeln in der Nähe der Tür. Ich riss vorsichtig Seiten aus den Zeitschriften und klebte sie mit Kleister aus Mehl und Wasser an die Wände, darauf bedacht, den Text nicht nass zu machen. Es ging darum, ein dichtes Flickwerk von Seiten in der ganzen Hütte zu haben, vom Fußboden bis zum Dach. An all den dunklen Tagen des Winters las Johnson die Wände. Wenn er mit allen Wänden fertig war, klebte er neue Seiten über die alten. Es war wichtig, die Seiten und Zeitschriften durcheinander zu bringen, damit Seite 20 beispielsweise ganz oben an der Nordwand hing und Seite 21 am Fuß der Südwand.
Ich vermute, das war meine erste Lektion in Literatur, über die unendlichen Möglichkeiten der Kreativität. Was ich mit Sicherheit wusste, war, dass seine Wände eine großartige Idee waren. Er hätte die Zeitschriften sehr schnell durchgelesen, wenn die Seiten aufeinandergefolgt wären. Auf diese Weise, weil sie nicht in der richtigen Reihenfolge hingen (und meistens die vorherige oder die darauffolgende Seite an der Wand klebte), musste er, wann immer er eine Seite las, die dazugehörige Geschichte erfinden, manchmal verändern, wenn er Tage später die passende Seite an einer anderen Wand fand. Wenn er die Möglichkeiten seiner Hütte ausgeschöpft hatte, tapezierte er sie mit weiteren Seiten in einer ähnlich zufälligen Reihenfolge neu.
Lucia mit Blue
Seine Ziegen und Hunde wohnten mit ihm in der Hütte, sobald der Schnee kam. Ich stellte sie mir gern alle zusammengerollt auf dem alten Messingbett vor, wie sie ihn in seinen langen Unterhosen beim Lesen seiner Wände im Kerzenlicht betrachteten. Er sagte, wenn ihm im Bett kalt würde, würde er einfach noch eine Ziege zu sich holen.
Mullan 1940
Nicht weit von der Hütte gab es ein Plumpsklo, obwohl er sagte, dass er normalerweise einfach von der Veranda pisste. Es gab auch einen Toilettensitz, mittig wie ein Thron auf einem Berg. »Der ist fürs Denken«, sagte er. »Geh hoch, wir gucken nicht hin. Von da oben kannst du halb Montana sehen.« Es war, als könnte ich alles sehen.
Mullan, Idaho
Diesmal lebten wir in einer der Hütten mit Dachpappe gleich oberhalb der Mine. Das Mahlen und Klapperdiklapp der Maschinen und Generatoren, kreischende, surrende Flaschenzüge. Ketten rasselten. Schweißstäbe knisterten. Schrappen und Fauchen und Klonks. Gestein polterte und krachte von Schaufeln auf Lastwagen, auf Förderbänder. Grubenbahnen ratterten und quietschten, Pfeifen klagten, röchelten, schrillten. Verschiedene Pfiffe jeden Tag, jede Nacht. Auch Männer fluchten und brüllten Tag und Nacht, vor allem in der Nacht, wenn Sägen wimmerten und die kreischenden Geräusche zu Ungeheuern wurden. Am Morgen des ersten Schnees war es ein Wunder, die Ketten und Hängen, die Getriebe und Schütten in kompliziertes, glitzerndes Spitzengewebe verwandelt zu sehen. Der Schnee ließ die Mine sanft, fast ruhig wirken. Junge mexikanische Bergarbeiter spielten wie Kinder darin.
Es gab Kasernen voller Bergarbeiter, alleinstehende Männer, Mexikaner, Finnen und Basken. Die meisten von ihnen sprachen kein Englisch und waren weit weg von ihren Ländern und Familien, sagte mein Vater, als er versuchte zu erklären, warum sie so viel tranken und stritten.
Es gab jetzt ein Baby, meine Schwester Molly. Ihre Wiege stand im Zimmer meiner Eltern. Ich schlief in einem Schrankbett im großen Zimmer, das tagsüber unten blieb und eine Couch war. Ich vermisste das Radio. Das stand jetzt im Schlafzimmer, wo das Baby schlafen sollte.
Die einzige Wärme kam aus einem Kanonenofen. Morgens, wenn es gerade hell genug war, um den Dampf meines Atems zu sehen, wartete ich auf das Scheppern des Ofentürgriffs.
Lucia, Mullan 1941
Molly Keith Brown, geboren am 6. Oktober 1941
In wenigen Minuten käme das Knallen und Knacken des Holzes, das anfing zu brennen, das Bollern einer Schaufel voll Kohle. Das muntere Geräusch der Kaffeemaschine, das Schnicken eines Streichholzes am Daumennagel meiner Mutter, Klack, das Zippo meines Vaters. Ich durfte dem Baby das Fläschchen geben, während sie Kaffee tranken. Sie hatte es gemütlich im Bett mit mir. Sie war nicht interessant, aber sie mochte meine Lieder. »If your head scratches, don’t itch it, fitch it. Use your head, save your hair. Use Fitch Shampoo.« Und: »I ain’t got nobody, ain’t got nobody to carry me home.«
Die Wände waren nicht gestrichen, einfach aus Holz, so wie die Böden. Ich mochte es, in einem Holzhaus zu wohnen, Holz ins Feuer zu legen, um uns warm zu halten, draußen das Holz im Wald zu sehen. Das ganze Haus roch nach Holz.
Wenn man die Tür öffnete, traf einen der frische Kieferngeruch. Sobald man richtig im Wald war, hörte man die Mine nicht mehr. Alles wurde still, sogar meine Schritte auf den seidenweichen Nadeln. Ich glaubte, die Brisen in den Bäumen zu hören, aber als ich stehen blieb, um zu lauschen, gab es kein Geräusch.
Der Küchenboden hatte eine starke Neigung. Ich verbrachte Stunden damit, Dosen ans untere Ende rollen zu lassen. Thunfisch schlägt Ananas.
Direkt oberhalb unseres Hügels befanden sich ein Tal und ein weiterer Berghang, an dem die Bäume im letzten Jahr alle verbrannt waren. Als ich ihn das erste Mal sah, war die ganze Fläche mit scharlachrotem indischem Malerpinsel bedeckt. Eine riesige rote Flamme, lebendig und im Gesumme der Bienen vibrierend.
Ich schloss Freundschaft. Mit Kentshereve. Sein Haus nebenan war genau wie unseres, nur dass es dort sechs Kinder gab. Sie waren sehr arm, und der Vater besorgte in einer Bäckerei in Wallace tütenweise altes Brot. Zum Frühstück aßen sie Getunktes; Brot, das in Tunke aus ausgelassenem Speck und PET-Milch aufgeweicht war. Einmal war es eisig kalt, und sie hatten weder Kohle noch Holz. Der Vater füllte den kleinen Ofen tütenweise mit altem Brot, bis endlich allen warm war, darum herum versammelt. Das Vater Unser versetzt mich in diese Küche.
Meine Schwester Molly bekam eine Lungenentzündung und verbrachte zwei Tage im Krankenhaus in Wallace. Ich blieb solange nebenan, wo die Kinder auf Heu unterm Dach schliefen. Anstelle eines Fensters war Öltuch angenagelt.
Die Sunshine Mine, Idaho
Lucia mit Freunden in Mullan
Kentshereve und ich legten abwechselnd jeder ein Auge an ein Loch im Tuch und sahen in den Nachthimmel. Das Loch schien wie ein Teleskop zu funktionieren, es rahmte und vergrößerte die blendende Anordnung der Sterne.
Ich war glücklich, zwischen den Kindern im Heubett zu liegen, glücklich, sie zu riechen, obwohl es schlimme Gerüche waren, nehme ich an, Urin und saure Milch, schmutzige Haare und Füße. Wir kuschelten uns aneinander, schnüffelten beim Einschlafen wie Welpen, jeder von uns am Daumen lutschend.
Kentshereve und ich kamen in die erste Klasse. Es war weit zur Schule … einen hohen Berg hinauf und dann lange hinab, noch einen Berg hinauf und in die Stadt. Nach der Schule wurden wir von Murphys Bar aus mitgenommen, wohin alle unsere Väter nach der Schicht gingen. Die Bergarbeiter sprachen zum ersten Drink immer einen Toast: »Sollen wir arbeiten? Zum Teufel, nein! Sollen wir streiken? Zum Teufel, nein! Was sollen wir machen? Trinken! Hurra!«
Wir gingen gern zur Schule. Es gab nur eine Lehrerin, Miss Brick, die eine gute Lehrerin war. Wir waren für unterschiedliche Fächer in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Mit den kleinen Kindern hatte ich Rechnen und Schreiben, mit den großen Kindern Lesen und Geografie. Bei Kentshereve war es genau andersherum. Er war der Klügste in der ganzen Schule. Er wusste alle möglichen Sachen, zum Beispiel, dass eine kleine Tulpe darin steckte, wenn man eine Tulpenzwiebel aufschneidet.
Kurz nach Pearl Harbor ging mein Vater ins Ausland. Er war Reserveoffizier bei der Marine gewesen, also ging er zur Offiziersausbildung, um Leutnant zu werden, dann auf ein Munitionsschiff im Pazifik. Wir gingen zu Großpapa und Mamie ins texanische El Paso.
Das ging alles sehr schnell, einige Tage vor dem weihnachtlichen Krippenspiel, bei dem Kentshereve und ich zwei der drei Weisen gewesen wären. (Sein Name war Kent Shreve, aber das war mir viele Jahre lang nicht klar.) In den kommenden schrecklichen Jahren hatte ich Sehnsucht nach ihm und meinem Vater.
Es wird Herzschmerz genannt, weil es ein körperlicher Schmerz ist, jemanden zu vermissen, ein Schmerz im Blut und in den Knochen.
Leutnant Ted Brown, U.S. Navy
Mein Vater brachte uns ins Davenport Hotel in Spokane, und dann fuhr er weg. Wir verbrachten dort die Nacht und nahmen am nächsten Tag den Zug nach Texas. Meine Mutter und ich hatten jeweils ein Bett mit gestärkten Laken. Meine Schwester schlief auf Kissen in einer Schublade, die aus einer Truhe im Zimmer stammte.
Meine Mutter nahm die Schublade mit in den Zug, mit meiner Schwester darin. Ich hatte Angst und war fassungslos, weil sie die Schublade gestohlen hatte. Sie sagte: »Wirst du endlich den Mund halten?« und schlug mir ins Gesicht, und von da an lief alles falsch.
Southern Pacific Railroad, Spokane – El Paso
Außer einer Koje an Bord eines Schiffes mitten im Ozean (bei ruhiger See) gibt es keinen schöneren Platz zum Schlafen als die Pritsche eines Pullmanwagens, der sanft über die amerikanische Prärie schaukelt.
Über dem Kopf hängt eine elegante kleine Lampe, die man an- und ausschalten kann, ohne sich aus den groben warmen Decken wickeln zu müssen. Unterhalb des Fensters ist ein langer Netzbeutel gespannt, in dem man seine Sachen verstauen kann und immer noch sieht, wo alles ist. Ich bewahrte meine Haarspangen, Schuhe, Buntstifte, Skippy und ein Schwarzes-Peter-Spiel darin auf.