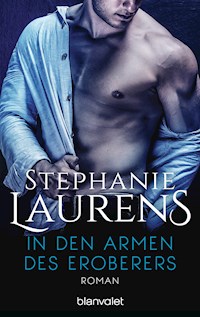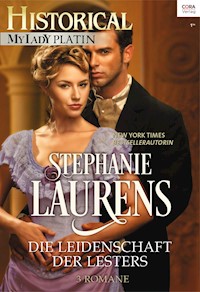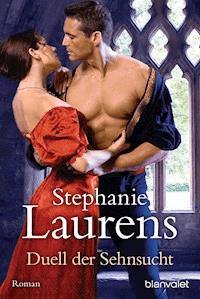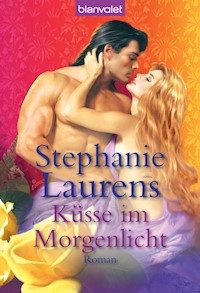Buch
Autorin
Stephanie Laurens schrieb sich, als sie mal nichts zu lesen fand, kurzerhand ihren eigenen ersten Roman. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie aus dem Hobby einen Beruf machte. Sie gehört inzwischen zu den meistgelesenen und populärsten Liebesroman-Autorinnen der Welt. Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne/Australien.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Titel
»A Gentleman’s Honor« bei Avon Books, an imprint of HarperCollinsPublishers, New York.
Deutsche Erstausgabe November 2010 bei
Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Savdek Management PTY Ltd.
Published by Arrangement with Savdek Management PTY Ltd.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Sabine Wiermann
Umschlaggestaltung: © HildenDesign unter Verwendung eines Motivs von Pino Daeni via Agentur Schlück GmbH
lf. Herstellung: sam
ISBN 978-3-641-05157-0V002
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Der Bastion Club
Eine letzte Bastion gegen die Kupplerinnen der Gesellschaft
Christian Allardyce,Marquess of Dearne
Anthony Blake,Viscount Torrington
Jocelyn Deverell,Viscount Paignton
Charles St. Austell,Earl of Lostwithiel
Gervase Tregarth,Earl of Crowhurst
Jack Warnefleet,Baron Warnefleet of Minchinbury
Tristan Wemyss,Earl of Trentham
1
Bastion ClubMontrose Place, London15. März 1816
»Es ist noch ein ganzer Monat, bis die Saison offiziell beginnt, aber die Hyänen haben sich schon wieder zur Jagd zusammengerottet.« Charles St. Austell ließ sich in einen der hochlehnigen Stühle um den Mahagonitisch im Versammlungsraum des Bastion Clubs sinken.
»Wie wir es vorhergesagt haben.« Anthony Blake, der sechste Viscount Torrington, nahm ihm gegenüber Platz.
»Der ganze Trubel auf dem Heiratsmarkt grenzt schon fast an Hysterie.«
»Hast du davon schon etwas zu spüren bekommen?« Deverell setzte sich neben Charles.
»Ich muss zugeben, ich warte noch den rechten Moment ab und halte mich so lange bedeckt, bis die Saison richtig losgeht.«
Tony verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Meine Mutter mag zwar vielleicht in Devon leben, aber sie hat einen würdigen Statthalter in meiner Patentante Lady Amery. Wenn ich mich auf ihren Gesellschaften nicht wenigstens kurz blicken lasse, kann ich mich darauf verlassen, am nächsten Morgen eine scharf formulierte Nachfrage zu erhalten, weshalb ich ferngeblieben sei.«
Die anderen lachten – schicksalsergeben, zynisch oder mitfühlend -, während sie Platz nahmen. Christian Allardyce, Gervase Tregarth und Jack Warnefleet setzten sich ebenfalls an den Tisch, dann richteten sich aller Augen gleichzeitig auf den leeren Stuhl neben Charles.
»Trentham lässt sein Bedauern ausrichten.« Am Kopf des Tisches gab sich Christian nicht die Mühe, eine ernste Miene zu behalten.
»Zugegeben, er klang nicht wirklich aufrichtig. Er hat geschrieben, er habe heute eine dringendere Verabredung, wünsche uns aber Freude an und Erfolg in unserem Vorhaben. Er rechnet damit, innerhalb einer Woche wieder in der Stadt zu sein und freut sich darauf, uns sechs in der sich abzeichnenden Mühsal nach Kräften beizustehen.«
»Wie überaus freundlich von ihm«, spottete Gervase; alle grinsten.
Trentham – Tristan Wemyss – war der Erste von ihnen, dem es gelungen war, das zu erreichen, was sie alle sich vorgenommen hatten. Sie mussten alle heiraten; dieses gemeinsame Ziel war der Grund für diese Idee hier, diesem Club gewesen – die letzte Bastion gegen die ehestiftenden Horden der guten Gesellschaft.
Die sechs, die noch ledig waren, hatten sich hier versammelt, um die letzten Neuigkeiten auszutauschen. Tony war sich sicher, dass er derjenige war, der die größte Verzweiflung verspürte, allerdings konnte er sich selbst nicht erklären, weshalb er sich so rastlos, so frustriert fühlte, als wäre er auf dem Sprung, bereit zum Angriff – jedoch ohne, dass ein Feind in Sicht wäre. So unruhig war er seit Jahren nicht gewesen. Andererseits war er in den vergangenen Jahren ja auch kein Zivilist gewesen oder eben nur ein gewöhnlicher Gentleman.
»Ich schlage vor, dass wir uns alle vierzehn Tage treffen«, erklärte Jack Warnefleet.
»Wir müssen schließlich auf dem Laufenden bleiben.«
»Dem stimme ich zu.« Gervase nickte.
»Und wenn einer von uns irgendetwas Dringendes zu berichten hat, berufen wir ein Treffen außer der Reihe ein. Bedenkt man, mit welchem Tempo sich die Dinge derzeit in der Gesellschaft verändern, sind zwei Wochen die Grenze – bis dahin haben wir eine völlig neue Ausgangssituation.«
»Ich habe gehört, die Hüterinnen von Almack’s spielen mit dem Gedanken, dieses Jahr die Saison vorzeitig zu eröffnen, so groß ist das Interesse.«
»Stimmt es denn, dass man immer noch Kniehosen tragen muss?«
»Sicher. Sonst muss man damit rechnen, dass einem der Einlass verwehrt wird.« Christian hob seine Brauen.
»Allerdings muss ich erst noch herausfinden, weshalb das schlimm sein sollte.«
Die anderen lachten. Sie fuhren fort, Informationen auszutauschen – über gesellschaftliche Ereignisse, die neueste Mode und die angesagten Zerstreuungen – und wandten sich dann Warnungen vor einzelnen Matronen zu, vor heiratswütigen Müttern, allgemein den Drachen des ton sowie den schlimmsten Schreckschrauben und alten Hexen, kurz all denen, die ahnungslosen Junggesellen auflauerten, um sie in die Ehefalle zu locken.
»Lady Entwhistle sollte man unbedingt aus dem Weg gehen – wenn sie einen erst einmal in den Klauen hat, ist es teuflisch schwer, sich daraus wieder zu befreien.«
So versuchten sie mit der schweren Aufgabe fertig zu werden, die vor ihnen lag.
Sie alle hatten die letzten zehn Jahre oder sogar mehr in den Diensten der Regierung Seiner Majestät verbracht – als Agenten mit inoffiziellen Aufträgen, um überall in Frankreich und den angrenzenden Staaten Informationen über feindliche Truppen, Schiffe, Vorräte und Strategien zu sammeln. Sie hatten ihre Berichte an Dalziel geschickt, einen Meisterspion, der irgendwo in den Tiefen von Whitehall hauste, wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes hockte; ihm unterstanden alle englischen Militärspione auf fremdem Boden.
Sie waren überragend gut in ihrer Arbeit gewesen; als Beweis dafür diente allein schon die Tatsache, dass sie alle noch am Leben waren. Jetzt jedoch war der Krieg vorüber und das Zivilistenleben hatte sie eingeholt. Jeder hatte Reichtum, Titel und Ländereien geerbt; alle stammten aus vornehmer Familie, dennoch war ihnen ihr natürliches Umfeld – der elitäre Kreis, zu dem sie von Geburt an Zutritt hatten und an dem teilzuhaben durch ihre Titel und ihren Besitz mitsamt den dazugehörigen Verpflichtungen für sie unumgänglich war – in weiten Gebieten fremd.
Um Informationen zusammenzutragen, sie zu bewerten und zu untersuchen – darin waren sie schließlich Experten – hatten sie den Bastion Club gegründet. Die Absicht war, sich gegenseitig bei ihren einzelnen Vorhaben zu unterstützen und beizustehen. Wie Charles es so dramatisch umschrieben hatte, war der Club ihr sicherer Zufluchtshafen, ihre Ausgangsbasis, von der aus ein jeder sich unter die gute Gesellschaft mischen würde, die Dame, die er heiraten wollte, finden und dann die Stellungen des Feindes im Sturm nehmen und die Auserwählte an sich binden. So lautete der Plan.
Tony nahm einen kleinen Schluck von seinem Brandy und dachte daran, dass er der Erste gewesen war, der erkannt hatte, dass sie eine sichere Zuflucht brauchten. Mit einer französischen Mutter und seiner französischen Patin, die alle, die Lust dazu verspürten, einzuladen schienen, ihm schöne Augen zu machen, war er doppelt gestraft – beide Damen waren sich im Übrigen darüber im Klaren, dass eine solche Taktik die Garantie dafür war, dass er selbst unverzüglich die Initiative ergriff, sich eine Frau zu suchen. Daher hatte er im Freundeskreis hier warnend die Stimme erhoben – die gute Gesellschaft war kein sicherer Ort für Männer wie sie.
Auch in den Herrenklubs waren sie nicht sicher. Verfolgt von vernarrten Vätern und grimmig blickenden Matronen, begraben unter einer wahren Lawine von Einladungen, die täglich bei ihnen eintrafen, war das Leben eines unverheirateten, wohlhabenden und in jeder Hinsicht begehrenswerten Herren mit Titel voller Gefahren.
Zu viele waren auf den Schlachtfeldern auf der spanischen Halbinsel und – noch nicht so lange her – bei Waterloo gefallen.
Die Überlebenden waren angezählt.
Sie waren vielleicht zahlenmäßig unterlegen, aber sie wollten verdammt sein, wenn sie sich einfach überrennen ließen.
Sie waren schließlich Fachmänner im Kampf, in Taktik und Strategie; sie würden nicht einfach erobert werden. Wenn sie in der Sache etwas zu sagen hatten, würden sie die Eroberer sein.
Das war im Grunde genommen der Sinn und Zweck des Bastion Clubs.
»Gibt es noch etwas?« Christian blickte in die Runde.
Alle schüttelten die Köpfe; dann leerten sie ihre Gläser.
»Ich muss mich heute bei Lady Hollands Soirée blicken lassen.« Charles schnitt eine Grimasse.
»Ich nehme an, sie hat das Gefühl, Trentham zur Hand gegangen zu sein, und meint nun, sie müsse ihr Glück an mir ausprobieren.«
Gervase hob die Brauen.
»Und du willst ihr die Gelegenheit dazu bieten?«
Charles, der bereits aufgestanden war, erwiderte seinen Blick.
»Meine Mutter, meine Schwestern und meine Schwägerinnen sind in der Stadt.«
»Oje! Verstehe. Spielen sie mit dem Gedanken, einstweilen hier ihre Zelte aufzuschlagen?«
»Nein, gegenwärtig nicht, aber ich will nicht abstreiten, dass mir der Gedanke gekommen ist, sie könnten auf die Idee verfallen.«
»Ich begleite dich.« Christian ging um den Tisch herum.
»Ich möchte ohnehin mit Leigh Hunt über das Buch sprechen, das er gerade schreibt. Er ist sicherlich in Holland House anzutreffen.«
Tony erhob sich.
Christian sah ihn an.
»Genießt du noch deinen ledigen Familienstand?«
»Ja, dem Himmel sei Dank – meine Mutter ist in Devon.« Er zuckte die Achseln, damit sein Rock richtig saß.
»Meine Patin hat mich aber nach Amery House zu einer Gesellschaft bestellt. Ich werde dort kurz erscheinen müssen.« Er schaute sich um.
»Kommt jemand mit?«
Gervase, Jack und Deverell verneinten. Sie hatten beschlossen, sich in die Bibliothek des Clubs zurückzuziehen und den Rest des Abends in einvernehmlichem Schweigen zu verbringen.
Tony verabschiedete sich; grinsend wünschten sie ihm Glück. Zusammen mit Christian und Charles stieg er die Stufen hinab zur Straße. Auf dem Bürgersteig trennten sie sich. Christian und Charles begaben sich nach Kensington in Richtung Holland House, während Tony den Weg nach Mayfair einschlug.
Unlust hemmte seine Schritte, aber er beachtete das Gefühl nicht weiter. Jeder erfahrene Befehlshaber wusste, dass es Kräfte gab, auf die zu bekämpfen man besser nicht seine Energie verschwendete. So wie Patinnen beispielsweise. Und französische ganz besonders.
»Guten Abend Mrs. Carrington. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen.«
Alicia Carrington lächelte ungezwungen und reichte Lord Marshalsea ihre Hand.
»Mylord, ich denke, Sie erinnern sich noch an meine Schwester Miss Pevensey?«
Da der Blick Seiner Lordschaft bereits auf Adriana ruhte, die wenige Schritte neben ihr stand, war diese Frage hauptsächlich rhetorisch. Seine Lordschaft hatte jedoch offensichtlich entschieden, dass Alicias Unterstützung zu erlangen entscheidend dafür war, Adrianas Hand zu gewinnen. Während er Adriana zunickte, blieb er an Alicias Seite und unterhielt sich beiläufig, ja beinahe abgelenkt mit ihr.
Das lag, entschied Alicia, eindeutig daran, dass Lord Marshalsea so versunken in die Betrachtung ihrer Schwester war, die ihrerseits angeregt mit dem Kreis Bewunderer plauderte, der sich um sie drängte und um ihre Aufmerksamkeit wetteiferte. Adriana war eine echte englische Rose – und sie trug dementsprechend ein rosa Seidenkleid, das allerdings eine Schattierung dunkler war, als sonst bei jungen Damen üblich, damit es ihre üppigen dunklen Locken vorteilhaft betonte. Die schimmerten im Schein der Kronleuchter und bildeten den perfekten Rahmen für ihre bezaubernden Züge, ihre großen braunen Augen unter fein gezeichneten schwarzen Brauen, ihren Pfirsich-mit-Sahne-Teint und die vollen Rosenknospenlippen.
Und Adrianas Figur in dem bewusst einfach geschnittenen Kleid, das mehr andeutete, als herauszustellen, war reizend. Selbst in Sackleinen gewandet würde Alicias Schwester unweigerlich den Herren ins Auge fallen, was der Grund für ihre Anwesenheit hier in London war, mitten in der guten Gesellschaft.
In Verkleidung.
Wenigstens was Alicia anging; Adriana war, wer und was sie zu sein vorgab.
Während sie die angemessenen Antworten auf Lord Marshalseas Bemerkungen gab, beobachtete Alicia genau, wer ihrer jüngeren Schwester den Hof machte. Alles bis zum jetzigen Augenblick war genauso gelaufen, wie sie es geplant hatten, in ihrem kleinen Haus in Little Compton im ländlichen Warwickshire, das zusammen mit den umliegenden paar Morgen alles war, was sie – Alicia, Adriana und ihre drei Brüder – besaßen. Aber selbst mit ihrer zugegebenermaßen blühenden Phantasie hätten sie es sich nicht träumen lassen, dass sich alles – die Umstände, die Leute und die sich bietenden Gelegenheiten – so günstig entwickeln würde.
Ihr Plan, der unbestritten aus der Verzweiflung geboren und daher gewagt war, könnte aufgehen. Aufgehen, indem er ihren drei Brüdern David, Harry und Matthew eine sichere Zukunft eröffnete – und Adriana. Für sich selbst hatte Alicia nicht so weit gedacht; später, nachdem sie sich um ihre Geschwister gekümmert hatte, war immer noch genug Zeit, sich um ihr eigenes Leben Gedanken zu machen.
Lord Marshalsea wurde immer nervöser, Alicia erbarmte sich schließlich seiner und ging mit ihm zu dem Kreis von Adrianas Bewunderern, führte ihn ein und zog sich dann, ganz die perfekte Anstandsdame, wieder zurück. Sie lauschte, hörte zu, wie Adriana die Herren um sich herum mit gewohnter Selbstsicherheit behandelte. Obwohl weder sie noch Adriana über irgendwelche frühere Erfahrung in Gesellschaft verfügten oder mit dem Umgang in den höchsten Kreisen, hatten sie seit ihrem Erscheinen in der Stadt und der Einführung in diese erlauchte Schicht alles ohne die kleinste Unebenheit bewältigt.
Achtzehn Monate gründlichster Recherche und ihr gesunder Menschenverstand hatten ihnen gute Dienste geleistet. Dass sie drei jüngere Brüder hatten, die sie größtenteils selbst großgezogen hatten, hatte ihnen früh jeglichen Hang zu Panik abgewöhnt. Gemeinsam und auch jede für sich waren sie beide an jeder Herausforderung gewachsen und hatten am Ende triumphiert.
Alicia war stolz auf ihre Schwester und sich – und voller Hoffnung, dass ihr Plan wunderbar aufgehen könnte.
»Mrs. Carrington, Ihr Diener.«
Die gedehnt gesprochenen Worte rissen sie aus ihren rosigen Zukunftsträumen. Sie verbarg geschickt ihre mangelnde Begeisterung und drehte sich ruhig um, verzog die Lippen und reichte dem Gentleman die Hand, der sich vor ihr verneigte.
»Mr. Ruskin. Wie schön, Sie hier zu sehen.«
»Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, meine Dame, lassen Sie sich das versichern.«
Ruskin richtete sich auf und bedachte sie bei diesen Worten mit einem beredten Blick und einem Lächeln, das ihr einen warnenden Schauer über den Rücken sandte. Er war ein großer Mann, einen halben Kopf größer als sie, und kräftig gebaut; er kleidete sich gut und hatte das Auftreten eines Gentlemans, aber er hatte etwas an sich, das sie – trotz ihrer Unerfahrenheit – als alles andere als vertrauenswürdig einstufte.
Aus irgendeinem unseligen Grund hatte Ruskin von ihrem ersten Kennenlernen an ein Auge auf sie geworfen. Wenn sie verstünde, warum, hätte sie etwas getan, das zu verhindern; ihre immer rege Phantasie malte ihn als Schlange und sie als hypnotisiertes Opfertier. Sie gab vor, den Ton seiner Aufmerksamkeiten nicht zu verstehen, hatte versucht, ihn zu entmutigen. Als er sie schockiert hatte, indem er ihr ganz unverhohlen eine Carte Blanche anbot, hatte sie so getan, als begriffe sie nicht, was er meinte. Als er später eine Ehe angedeutet hatte, hatte sie sich taub gestellt und von etwas anderem zu sprechen begonnen. Aber alles vergebens: Er suchte dennoch weiter ihre Nähe, wurde immer eindeutiger in seinen Avancen.
Bislang war es ihr gelungen, einen Antrag zu vermeiden – und ihn ablehnen zu müssen. Unter Rücksicht auf ihre Maskerade wollte sie keinen Korb geben, keinerlei Aufmerksamkeit auf sich ziehen; sie wagte es nur, kühl zu bleiben.
Ruskins Blick war über ihr Gesicht geglitten; dann sah er ihr in die Augen.
»Wenn Sie mir die Gunst erwiesen, ein paar Minuten ungestört mit Ihnen sprechen zu können, meine Liebe, wäre ich Ihnen überaus dankbar.«
Er hielt immer noch ihre Finger in seiner Hand. Mit unverbindlicher Miene entzog sie sie ihm und deutete zu Adriana.
»Ich fürchte, mein Herr, dass ich, da meine Schwester unter meiner Obhut ist, mich unmöglich …«
»Ah!« Ruskin schaute zu Adriana, betrachtete die hingerissenen jungen Adligen und vornehmen Jünglinge um sie und Miss Tiverton herum, die Adriana unter ihre Fittiche genommen hatte, was ihr die unsterbliche Dankbarkeit Lady Herfords eingebracht hatte.
»Was ich zu sagen habe, wird, schätze ich, auch für Ihre Schwester wichtig sein.«
Ruskin schaute zu Alicia zurück, fing ihren Blick auf. Sein Lächeln blieb ungezwungen – ein Gentleman, der sich seiner Sache sicher war.
»Allerdings ist Ihre … Sorge verständlich.«
Sein Blick löste sich von ihr, er schaute sich im Saal um, in dem sich die modische Welt versammelt hatte. Lady Amerys Soirée hatte die Crème de la Crème der guten Gesellschaft angelockt; sie waren zahlreich vertreten, unterhielten sich, tauschten die neusten Gerüchte aus, ergötzten sich an den jüngsten Skandalen.
»Vielleicht könnten wir uns an den Rand des Saales zurückziehen?« Ruskin sah ihr wieder ins Gesicht.
»Bei diesem Lärm wird uns niemand hören; wir werden miteinander reden können, und Sie werden Ihre so bezaubernde wie liebreizende junge Schwester … nicht aus den Augen lassen müssen.«
Seine Worte hatten einen unnachgiebigen Unterton; Alicia ließ jeden Gedanken daran, abzulehnen, fahren und neigte zustimmend den Kopf und täuschte Gleichgültigkeit vor; so legte sie ihm die Hand auf den angebotenen Arm und gestattete ihm, sie durch die Menge zu führen.
Welche unwillkommene Herausforderung würde sich ihr nun bieten?
Hinter ihrem ruhigen Äußeren schlug ihr Herz schneller; ihre Lungen fühlten sich eingezwängt an. Hatte sie sich die Drohung in seiner Stimme nur eingebildet?
Ein Alkoven hinter einem Sofa, auf dem mehrere Witwen saßen, bot eine gewisse Ungestörtheit. Wie Ruskin gesagt hatte, konnte sie Adriana und ihre Bewunderer immer noch sehen. Wenn sie mit gesenkter Stimme redeten, würden noch nicht einmal die Witwen, die sich eifrig Klatschgeschichten erzählten, etwas verstehen können.
Ruskin stellte sich neben sie, schaute über die Menge.
»Ich würde vorschlagen, meine Liebe, dass Sie mich in Ruhe aussprechen lassen – sich alles anhören, was ich zu sagen habe – ehe Sie eine Antwort geben.«
Sie schaute ihn flüchtig an, dann nickte sie steif, nahm ihre Finger von seinem Ärmel und fasste ihren Fächer.
»Ich denke …« Ruskin machte eine Pause, dann fuhr er fort, »ich sollte erwähnen, dass mein Landsitz nicht weit von Bledington liegt – ah, ja, ich sehe, Sie verstehen.«
Alicia bemühte sich, ihr Erschrecken zu verbergen. Bledington lag südwestlich von dem Marktstädtchen Chipping Norton; Little Compton, ihr Heimatdorf, befand sich nordwestlich davon – es konnten nicht mehr als acht Meilen Luftlinie zwischen Little Compton und Bledington sein.
Aber Ruskin und sie waren sich nie auf dem Land begegnet; ihre Familie führte ein bescheidenes, ruhiges Leben, und sie waren bis vor Kurzem nie weiter als Chipping Norton gekommen. Als sie nach London zu ihrer Maskerade aufgebrochen waren, war sie davon überzeugt gewesen, dass niemand in London sie kennen würde.
Ruskin erriet ihre Gedanken.
»Wir sind uns nie begegnet, aber ich habe Sie und Ihre Schwester gesehen, als ich letztes Jahr Weihnachten zu Hause war. Sie beide schlenderten über den Marktplatz.«
Sie schaute hoch.
Er erwiderte ihren Blick und lächelte raubtierhaft.
»Da habe ich beschlossen, Sie zu bekommen.«
Unwillkürlich weiteten sich ihre Augen.
Sein Lächeln wurde leicht verächtlich.
»Wirklich – unglaublich romantisch.« Er schaute zurück zur Menge.
»Ich habe mich erkundigt, worauf mir Ihr Name genannt wurde – Miss Alicia Pevensey.«
Er machte eine Pause, dann zuckte er die Achseln.
»Wenn Sie nicht nach London gekommen wären, wäre gewiss nichts daraus geworden. Aber Sie sind nun einmal hier, nur wenige Monate später – als Witwe, angeblich seit mehr als einem Jahr. Ich habe mich keinen Moment täuschen lassen. Ich verstehe Ihre Beweggründe für das Täuschungsmanöver, ja, ich bewundere sogar Ihren Mut, die Sache durchzuziehen. Es war ein gewagter Zug, aber einer mit Chancen auf Erfolg. Ich habe keinen Grund gesehen, etwas anderes zu tun, als Ihnen Glück zu wünschen bei Ihrem Unterfangen. Während meine Bewunderung für Ihre Klugheit wuchs, nahm auch mein Interesse an Ihnen auf einer persönlicheren Ebene zu.«
»Allerdings« – seine Stimme wurde härter – »haben Sie, als ich Ihnen meinen Schutz anbot, abgelehnt. Nach kurzer Besinnung beschloss ich, das Ehrenhafte zu tun – und habe um Ihre Hand angehalten. Wieder jedoch wiesen Sie mich ab – weshalb, kann ich nicht ahnen. Sie scheinen keine Neigung zu verspüren, einen Ehemann zu finden, sondern damit zufrieden zu sein, zuzusehen, wie ihre Schwester ihre Wahl trifft. Es ist anzunehmen, dass Sie – da Sie augenscheinlich nicht in Finanznöten stecken – sich mit Ihrer eigenen Entscheidung Zeit lassen wollen.«
Sein Blick kehrte zu ihrem Gesicht zurück.
»Ich würde sagen, meine liebe Mrs. Carrington, dass Ihre Zeit abgelaufen ist.«
Alicia kämpfte die Schwäche nieder, den Schwindel, der drohte; der Raum schien sich zu drehen. Sie holte tief Luft, dann fragte sie mit bewundernswert ruhiger Stimme:
»Was, genau, meinen Sie?«
Seine Miene blieb eindringlich.
»Ich meine, dass Ihre Vorstellung als feine Witwe, die hochnäsig meinen Antrag ablehnt, so überzeugend war, dass ich meine Informationen noch einmal überprüft habe. Heute habe ich einen Brief von dem alten Dr. Lange erhalten, in dem er mir versichert, die Pevensey-Schwestern – beide Schwestern – seien noch unverheiratet.«
Der Raum schwankte, der Boden hob sich, kam dann mit einem Ruck zum Stillstand.
Die Katastrophe starrte ihr ins Gesicht.
»Genau.«
Ruskins Raubtierlächeln drängte sich wieder in den Vordergrund, aber seine Verachtung blieb sichtbar.
»Aber keine Sorge – nachdem ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es eine ausgezeichnete Idee wäre, Sie zu heiraten, hat nichts von dem, was ich erfahren habe, mich zum Umdenken bewogen.«
Sein Blick wurde schärfer.
»Lassen Sie uns klare Worte finden. Meine liebe Mrs. Carrington kann nicht weiter in der guten Gesellschaft verkehren, aber wenn Sie einwilligen, Mrs. William Ruskin zu werden, sehe ich keinen Grund, weshalb je jemand erfahren sollte, dass es Mr. Carrington nie gegeben hat. Ich wiederhole meinen Heiratsantrag. Wenn Sie annehmen, gibt es keinen Anlass zur Sorge, dass Ihr Plan, die reizende Adriana möglichst vorteilhaft unter die Haube zu bringen, auch nur ins Stocken gerät.« Sein Lächeln verblasste; er erwiderte immer noch ihren Blick.
»Darf ich davon ausgehen, dass ich mich klar und deutlich ausgedrückt habe?«
Ihr Triumphgefühl von vorhin war zu Asche verbrannt; ihr Mund war trocken. Sie befeuchtete die Lippen und bemühte sich um einen gleichmäßigen Tonfall.
»Ich glaube, ich verstehe Sie bestens, mein Herr. Dennoch … Ich fürchte, ich muss mir ein wenig Bedenkzeit ausbedingen.«
Seine Brauen hoben sich; sein wenig vertrauenswürdiges Lächeln kehrte zurück.
»Natürlich. Sie haben vierundzwanzig Stunden Zeit – es gibt schließlich nicht allzu viel zu bedenken.«
Sie atmete scharf ein, versuchte sich verzweifelt zu sammeln, um ihm zu widersprechen.
Aber sein Blick hielt ihren gefangen.
»Morgen Abend können Sie meinen Antrag offiziell annehmen – und morgen Nacht erwarte ich, das Bett mit Ihnen zu teilen.«
Schreck lähmte sie, ließ sie erstarren. Sie schaute ihm forschend in die blassen Augen, fand aber keinen Hinweis auf irgendein Gefühl, an das es sich zu appellieren lohnte.
Als sie keine Antwort gab, verneigte er sich geziert. »Ich werde morgen Abend um neun bei Ihnen vorstellig werden.«
Damit drehte er sich um und ging, verschmolz mit der Menge.
Alicia stand wie erstarrt, ihre Gedanken ein wildes Durcheinander. Ihre Haut fühlte sich eiskalt an, ihr Magen seltsam hohl.
Lautes Gelächter war aus den Reihen der Witwen zu hören; ohne Erfolg versuchten sie, es zu dämpfen. Es holte Alicia in die Wirklichkeit zurück. Sie schaute durch den Raum zu Adriana. Ihre Schwester behauptete sich mühelos, hatte aber ihre Abwesenheit bemerkt. Ihre Blicke trafen sich, doch als Adriana fragend eine Braue hob, schüttelte Alicia nur kaum merklich den Kopf.
Sie musste sich fassen, den verlorenen Boden zurückgewinnen – ihren Plan, ihr Leben wieder unter Kontrolle bringen. Ruskin heiraten oder … Sie konnte es kaum denken.
Schwäche hielt sie weiter gefangen, in der einen Minute war ihr heiß, in der nächsten kalt. Sie sah einen Lakaien vorbeikommen und erbat ein Glas Wasser. Er brachte es ihr sofort, betrachtete sie aber argwöhnisch, als fürchtete er, sie könne ohnmächtig werden. Sie rang sich ein müdes Lächeln ab und bedankte sich bei ihm.
Ein Stuhl stand zwei Meter entfernt an der Wand, sie ging hin und setzte sich, trank von ihrem Wasser. Nach wenigen Minuten öffnete sie ihren Fächer und wedelte sich kühle Luft zu.
Sie musste überlegen. Adriana war für den Augenblick sicher …
Sie schob alle Gedanken an Ruskins Drohung beiseite und konzentrierte sich auf ihn, auf das, was er gesagt hatte – was sie wusste und was nicht. Warum er so handelte, wie er es tat, welche Einsichten ihr das vermittelte, wie sie ihn am besten dazu bringen konnte, seine Meinung zu ändern.
Sie – Adriana, die drei Jungs und sie selbst – waren verzweifelt darauf angewiesen, dass Adriana eine gute Partie machte. Nicht nur mit irgendeinem Herrn, sondern einem von Rang und Vermögen – und mit einem gütigen Wesen, gütig genug, ihnen nicht nur die Täuschung zu verzeihen, sondern auch den Jungs eine Schulausbildung zu ermöglichen.
Sie waren praktisch so mittellos, dass sie nur eine Haaresbreite von echter Armut trennte. Sie waren von guter Herkunft, hatten aber keine familiären Verbindungen oder Beziehungen; es gab nur sie fünf – oder genauer Alicia und Adriana, um sich um sie zu kümmern. David war erst zwölf Jahre alt, Harry zehn und Matthew acht. Ohne Schulbesuch hatten sie keine Zukunft.
Adriana musste die Chance erhalten, so vorteilhaft zu heiraten, wie sie es ihr alle zutrauten. Sie war atemberaubend schön; die gute Gesellschaft hatte ihr bereits inoffiziell den Titel »Diamant reinsten Wassers« verliehen. Sie würde ein Erfolg sein, der ihre kühnsten Träume überstieg; sobald die Saison an Schwung gewonnen hatte, konnte sie ihre Wahl unter den reichen Herren treffen, und sie war trotz ihres jungen Alters klug genug, mit Alicias Hilfe die richtige Entscheidung zu fällen.
Ein Gentleman würde der Richtige für sie sein, für sie alle, und dann wäre die Familie – Adriana und die drei Jungen – in Sicherheit.
Alicia hatte kein anderes Ziel; das hatte sie seit achtzehn Monaten nicht, seit ihre Mutter gestorben war. Ihr Vater war schon Jahre davor einem Leiden erlegen, hatte die Familie mit spärlichen finanziellen Mitteln und nur wenig Landbesitz zurückgelassen.
Sie hatten alles zusammengekratzt, geknausert und gespart, und dann alles auf diese eine Karte gesetzt, die das Schicksal ihnen in die Hände gespielt hatte, indem es Adriana unvergleichliche Schönheit verliehen hatte. Um das zu erreichen, hatte Alicia etwas getan, was sie sonst nie getan hätte – und bislang gewonnen.
Sie war Mrs. Carrington geworden, eine wohlhabende modische Witwe, die perfekte Anstandsdame, um Adriana in die gute Gesellschaft einzuführen. Eine echte Anstandsdame einzustellen, hatte außer Frage gestanden – sie hatte nicht nur das Geld nicht, es waren auch völlig andere Voraussetzungen, wenn eine reiche Witwe ihre jüngere Schwester begleitete, als wenn zwei Jungfern vom Lande unter der Obhut einer bezahlten Anstandsdame auftraten, deren Status nur auf sie zurückgefallen wäre.
Mit ihrer Maskerade hatten sie bislang jede Hürde mühelos genommen und hatten erfolgreich ihren Platz in den Reihen der vornehmen Welt gefunden. Erfolg blinkte lockend am Horizont, alles ging so gut …
Es musste einen Weg geben, Ruskin und seine Drohung zu umgehen.
Sie konnte ihn heiraten, aber der Ekel, der sie bei dem Gedanken erfasste, ließ sie das nur als allerletzte Möglichkeit in Erwägung ziehen; sie würde daran erst denken, wenn es wirklich keinen anderen Weg mehr gab.
Eine Sache, die Ruskin gesagt hatte, fiel ihr wieder ein. Er dachte, sie hätte Geld. Er hatte herausgefunden, dass sie nie verheiratet gewesen war, aber er hatte nicht erfahren, dass sie praktisch bettelarm war.
Was, wenn sie es ihm sagte?
Würde das einen Unterschied für ihn machen? Ihn dazu bewegen, seinen Plan zu ändern, oder ihm schlicht nur eine neue Waffe in die Hände spielen? Wenn er erführe, dass sie nichts besaß und nur Kosten und Verpflichtungen in die Ehe mitbrachte, würde er da nicht einfach beschließen, sie nicht zu heiraten und nur zu seiner Mätresse zu machen?
Bei der Vorstellung wurde ihr übel. Sie trank den Rest ihres Wassers, dann stand sie auf und stellte das Glas auf ein nahes Sideboard. Dadurch drehte sie sich genau in dem Augenblick zum Raum hin um, in dem Ruskin durch die Glastür nach draußen trat.
Sie bewegte sich durch die Menge und schaute genauer hin. Die Tür blieb einen Spalt breit offen stehen, sie führte auf einen Balkon oder eine Terrasse.
Die Tatsache, dass sie ihn an einen Ort hatte gehen sehen, der ihnen größere Ungestörtheit bieten würde, bekräftigte sie in ihrem Entschluss; sie würde ihm nachgehen und mit ihm sprechen. Trotz seines unseligen Wunsches, sie »zu bekommen«, konnte es vielleicht doch noch etwas anderes geben, was er im Gegenzug für sein Schweigen akzeptieren würde.
Es war auf jeden Fall einen Versuch wert. Sie hatte Bekannte mit Geld, die sie – wenigstens glaubte sie das – um Hilfe bitten konnte. Und auf jeden Fall würde sie versuchen, sich wenigstens mehr Zeit auszubedingen.
Sie bahnte sich einen Weg durch die Menge und stellte sich neben Adriana.
Mit einem Lächeln zu den Herren drehte die sich zu ihr um.
»Was ist los?«
Alicia wunderte sich einmal mehr über die Fähigkeit ihrer Schwester, sie zu durchschauen.
»Nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. Ich erzähle es dir später. Ich werde auf die Terrasse gehen, um mit Mr. Ruskin zu reden, und bin gleich wieder zurück.«
Der Ausdruck in Adrianas Augen verriet, dass sie eine ganze Reihe Fragen hatte, aber akzeptierte, dass sie sie jetzt nicht stellen konnte.
»In Ordnung, aber sei vorsichtig. Er ist eine Kröte – wenn nicht schlimmer als das.«
»Mrs. Carrington, werden Sie und Miss Pevensey die Premiere im Theatre Royal besuchen?«
Der junge Lord Middleton war so eifrig wie ein junger Spaniel; Alicia gab eine unverbindliche Antwort und wechselte noch ein paar Bemerkungen mit den anderen, dann entfernte sie sich von der Gruppe und ging zu den Terrassentüren.
Wie sie angenommen hatte, gelangte man durch die Tür auf eine Terrasse, die etwas höher lag als die Gärten hinterm Haus. Die Türen standen offen, um Luft in den überfüllten und überhitzten Empfangssalon zu lassen; sie schlüpfte hindurch und zog sie hinter sich fast zu, dann schlang sie sich den Schal um die Schultern und sah sich um.
Es war Mitte März und kühl; sie war froh über ihren Schal. Es war keine große Überraschung, dass sonst niemand einen Spaziergang durch den frostigen Garten machte. Sie blickte sich um, erwartete, Ruskin zu sehen, wie er sich vielleicht ein Zigarillo gönnte, aber die in Schatten getauchte Terrasse war leer. Sie schlenderte zur Balustrade und schaute in den Garten. Kein Ruskin weit und breit. Hatte er die Soirée auf diesem Wege verlassen?
Sie schaute den Weg entlang. So wie er verlief, schien er zu einer Gartentür zur Straße zu führen.
Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr.
Sie sah genauer hin und erkannte einen manngroßen Umriss in dem Dunkel unter einem riesigen Baum am Rand des Weges. Der Baum war hoch und breit, und der Schatten darunter dunkel, aber sie hatte den Eindruck, als hätte der Mann sich hingesetzt. Vielleicht war da eine Bank, und Ruskin wollte dort verweilen, rauchen oder nachdenken.
Über die nächste Nacht.
Bei der Vorstellung versteifte sie sich. Sie zog ihren Umhang fester um sich und stieg entschlossen die Stufen hinab, schickte sich an, dem Weg zu folgen.
Mit jedem Schritt, den Tony die Park Street entlangging, nahm seine Unlust zu, die Abendgesellschaft seiner Patentante zu besuchen und mit einer Schar alberner junger Mädchen zu plaudern, ihnen Komplimente zu machen, jungen Dingern, mit denen er garantiert nichts gemein hatte – und die, wenn sie wüssten, was für ein Mann er in Wahrheit war, in Ohnmacht fallen würden. Genau genommen drohte ihn angesichts des ganzen verflixten Vorhabens beinahe so etwas wie Mutlosigkeit zu überkommen.
Nicht in seinen wildesten Träumen konnte er sich vorstellen, eine der jungen Damen zu heiraten, mit denen man ihn bislang bekannt gemacht hatte. Sie waren … zu jung. Zu unschuldig, zu unberührt vom Leben. Er verspürte keinerlei Verbindung mit ihnen.
Die Tatsache, dass sie – und zwar jede Einzelne – seinen Antrag überglücklich annehmen würden, wenn er sich entschloss, einer von ihnen einen zu machen, und sich zudem glücklich schätzen würden, weckte in ihm ernsthafte Zweifel an ihrer Intelligenz. Er war kein einfacher Mann und war es auch nie gewesen. Ein Blick müsste das jeder vernünftigen Frau verraten. Und er würde auch kein einfacher Ehemann sein. Die Stellung seiner Frau war so, dass sie ihrer Inhaberin eine Menge abverlangen würde, ein Aspekt, von dem die süßen jungen Dinger nicht den blassesten Schimmer zu haben schienen.
Seine Ehefrau …
Vor noch nicht allzu vielen Jahren hatte der Gedanke daran, eine Frau finden zu wollen, ihn in Gelächter ausbrechen lassen. Er hatte sich immer vorgestellt, dass eine Frau zu suchen, etwas sein würde, das ihn nicht sonderlich in Anspruch nehmen würde – wenn er heiraten musste, würde die richtige Dame irgendwie einfach da sein, wundersamerweise auf ihn warten.
Er hatte da noch nicht begriffen, wie wichtig, von wie weitreichender Bedeutung sie in seinem Leben sein würde.
Jetzt war er mit der Notwendigkeit einer Ehefrau konfrontiert – und noch notwendiger war es, auch die Richtige zu finden – aber die hatte bislang keinerlei Hang verraten, sich blicken zu lassen. Er hatte keine Ahnung, wie sie aussah, wie sie war oder welcher Aspekt ihres Wesens der entscheidende Hinweis sein würde – genau das entscheidende Element, das er brauchte, auf das er wartete.
Er wollte eine Ehefrau. Die Rastlosigkeit, die seine Seele auszufüllen schien, ließ keinen Zweifel daran aufkommen, aber was genau er sich wünschte, ganz zu schweigen davon, weshalb … das war der Punkt, an dem er auf Grund gelaufen war.
Das Ziel identifizieren – die erste Regel für einen erfolgreichen Ausfall.
Bis er damit Erfolg hatte, konnte er mit seiner Kampagne nicht beginnen; und das ärgerte ihn, nährte seine andauernde Ungeduld. Eine Frau zu finden war zehnmal schlimmer, als Spione zu jagen je gewesen war.
Seine Schritte hallten auf dem Pflaster. Andere waren in einiger Entfernung zu hören. Seine Zeit als Agent der Krone lag noch nicht so lange zurück – er blickte unwillkürlich auf.
Durch die Nebelschwaden, die über der Straße waberten, sah er einen Mann, gehüllt in Umhang und Hut, einen Stock in der Hand, aus dem Gartentor von … Amery House kommen. Der Mann war zu weit entfernt, um ihn erkennen zu können, und er ging rasch in die entgegengesetzte Richtung davon.
Das Haus von Tonys Patentante stand an der Ecke von Park Street und Green Street, mit dem Eingang zur Green Street. Das Gartentörchen führte auf einen Weg zu der Terrasse am Empfangssalon.
Inzwischen war die Soirée bestimmt in vollem Schwunge. Der Gedanke an die hellen Frauenstimmen, das schrille Lachen und das Kichern, die abwägenden Blicke der Matronen, die Berechnung in so vielen Blicken, hatte eine niederdrückende Wirkung auf ihn.
Zu seiner Linken kam das Gartentörchen näher. Die Versuchung, diesen Weg zu nehmen, in den Salon zu schlüpfen, ohne sich formal ankündigen zu lassen, sich unter die Leute zu mischen und sich rasch einen Überblick über die anwesenden Debütantinnen zu verschaffen, um dann gegebenenfalls den Rückzug anzutreten, noch bevor seine Patin wusste, dass er da war, wuchs und … siegte.
Er schloss seine Hand um die Klinke aus Gusseisen und drückte sie. Das Tor schwang geräuschlos auf; er trat hindurch und schloss es leise wieder hinter sich. Durch den stillen Garten im Schatten der hohen alten Bäume drang gedämpftes Stimmengewirr und Gelächter zu ihm.
Sich im Geiste für das Bevorstehende wappnend holte er tief Luft, dann stieg er rasch die steilen Stufen empor, die in den Garten führten.
Er bewegte sich gewohnt leise.
Die Frau, die neben dem Mann auf dem Boden kauerte, hörte ihn nicht. Der Mann lag ausgestreckt auf dem Rücken, die Schultern an den Stamm des größten Baumes gelehnt. Er rührte sich nicht.
Diese Szene bot sich Tonys Blick, als er die Stufen emporgestiegen war. Hellwach und mit jäh geschärften Sinnen blieb er stehen.
Sie war schlank und rank, trug ein seidenes Abendkleid und hatte die dunklen Haare hochfrisiert; um ihre Schultern hatte sie einen silbrigen Schal geschlungen, den sie vorne fest zusammenhielt, während sie sich ganz langsam aufrichtete. In ihrer anderen Hand hielt sie ein langes Stiletto mit wellenförmiger Klinge, die mit Blut beschmiert war.
Sie hielt den Dolch am Griff, locker zwischen zwei Fingern, die Spitze nach unten gerichtet. Sie starrte die Klinge an, als wäre es eine Schlange.
Ein Tropfen dunkler Flüssigkeit fiel von der Spitze.
Die Dame erschauerte.
Tony machte einen Schritt vor, getrieben von dem unerklärlichen Wunsch, sie in seine Arme zu ziehen; es gelang ihm, sich davon abzuhalten, und so stand er einfach da. Sie musste seine Anwesenheit gespürt haben, denn sie blickte auf.
Ein zartes herzförmiges Gesicht, die Haut weiß wie Schnee, die Augen weit aufgerissen vor Schreck, schaute ihn an.
Dann riss sie sich mit sichtlicher Mühe zusammen.
»Ich denke, er ist tot.«
Ihre Stimme war ausdruckslos, bebte leicht. Sie bekämpfte die Hysterie, die sie zu überwältigen drohte; er war dankbar, dass sie gewann.
Er rang den Drang nieder, sie beschwichtigen, sie schützen zu wollen – ein lachhaft primitives Gefühl, aber unerwartet mächtig, und ging näher zu ihr. Er wendete seinen Blick von ihr ab und schaute den leblosen Mann an, dann griff er nach dem Dolch. Sie überließ ihn ihm mit einem Schauder, nicht nur wegen des Schocks, sondern auch aus Ekel.
»Wo war er?« Er achtete darauf, seinen Ton unpersönlich zu halten, geschäftlich. Er ging neben der Leiche in die Hocke, wartete.
Nach einem Moment antwortete sie.
»In seiner linken Seite. Die Klinge war beinahe ganz herausgerutscht … Ich habe erst gar nicht begriffen …« Ihre Stimme hob sich, wurde dünn … brach dann ganz ab.
Bleib ruhig. Er versuchte, sie allein durch die Kraft seiner Gedanken dazu zu zwingen; eine flüchtige Untersuchung zeigte, dass sie in beiden Punkte recht hatte. Der Mann war tot; er war sauber niedergestochen worden, mit einem einzigen tödlichen Stich von hinten zwischen die Rippen.
»Wer ist das – kennen Sie ihn?«
»Ein Mr. Ruskin – William Ruskin.«
Er schaute sie scharf an.
»Sie haben ihn gekannt.«
Er hatte es nicht für möglich gehalten, aber ihre Augen wurden noch größer.
»Nein!«
Alicia atmete tief ein, schloss die Augen und bemühte sich, ihren Verstand zu benutzen.
»Genau genommen« – sie öffnete die Augen wieder – »schon, aber nicht wirklich, nur flüchtig. Auf der Abendgesellschaft …«
Sie deutete mit der Hand vage in Richtung Haus, holte nochmals Luft und sprach weiter:
»Ich bin nach draußen gegangen, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Kopfschmerzen … niemand war hier draußen. Ich bin ein wenig umhergegangen …« Ihr Blick glitt zu Ruskins Leichnam. Sie schluckte.
»Dann habe ich ihn gefunden.«
Ruskin hatte ihr gedroht, ihren Plan, ja, die Zukunft ihrer Familie in Gefahr gebracht. Er hatte sie erpresst … Und jetzt war er tot. Sein Blut sickerte aus der Wunde und sammelte sich in einer dunklen Pfütze an seiner Seite, es klebte an der Klinge des Dolches, den nun der Fremde hielt. Es war schwierig, alles zu begreifen, zu wissen, was sie fühlte, oder gar, wie sie am besten reagieren sollte.
Der unbekannte Gentleman erhob sich.
»Haben Sie jemanden weggehen sehen?«
Sie starrte ihn an.
»Nein.« Sie blickte sich um, war sich mit einem Mal der Stille der Gärten bewusst. Jäh kehrte ihr Blick zu ihm zurück.
Tony fühlte, was sie dachte, spürte ihre wachsende Angst. Ärgerte sich darüber.
»Nein – ich habe ihn nicht umgebracht.«
Der Ton seiner Worte schien sie zu beruhigen. Die plötzliche Anspannung wich aus ihrem Körper.
Wieder schaute er auf die Leiche, dann zu ihr. Er winkte sie zu sich.
»Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Wir müssen es melden.«
Sie blinzelte, bewegte sich aber nicht.
Er griff nach ihrem Ellbogen. Sie gestattete, dass er ihn nahm, ließ sich widerstandslos von ihm umdrehen und zur Terrasse führen. Ihre Bewegungen waren langsam – sie befand sich noch im Schock. Er sah ihr in das blasse Gesicht, aber die Schatten verhinderten, dass er irgendetwas erkennen konnte.
»Hatte Ruskin eine Frau? Wissen Sie das?«
Sie zuckte zusammen. Er spürte den Ruck, der durch sie ging. Unter halb gesenkten Lidern warf sie ihm einen erschreckten Blick zu.
»Nein.« Ihre Antwort war knapp, ihre Stimme klang angestrengt. Sie schaute wieder nach vorne.
»Nein, er hatte keine Frau.«
Wenn irgendetwas, dann war sie höchstens noch blasser geworden. Er betete nur, dass sie nicht ohnmächtig werden würde, wenigstens nicht, bevor er sie im Saal hatte. Auf der Soirée seiner Patin mit einer ohnmächtigen Dame im Arm zu erscheinen würde gewiss für Aufsehen sorgen – und zwar fast schlimmeres als der Mord.
Sie begann zu zittern, als sie die Stufen hinaufgingen, aber mit grimmiger Entschlossenheit behielt sie die Fassung, was ihm höchste Bewunderung abnötigte.
Die Terrassentüren standen einen Spalt breit offen. Sie betraten den Salon, ohne sonderlich Aufmerksamkeit zu erregen. Endlich waren sie an einem Ort, wo es hell genug war, dass er sie genau sehen konnte. Er betrachtete ihre Züge, die gerade kleine Nase, der ein wenig zu breite Mund, die vollen, verlockenden Lippen. Sie war etwas größer als der Durchschnitt, ihr dunkles Haar hatte sie zu einer Hochfrisur aufgesteckt, was den anmutigen Schwung ihres Halses und ihre zarten Schulterknochen betonte.
Seine Instinkte erwachten vollends; tief in ihm regte sich ein primitives Gefühl. Sexuelle Anziehung war nur ein Teil davon; wieder meldete sich der Drang, sie an sich zu ziehen, sie bei sich zu behalten.
Sie schaute auf, erwiderte seinen Blick. Die Farbe ihrer Augen war eher grün als haselnussbraun, darüber wölbten sich dunkle Brauen – der Ausdruck ihrer Augen war leicht benommen und erschreckt.
Glücklicherweise schien sie nicht in Gefahr zu schweben, einen Schwächeanfall zu erleiden. Er entdeckte einen Stuhl an der Wand und brachte sie dorthin; sie ließ sich erleichtert seufzend darauf nieder.
»Ich muss mit Lady Amerys Butler sprechen. Wenn Sie hier sitzen bleiben, schicke ich Ihnen einen Lakaien mit einem Glas Wasser.«
Alicia hob den Blick zu seinem Gesicht. Zu seinen samtschwarzen Augen, der Sorge, die sie darin las, und der Konzentration, die sie hinter den fein geschnittenen, leicht arroganten Zügen spürte. Es war das schönste und atemberaubendste Männergesicht, das sie je gesehen hatte – er war ohne Zweifel der bestaussehende Mann, der ihr bislang begegnet war: elegant, voll männlicher Anmut und stark. Seiner Stärke war sie sich am deutlichsten bewusst. Als er sie am Arm gefasst hatte und neben ihr gegangen war, hatte sie das Gefühl seiner Stärke mit all ihre Sinnen förmlich aufgesogen.
Während sie ihm in die Augen schaute, bezog sie Kraft aus dieser Stärke, spürte, wie das Entsetzen, das sie draußen gelassen hatten, sich noch weiter zurückzog. Die Realität um sie herum trat wieder in den Vordergrund; ein Glas Wasser, einen Augenblick der Ruhe, um sich zu fassen – dann würde sie es schaffen.
»Wenn Sie … Danke.«
Das »Danke« war für mehr als das Glas Wasser.
Er verbeugte sich, dann drehte er sich um und durchquerte den Raum.
Obwohl er eigentlich keine Lust hatte, sie allein zu lassen, entfernte Tony sich, fand einen Lakaien und schickte ihn mit einer Erfrischung zu ihr, dann ignorierte er die vielen Leute, die versuchten, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und suchte Clusters, den Butler der Amerys. Nachdem es ihm gelungen war, nahm er ihn mit in die Bibliothek und erklärte ihm die Lage, gab ihm die nötigen Anweisungen.
Er war in Amery House regelmäßig zu Besuch gewesen, seit er ein halbes Jahr alt war; die Bediensteten kannten ihn gut. Sie taten, was er ihnen aufgetragen hatte, holten Seine Lordschaft aus dem Kartenzimmer und Ihre Ladyschaft aus dem Salon und sandten einen Lakaien, um die Wache zu unterrichten.
Er war nicht wirklich überrascht von dem Zirkus, der folgte. Seine Patin war nun einmal Französin, und hierin wurde sie von dem Konstabler der Wache unterstützt, ein übergenauer Mensch, der überall Schwierigkeiten sah, wo keine waren. Nachdem er auf den ersten Blick erkannt hatte, was für ein Mensch der Ordnungshüter war, unterließ Tony es, die Anwesenheit der Dame zu erwähnen. Seiner Ansicht nach gab es keinen Grund, sie weiteren und völlig überflüssigen Belastungen auszusetzen. Unter Berücksichtigung der Größe des Toten und der Art und Weise, wie sie den Dolch gehalten hatte, war es schwer, wenn nicht sogar unmöglich, sie ernsthaft als Täterin in Betracht zu ziehen.
Der Mann, den er das Grundstück hatte verlassen sehen, kam viel eher für diese Rolle infrage.
Außerdem kannte er ihren Namen nicht.
Der Gedanke beherrschte ihn, als er schließlich von der Verpflichtung erlöst war, die der Fund eines Ermordeten mit sich brachte, und sich wieder in den Salon begab, nur um festzustellen, dass sie nicht länger da war. Sie saß nicht da, wo er sie zurückgelassen hatte; er durchkämmte alle Räume, aber sie war nicht länger unter den Gästen.
Die Menge hatte sich merklich gelichtet. Zweifellos war sie mit anderen hergekommen, vielleicht sogar mit ihrem Ehemann, und hatte mit ihnen gehen müssen …
Diese Möglichkeit legte seiner Fantasie Zügel an, dämpfte seinen Eifer. Er befreite sich geschickt aus den Fängen einer besonders hartnäckigen Matrone mit zwei Töchtern, die auf der Suche nach einem Gatten waren, betrat die Eingangshalle und ging zur Tür.
Auf den Stufen davor blieb er stehen und holte tief Luft. Die Nacht war frisch; Frost hing scharf in der Luft.
Seine Gedanken kreisten um die Dame.
Er war sich einer gewissen Enttäuschung bewusst. Zwar hatte er gewiss nicht mit Dankbarkeit gerechnet, aber gegen die Gelegenheit, noch einmal in diese großen grünen Augen zu schauen, ohne dass sie vom Entsetzen gezeichnet waren, hätte er gewiss nichts einzuwenden gehabt.
Tief in sie hineinzuschauen, herauszufinden, ob auch ihr Blut schneller durch die Adern geflossen war, ob auch sie Hitze in sich aufwallen gespürt hatte.
In der Entfernung schlug eine Glocke zur Stunde. Er atmete noch einmal tief ein, dann stieg er die Stufen hinunter und ging nach Hause.
Zu Hause war es still und ruhig, ein riesiges altes Gebäude, das er allein mit seiner Dienerschaft bewohnte. Seine Diener gaben sich größte Mühe, jegliche Aufregung von ihm fernzuhalten, die ihn gestört hätte.
Es war daher ein gewaltiger Schock, als er von seinem Kammerdiener, den er zusammen mit seinem Titel von seinem Vater geerbt hatte, durch Rütteln an der Schulter geweckt und davon unterrichtet wurde, dass unten ein Gentleman auf ihn wartete, der mit ihm zu sprechen wünschte, obwohl es erst neun Uhr morgens war.
Nach dem Grund für diesen Wunsch befragt hatte der Gentleman erwidert, sein Name sei Dalziel, und ihr Herr würde ihn ohne Zweifel empfangen wollen.
Tony war davon überzeugt, dass niemand, der noch ganz recht im Kopf war, behaupten würde, Dalziel zu sein, wenn das nicht der Wahrheit entsprach; daher murrte er zwar, erklärte sich aber damit einverstanden, aufzustehen und sich anzuziehen.
Neugier trieb ihn an, nach unten zu gehen; in der Vergangenheit waren er und seine Freunde immer einbestellt worden und mussten warten, bis sie in Daziels Räume in Whitehall vorgelassen wurden. Natürlich war er nicht länger in Dalziels Diensten, aber er hatte das sichere Gefühl, dass das allein nicht dafür verantwortlich sein konnte, dass er zu ihm gekommen war.
Selbst wenn es gerade erst neun Uhr war.
Er betrat die Bibliothek, wohin Hungerford, sein Butler, Dalziel geführt hatte, um zu warten, und das Erste, was ihm auffiel, war der Duft frischen Kaffees. Hungerford hatte dem Gast eine Tasse serviert.
Mit einem Nicken zu seinem Besucher, der aufrecht in einem Lehnstuhl saß, ging er zur Klingelschnur und zog daran. Dann drehte er sich um und stützte sich mit einem Ellbogen auf das Kaminsims, sah Dalziel an und wartete.
»Ich entschuldige mich für die frühe Stunde, aber ich habe von Whitley erfahren, dass Sie gestern Nacht eine Leiche gefunden haben.«
Tony blickte Dalziel in die dunkelbraunen Augen, die halb unter schweren Lidern verborgen lagen, und fragte sich, ob ihm wohl je so ein Vorfall entging.
»Stimmt. Es war allerdings reiner Zufall. Weshalb interessiert es Sie – oder Whitley?«
Lord Whitley war Dalziels Gegenstück im Innenministerium; Tony war einer der wenigen, ja, vermutlich sogar der Einzige aus Dalziels Gruppe gewesen, der je mit Agenten von Whitley zusammengearbeitet hatte. Allerdings hatten sie ein gemeinsames Ziel gehabt: die Mitglieder des Spionagenetzes, das von London aus versuchte, Wellingtons Feldzug zu behindern.
»Das Opfer William Ruskin war Staatssekretär in der Zoll- und Finanzbehörde.« Dalziels Miene blieb ausdruckslos; seine dunklen Augen blieben stets unbeteiligt.
»Ich bin gekommen, um nachzufragen, ob es besondere Umstände gab, von denen ich vielleicht wissen sollte?«
Ein Staatssekretär in der Zoll- und Finanzbehörde; er musste an den Dolch denken, die Waffe eines Auftragsmörders – und Tony war sich nicht länger sicher. Er schaute Dalziel an.
»Ich glaube nicht.«
Er wusste, dass Dalziel sein Zögern bemerkt hatte, doch er wusste auch, dass sein früherer Vorgesetzter seine Einschätzung akzeptieren würde.
Das tat er auch, mit einem Nicken. Er stand auf, schaute Tony in die Augen.
»Wenn sich an der Lage etwas ändert, lassen Sie es mich bitte wissen.«
Mit einem höflichen Neigen des Kopfes ging er zur Tür.
Tony begleitete ihn in die Eingangshalle und überließ ihn einem Lakaien; er selbst kehrte in die Bibliothek zurück und fragte sich, wie er es oft schon getan hatte, wer Dalziel eigentlich war. Gleich und gleich gesellt sich gern, er war sich sicher, dass er vornehmer Abstammung war, das zeigten allein schon seine arroganten Züge, die blasse Haut und das schwarze Haar, aber Tony hatte genug mitbekommen, um zu wissen, dass Dalziel nicht sein Familienname war. Dalziel war ein wenig kleiner und schlanker als die Männer, die unter seinem Befehl standen, alles ehemalige Gardisten, aber er strahlte eine tödliche Zielstrebigkeit aus, die ihn selbst in einem Zimmer voller körperlich größerer Männer als den gefährlichsten erscheinen lassen würde.
Der eine, den ein kluger Mann nie aus den Augen ließ.
Die Tür zur Straße fiel ins Schloss; eine Sekunde später betrat Hungerford mit einem Tablett die Bibliothek, auf dem eine dampfende Tasse Kaffee stand. Tony nahm sie sich dankbar; wie alle hervorragenden Butler schien Hungerford stets zu wissen, was sein Herr wollte, ohne dass man es ihm erklären musste.
»Soll ich dem Koch sagen, dass er Ihr Frühstück schicken soll?«
Er nickte.
»Ja – ich werde danach ausgehen.«
Hungerford fragte nicht nach, sondern zog sich leise zurück.
Tony genoss den Kaffee; er konnte das ungute Gefühl nicht abschütteln, das Dalziels Auftauchen und seine wenigen Worte bei ihm hinterlassen hatten.
Er war zu klug, um die Warnung zu ignorieren oder einfach abzutun, allerdings war er in diesem Fall persönlich nicht betroffen.
Aber sie vielleicht.
2
Er bereute es, sie nicht gleich nach ihrem Namen gefragt zu haben, aber sich über einer Leiche stehend höflich vorzustellen war ihm einfach nicht in den Sinn gekommen. Somit war alles, was er hatte, ihr Aussehen. Die Idee, seine Patentante zu fragen, kam ihm, aber er verwarf sie sogleich wieder; Tante Félicité auf sein Interesse an einem weiblichen Wesen aufmerksam zu machen – und das besonders, wenn er sich nicht sicher war, wo er mit ihr stand – konnte zu nichts Gutem führen. Und zudem konnte es ja sein, dass die Dame mit anderen gekommen war. Dann kannte Félicité sie gar nicht.
Bei seinem Frühstück beschäftigte er sich mit der Frage, wie er sie am besten aufspüren konnte. Der Gedanke, der ihm dabei kam, schien wie ein Geniestreich. Nachdem er sich mit Schinken und Würstchen gestärkt hatte, begab er sich in die Eingangshalle, schlüpfte in den Mantel, den Hungerford bereithielt, und machte sich auf den Weg in die Bruton Street.
Das Kleid der Dame war überaus elegant und stilvoll gewesen; obwohl es ihm zu dem Zeitpunkt nicht wirklich aufgefallen war, hatte er es unbewusst registriert. Es erschien klar und deutlich vor seinem geistigen Auge. Blassgrüne Seide, perfekt geschnitten, um eine schlanke, nicht zu üppige Figur zu betonen; wie der Stoff fiel und der Ausschnitt gearbeitet war, das alles verriet die Hand einer ausgezeichneten Modistin.
Hungerfords Informationen nach beherbergte Bruton Street immer noch die angesagtesten Modesalons der Stadt. Tony begann am einen Ende der Straße und betrat Madame Francescas Salon, verlangte nach Madame selbst.
Madame war zwar entzückt, ihn zu sehen, konnte ihm aber bedauerlicherweise – und sie bedauerte das aufrichtig – nicht helfen.
Diese Antwort erhielt er wieder und wieder entlang der Straße. Als er schließlich zu Madame Franchots Etablissement am anderen Ende der Bruton Street gelangt war, hatte sich Tonys Geduld aufgebraucht. Nachdem er Madames ernste Erkundigungen zum Gesundheitszustand seiner Mutter fünfzehn Minuten lang über sich hatte ergehen lassen, entfloh er, kein bisschen weiser als zuvor.
Er ging langsam die Stufen hinab und fragte sich, wo sonst, zum Teufel, jemand wie »seine« Dame wohl ihre Kleider beziehen konnte. An der Eingangstür des Modesalons angekommen, öffnete er sie.
Und sah sie in Lebensgröße auf der anderen Straßenseite gehen. Also kam sie doch zur Bruton Street.
Sie schritt forsch aus, völlig in die Unterhaltung mit einer echten Schönheit versunken, einer jüngeren Dame, deren Reize selbst für Tonys abgestumpftes Auge unvergleichlich lieblich waren.
Er wartete in der Tür, bis sie weitergegangen waren, dann trat er auf den Bürgersteig und schloss die Tür hinter sich, überquerte die Straße und folgte dem Paar, wobei er sich etwa zwanzig Schritt hinter ihnen hielt. Nicht so dicht, dass die Dame seine Gegenwart spürte oder ihn sehen würde, sollte sie sich einmal umdrehen, aber auch nicht so weit, dass er Gefahr lief, sie aus den Augen zu verlieren, falls sie eines der zahllosen Geschäfte entlang der Straße betreten sollten.
Zu seiner gelinden Überraschung taten die beiden das jedoch nicht. Sie gingen weiter, völlig in ihr Gespräch vertieft; sie erreichten Berkeley Square.
Er folgte ihnen weiter.
»Es gab nichts, was du hättest tun können – er war ja schon tot, und zudem hast du nichts gesehen.« Adriana zählte zum wiederholten Male die Fakten auf.
»Es wäre nichts dadurch gewonnen gewesen, wenn du dich weiter in die Sache hättest hineinziehen lassen.«
»Genau«, pflichtete ihr Alicia bei. Sie wünschte nur, sie könnte die nagende Sorge loswerden, dass sie in Lady Amerys Salon hätte warten sollen, wenigstens bis der Gentleman zurückkehrte. Er hatte bemerkenswert vernünftig und besonnen gehandelt, und sie hätte ihm danken müssen. Dann war da noch die Sorge, dass er am Ende in Schwierigkeiten geraten war, weil er die Leiche gefunden hatte – sie hatte keine Ahnung, wie der korrekte Ablauf bei solchen Vorfällen war, falls es so etwas gab. Doch er war ihr so fähig und selbstsicher erschienen, dass sie sich zweifellos den Kopf über Nichtigkeiten zerbrach.
Sie war immer noch schreckhaft und nervös, was kaum eine Überraschung war, aber sie konnte noch nicht einmal zulassen, dass ein Mord sie von ihrem Plan ablenkte. Zu viel hing von dessen Gelingen ab.
»Ich hoffe nur, Pennecuik kann uns die violette Seide beschaffen – es ist der perfekte Farbton, um unter den anderen Pastelltönen aufzufallen.«
Adriana schaute sie an.
»Ich denke, das Design mit dem geschnürten Oberteil würde dir gut stehen – weißt du, was ich meine?«
Das tat Alicia. Adriana versuchte, sie auf andere Gedanken zu bringen, damit sie sich mit etwas anderem beschäftigte als den Ereignissen von voriger Nacht. Sie kamen gerade von Mr. Pennecuiks Warenhaus, das sich hinter den Modesalons am anderen Ende der Bruton Street befand. Mr. Pennecuik belieferte die Modistinnen mit den besten Stoffen; und inzwischen versorgte er auch Mrs. Carrington aus der Waverton Street mit Stoffen für die eleganten Kreationen, mit denen sie und ihre schöne Schwester Miss Pevensey die Gesellschaften der besten Kreise zierten.
Man hatte eine sehr angenehme Übereinkunft getroffen. Mr. Pennecuik lieferte seine exklusiven Stoffe zu einem überaus günstigen Preis, während sie im Gegenzug allen erzählten, die sich danach erkundigten – was Matronen in Scharen tun würden und dann taten, als sie Adriana sahen -, dass man auf dem besten Material bestehen sollte, wenn man von seiner Modistin das schönste Kleid erhalten wollte; und die Stoffe von Mr. Pennecuik waren fraglos die besten.
Da sie keine Modistin hatte, ging man allgemein davon aus, dass sie eine private Näherin beschäftigte. Die Wahrheit hingegen sah anders aus: Adriana und sie nähten, unterstützt von ihrer alten Amme Fitchett, alle ihre Kleider selbst. Niemand brauchte das jedoch zu wissen, daher waren alle mit dem Arrangement zufrieden.
»Dunkelviolette Verschnürung.« Alicia kniff die Augen zusammen, ließ vor ihrem geistigen Auge das Kleid erstehen.
»Mit Bändern in einem Farbton dazwischen, mit denen der Saum besetzt wird.«
»O ja! Das habe ich an einem Kleid gestern Abend gesehen – es sah atemberaubend aus.«
Adriana plauderte weiter, und Alicia nickte und murmelte etwas Zustimmendes an den richtigen Stellen; in Gedanken aber war sie bei der nagenden Frage, die sie weiterhin belästigte.
Der Gentleman hatte behauptet, nicht der Mörder zu sein. Sie hatte ihm geglaubt – tat das noch – aber wusste nicht, weshalb eigentlich. Es wäre für ihn so leicht gewesen … Er hatte sie auf dem Weg gehört, Ruskin an den Baumstamm gelehnt und sich dann in den Schatten verborgen, gewartet, dass sie die Leiche fand, und war dann vorgetreten, um sie mit dem toten Ruskin zu entdecken. Wenn jemand fragte, war sie der Wahrheit halber verpflichtet zu sagen, dass er erst erschienen war, nachdem sie Ruskin tot aufgefunden hatte.
Bereits erstochen.
Die Erinnerung daran, wie der schmale Dolch aus seiner Brust herausgerutscht war … Sie erschauerte.
Adriana sah sie an, dann drückte sie ihren Arm und trat ein wenig näher.
»Hör auf, daran zu denken.«
»Ich kann nicht.« Es war gar nicht Ruskin, an den sie am meisten dachte, sondern der Mann, der aus den Schatten aufgetaucht war; trotz allem war er es, der sie am stärksten beschäftigte.
Entschlossen richtete sie ihre Gedanken auf den Kern ihrer Sorgen.
»Nach all dem Glück, das wir bis zuletzt hatten, kann ich gar nicht anders, als mich zu sorgen, dass meine Verwicklung in so etwas Schlimmes wie einen Mord bekannt werden wird und unsere Chancen beeinträchtigt.« Sie schaute Adriana an.
»Wir haben so viel darauf gesetzt.«
Adrianas Lächeln war wirklich bezaubernd; sie war keine alberne Miss, sondern ein vernünftiges junges Mädchen, das sich weder von ihren Mitmenschen, noch vom Schicksal einschüchtern ließ.
»Zeig mir einfach, wo, und überlass den Rest mir. Ich versichere dir, ich bin der Sache gewachsen; wenn du magst, kannst du dich an den Rand setzen und zuschauen. Aber ehrlich, ich denke, es ist in höchstem Maße unwahrscheinlich, dass irgendetwas über diesen Mord – und deine Verwicklung darin noch viel weniger – an die Oberfläche dringen wird; man wird natürlich ein ›wie bedauerlich‹ hören, sonst aber nichts.«
Alicia verzog das Gesicht.
»Jetzt aber etwas anderes«, erklärte Adriana.
»Soweit ich es von Miss Tiverton verstanden habe, werden heute Abend andere Gäste bei Lady Mott erwartet. Offenbar hat Ihre Ladyschaft einen großen Bekanntenkreis auf dem Land. Da alle dieses Jahr vorzeitig in die Stadt gekommen sind, werden viele davon heute auf dem Ball sein. Ich denke, das Kleid mit den kirschroten Streifen wird für mich das beste sein und vielleicht das in dunklem Pflaumenblau für dich.«
Alicia hörte Adrianas Plänen nur mit halbem Ohr zu. Sie bogen in die Waverton Street ein und gingen zu ihrem Haus.
Von der Straßenecke aus beobachtete Tony, wie sie die Stufen emporstiegen und eintraten, dann ging er daran vorbei. Niemand hätte ihm sein Interesse an den beiden Damen ansehen können.
Am Ende der Waverton Street blieb er stehen, lächelte still vor sich hin und machte sich dann auf den Heimweg.
Von Lady Motts Ball hatte man als »kleiner Sache« gesprochen.