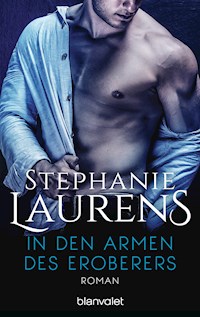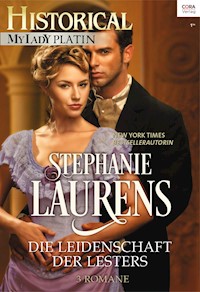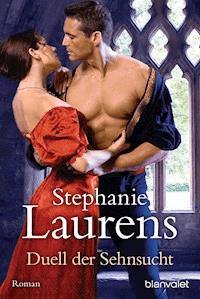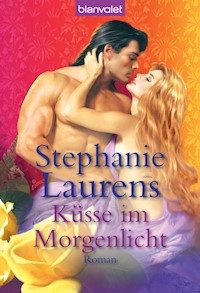4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bastion Club
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein historischer Liebesroman voller Romantik, Witz und prickelnder Erotik
Als frischgebackener Earl of Lostwithiel ist es Charles’ Pflicht, sich endlich eine Ehefrau zu suchen. Doch keine kann es mit der Erinnerung an den unvergesslich sinnlichen Nachmittag mit Penny Selborne vor dreizehn Jahren aufnehmen. In geheimer Mission für die Krone kehrt Charles nach Cornwall zurück – und ertappt Penny dabei, wie sie nachts in Männerkleidung durch sein Haus schleicht. Steckt seine verführerische Jugendfreundin etwa mit den Schmugglern und Spionen unter einer Decke, die er enttarnen soll?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Ähnliche
Buch
Als frischgebackener Earl of Lostwithiel ist es Charles’ Pflicht, sich endlich eine Ehefrau zu suchen. Doch keine kann es mit der Erinnerung an einen unvergesslich sinnlichen Nachmittag, den er vor dreizehn Jahren mit der schönen Penny Selborne erlebte, aufnehmen. Enttäuscht nimmt er einen Auftrag der Krone als Anlass, nach Cornwall auf sein Schloss zurückzukehren, um eine geheime Mission zu erfüllen – und ertappt ausgerechnet die hinreißende Penny dabei, wie sie nachts in Männerkleidung durch sein Haus schleicht. Und sein Herz entbrennt erneut. Aber Penny will nichts mehr von ihm wissen. Aber es ist auch für sie nicht leicht, dem charmanten Charles zu widerstehen, und das obwohl sie einst schwor, ihre Freiheit nur für die einzig wahre Liebe aufzugeben. Charles plagen derweil ganz andere Fragen, vor allem die eine: Steckt seine verführerische Jugendfreundin etwa mit den Schmugglern und Spionen unter einer Decke, die zu enttarnen sein Auftrag ist?
Autorin
Stephanie Laurens begann mit dem Schreiben, um etwas Farbe in ihren wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie ihr Hobby zum Beruf machte. Stephanie Laurens gehört zu den meistgelesenen und populärsten Liebesromanautorinnen der Welt und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne, Australien.
Von Stephanie Laurens bei Blanvalet lieferbar:
Verheißungsvolle Küsse/Der Liebesschwur (Doppelband; 37372) · Verheißungsvolle Küsse (35806) · In den Armen des Eroberers (35838) · Der Liebesschwur (35839) · In den Fesseln der Liebe (36098) · Nur mit deinen Küssen (36490) · Küsse im Morgenlicht (36529) · Verführt zur Liebe (36759) · Was dein Herz dir sagt (36806) · Hauch der Verführung (36807) · Eine Nacht wie Samt und Seide (36808) · Sturm der Verführung (37298) · Im Feuer der Nacht (37376) · Eine skandalöse Versuchung (37448) · Ein verführerischer Schuft (37449) · Stolz und Verführung (37549) · Mein ungezähmtes Herz (37749)
Inhaltsverzeichnis
1
Restormel AbbeyLostwithiel, CornwallApril 1816
Knacks!
Ein Holzscheit zerbrach auf dem Kaminrost; Funken zischten und zerstoben. Flammen loderten auf und sandten schmale Lichtstreifen über die Lederrücken der Bücher in den Regalen, die die Wände der Bibliothek säumten.
Charles St. Austell, Earl of Lostwithiel, hob den Kopf von den Polstern seines Lehnstuhls und vergewisserte sich, dass keine Glut auf das Fell seiner zotteligen Wolfshunde Cassius und Brutus gelangt war. Die beiden lagen wie riesige Pelzhaufen zu seinen Füßen – keiner von ihnen zuckte, von keinem stieg Rauch auf. Beruhigt ließ Charles sich in das abgenutzte weiche Leder zurücksinken, hob das Glas in seiner Hand und trank einen Schluck, um dann wieder in Gedanken zu versinken.
Über das Leben und seine Unwägbarkeiten, seine manchmal unerwarteten Wendungen.
Draußen pfiff der Wind um die hohen Steinmauern, aber gemäßigter als sonst. Die heutige Nacht war verhältnismäßig ruhig, voller Leben und frisch, jedoch nicht aufwühlend wie häufig hier an der südlichen Küste Cornwalls der Fall. Innerhalb der Abbey herrschte schläfrige Stille. Es war nach Mitternacht – außer ihm war kein menschliches Wesen mehr wach.
Es war eine günstige Zeit, um Bilanz zu ziehen.
Er befand sich hier auf einer Mission, sollte herausfinden, ob an der Geschichte etwas Wahres dran war, dass Erkenntnisse des Foreign Office, des Außenministeriums, über hiesige Schmuggelrouten außer Landes gelangt waren. Doch würde ihn das nicht sonderlich beanspruchen und gewiss nicht auf persönlicher Ebene. Als sein früherer Vorgesetzter Dalziel ihn damit betraute, war es für ihn mehr ein Vorwand gewesen, um nach Cornwall in die Abbey zurückzukehren, in das Heim seiner Vorfahren, das nun ihm gehörte. Vor allem hatte er Zeit gewinnen wollen, in Ruhe nachzudenken und eine Lösung für sein Dilemma zu finden, das darin bestand, dass er einerseits dringend eine Ehefrau brauchte, während andererseits sein Glaube zunehmend schwand, dass es ihm noch gelingen würde, die Richtige zu finden.
In London hatte er mehr als genug Kandidatinnen kennengelernt, aber keine von ihnen entsprach auch nur im Entferntesten dem, was er brauchte. Von übereifrigen jungen Mädchen verfolgt zu werden, die mehr Haare als Verstand ihr Eigen nannten und in ihm lediglich einen gut aussehenden und wohlhabenden Adeligen sahen, der zudem als Zugabe noch ein geheimnisvoller Kriegsheld war, diese Vorstellung war für ihn zu seiner persönlichen Version vom Fegefeuer geworden. Er hatte beschlossen, erst dann in die Gesellschaft zurückzukehren, wenn er sich endlich darüber klarwurde, wie seine künftige Gattin beschaffen sein sollte.
Um die Wahrheit zu sagen: Die Heftigkeit seines Wunsches nach einer Ehefrau – und zwar der richtigen – fand er selbst unheimlich. In der ersten Zeit nach der Schlacht von Waterloo gelang es ihm, sich einzureden, dass es ganz normal sei, sich nach einer Frau zu sehnen, zumal in seinem Alter. Außerdem ging es seinen Freunden – insbesondere jenen sechs, die ihm in vielem sehr ähnlich waren – nicht anders, sodass ihn die Geschichte zunächst nicht sonderlich beunruhigte. Gemeinsam gründeten sie den Bastion Club, ihr letztes Bollwerk gegen die heiratswütigen Mütter der guten Gesellschaft, was seine Ungeduld und die Dringlichkeit seines Wunsches für einige Monate linderte.
Aber dann scherten Tristan Wemyss und Tony Blake aus der Junggesellengemeinschaft aus und heirateten, während er mit seinem rastlosen Verlangen, das von Tag zu Tag heftiger zu werden schien, dasaß und immer noch darauf wartete, dass seine Traumfrau erschien.
Deshalb war er nach London übergesiedelt und hatte sich in den Trubel der beginnenden Saison gestürzt. Er wollte endlich wissen, was hinter seinem wachsenden, aber irgendwie undefinierbaren Verlangen steckte. Immerhin waren dreizehn Jahre vergangen, seit er zum letzten Mal an solchen gesellschaftlichen Vergnügungen teilnehmen konnte, denn seitdem hatte er für sein Vaterland auf dem Kontinent gegen den französischen Emporkömmling Napoleon, der sich dann auch noch selbst zum Kaiser ernannte, gekämpft, und zwar auf seine ganz besondere Weise. Immer wachsam, immer auf der Hut, sodass andere Gedanken gar nicht aufkamen. Doch obwohl der Krieg jetzt zu Ende war, merkte er auf Gesellschaften, Bällen und in großen Menschenansammlungen, dass er nicht bei der Sache, sondern geistesabwesend war. Immer noch der Außenstehende, der alles beobachtete und verfolgte, statt sich unbeschwert unter die Menge zu mischen.
Er brauchte eine Frau, die für ihn eine Art Brücke zwischen ihm und seiner Umwelt baute, besonders in Bezug auf die Gesellschaft, zu der er durch Geburt gehörte. Er war immerhin ein Earl mit entsprechenden Verpflichtungen, musste sich überdies um mehrere Schwestern, viele Verwandte sowie Untergebene und Bedienstete kümmern. Unmöglich, sich einfach irgendwo zu vergraben. Das wollte er auch gar nicht, denn ein Einsiedlerleben passte nicht zu seinem Wesen. Eigentlich mochte er gesellschaftliche Zusammenkünfte, Bälle und Tanzen – es gefiel ihm, unter Menschen zu sein, Witze zu hören und Spaß zu haben. Und dennoch fühlte er sich momentan, umgeben von lachenden Menschen in der Mitte eines Ballsaals, wie ein Außenseiter, der vom Rande des Geschehens aus die Vorgänge verfolgte und es nicht fertigbrachte, an den Vergnügungen auch innerlich, mit dem Herzen, teilzunehmen.
Kontakte pflegen und herstellen. Das war die eine wesentliche Fähigkeit, die er von seiner Frau erwartete – in der Lage zu sein, ihn erneut mit seinem Leben zu verbinden. Aber um das zu erreichen, musste er sich zuerst einmal mit ihr verbunden fühlen, und das tat er bei keinem der hübschen jungen Dinger. Bei ihnen gewann er nicht einmal das Gefühl, dass sie ihn überhaupt verstehen wollten oder konnten, und es schien ihm, als bestünde auch kein Interesse, sein innerstes Wesen überhaupt kennenzulernen. Ihre Vorstellung von Ehe spielte sich entschieden im Oberflächlichen ab, was seiner Ansicht nach einer absichtlichen Täuschung gefährlich nahe kam. Nach dreizehn Jahren voller Lügen und Verstellungen wäre es das Letzte zuzulassen, dass sein Leben – sein wahres Leben, das er sich zurückholen wollte – mit etwas Unechtem in Berührung kam.
Den Blick auf die flackernden Flammen im Kamin gerichtet, konzentrierte er sich auf die vor ihm liegende Aufgabe, die richtige Dame zu finden. Im Geiste ließ er mögliche Kandidatinnen Revue passieren, doch keine von ihnen kam ernstlich infrage. Er war es gewohnt, sich rasch ein Bild vom Charakter eines Menschen zu machen, dem er begegnete – meist benötigte er dafür nicht mehr als eine Minute. Weitaus komplizierter war es jedoch zu definieren, welche Eigenschaften die richtige Frau besitzen sollte. Und wenn es darum ging, wo er sie finden konnte, war er gänzlich ratlos. Wenn er sie nicht in London getroffen hatte, wo sollte er dann nach ihr suchen?
Das Geräusch von Schritten, schwach, aber unverwechselbar, drang an sein Ohr.
Er blinzelte, lauschte. Er hatte der Dienerschaft den Abend freigegeben. Sie waren alle längst im Bett.
Stiefel – er war sicher, dass es Stiefel waren, die näher und näher kamen, und zwar von der Rückseite des Hauses. Und als die Schritte die Eingangshalle erreichten, unweit der Bibliothek, wo er saß, wusste er ebenfalls, dass es sich gewiss um niemanden von der Dienerschaft handelte, der da nach Mitternacht durch sein Haus wanderte. Keiner seiner Lakaien ging so selbstsicher und gelassen.
Er schaute zu den Hunden hinüber. Wie er waren sie wachsam, blieben aber entspannt liegen, die hellbraunen Augen auf die Tür gerichtet. Charles spürte, dass sie den Fremden draußen kannten. Sollte er die Bibliothek betreten, würden sie aufspringen und ihn begrüßen – und ihn ansonsten ungehindert passieren lassen.
Im Gegensatz zu ihm wussten Cassius und Brutus, wer der Eindringling war.
Er richtete sich in seinem Sessel auf, stellte sein Glas ab und verfolgte beinahe ungläubig, wie die Schritte des Unbekannten die Halle durchquerten und unbekümmert die Treppe hochstiegen.
»Was zur Hölle?« Er stand auf, betrachtete die Wolfshunde mit gerunzelter Stirn und wünschte sich, er könnte mit ihnen reden. Er deutete mit dem Finger auf sie. »Bleibt!«
Im nächsten Augenblick war er an der Bibliothekstür und öffnete sie vorsichtig, bewegte sich lautlos wie ein Geist.
Lady Penelope Jane Marissa Selborne erreichte gerade das obere Treppenende, lenkte dann, ohne lange nachzudenken, ihre Schritte nach links entlang der Galerie, hielt auf den Flur an deren Ende zu. Die Kerze hatte sie sich gespart – sie brauchte keine, denn in den vergangenen Jahren war sie zahllose Male hier gewesen. Die friedvolle Stille im Haus legte sich wie Balsam auf ihr rastloses, verunsichertes Gemüt.
Was zum Teufel sollte sie nur tun? Oder, genauer, was ging hier vor?
Sie verspürte den Drang, sich mit einer Hand durchs Haar zu fahren, die langen Strähnen zu lösen, die sie zu einem glatten Knoten aufgesteckt hatte, aber sie trug noch ihren breitkrempigen Hut. In Hosen und eine alte Reitjacke gekleidet hatte sie den Tag und den ganzen Abend damit verbracht, heimlich ihrem entfernten Cousin Nicholas Selborne, Viscount Arbry, zu folgen und sein Treiben zu beobachten.
Nicholas war der einzige Sohn des Marquis of Amberly, der nach dem Tod ihres Bruders Granville Wallingham Hall, ihr Zuhause, geerbt hatte, das nur wenige Meilen von hier entfernt lag. Während sie für den Marquis selbst, dem sie ein paarmal begegnet war, Achtung und milde Zuneigung empfand, wusste sie nicht recht, was sie von dem Sohn halten sollte. Seit Nicholas vergangenen Februar ohne Vorankündigung nach Wallingham gekommen war, um sie über Granvilles Gewohnheiten und seinen Umgang auszufragen, hatte sie Verdacht geschöpft. Warum wollte er all das wissen? Doch als Nicholas nach nur fünf Tagen wieder abreiste, hoffte sie, dass damit die Sache erledigt sei.
War sie aber anscheinend nicht, denn seit gestern Abend weilte Nicholas erneut auf Wallingham, wo er den ganzen heutigen Tag damit zugebracht hatte, die verschiedenen Schmugglerhöhlen aufzusuchen, die die Küste säumten. Am Abend war er zwei Stunden in einer Taverne in Polruan gewesen, wie sie von einem nahen Gehölz aus beobachten konnte. Eine Taverne aufzusuchen, das wäre für sie unmöglich gewesen, wenigstens nicht alleine.
Verärgert und in immer größerer Sorge hatte sie gewartet, bis Nicholas wieder herauskam, um ihm dann durch die Nacht zu folgen. Als sie sicher zu wissen glaubte, dass er nach Wallingham zurückkehrte, wendete sie ihre Stute nach Norden, um zur Abbey zu reiten, ihren sicheren Zufluchtsort.
Während des langen Wartens zwischen den Bäumen hatte sie darüber nachgedacht, auf welche Weise sich in Erfahrung bringen ließ, was Nicholas in den Tavernen, die er zu besuchen pflegte, so trieb, aber es gelang ihr nicht, einen Plan zu fassen. Und es wollte ihr auch nichts einfallen, was letztlich dahinterstecken mochte und warum sie Nicholas so sehr misstraute.
Sie schob die quälenden Gedanken beiseite, denn nach dem langen Tag fühlte sie sich müde und erschöpft. So sehr, dass sie kaum denken konnte. Sie beschloss, erst einmal ausgiebig zu schlafen – morgen würde sie dann weitersehen.
Am Ende der Galerie bog sie in den Flur ein. Das zweite Gästezimmer ganz hinten stand immer zu ihrer Verfügung, wenn ihr der Sinn danach stand, ihre Patentante zu besuchen. Das war so seit einem Jahrzehnt, und die Dienerschaft der Abbey richtete mittlerweile alles für den Fall her, dass sie plötzlich auftauchen sollte. Das Bett war stets bezogen, das Holz im Kamin lag bereit.
Sie schaute durch die hohen, vorhanglosen Fenster der Galerie, die auf den Hof mit dem Springbrunnen hinausgingen, und beschloss, heute kein Feuer mehr anzuzünden. Sie war todmüde. Alles, was sie wollte, war, Hosen und Stiefel auszuziehen, Jacke und Hemd abzustreifen und unter die Decke zu kriechen. Schlafen, nur schlafen.
Sie atmete tief durch und drehte sich zur Tür ihres Zimmers um, griff nach der Klinke.
Ein großer Schatten sprang von links auf sie zu.
Panik erfasste sie. Sie schaute hin …
»Aha…«
Dann erkannte sie ihn, wollte eine Hand vor den Mund schlagen, um den Schrei zu ersticken, aber er war schneller. Seine harte Hand presste sich fest auf ihre Lippen.
Einen Moment lang starrte sie in seine Augen, die sie dunkel und unergründlich betrachteten, wenige Zoll von den ihren entfernt. Sie war sich überdeutlich der Hitze seiner Haut an ihren Lippen bewusst.
Da war er, groß und breitschultrig in der Dunkelheit neben ihr. Wenn die Zeit stillstehen konnte, so tat sie es jetzt, in diesem Moment.
Dann kehrte die Realität zurück. Sie versteifte sich, ließ die Hand sinken und wich einen Schritt zurück. Auch er nahm seine Hand weg und ließ sie los, betrachtete aus schmalen Augen forschend ihr Gesicht.
Sie holte tief Luft, schaute ihn weiter an. Ihr Herz schlug immer noch bis zum Hals. »Zur Hölle mit dir, Charles, was zum Teufel soll das heißen, mich derart zu Tode zu erschrecken?« Mit ihm konnte man nur fertigwerden, indem man von Beginn an die Zügel an sich riss und sie nicht wieder hergab. »Wenigstens hättest du mich ansprechen oder einen warnenden Laut von dir geben können.«
Er hob eine Augenbraue, richtete seine Augen auf ihren Hut, musterte sie langsam vom Kopf bis zu den Spitzen ihrer Stiefel. »Mir war nicht klar, dass du es bist.«
Hitze züngelte über ihre kalte Haut. Seine Stimme war dunkel, dazu so tief und so träge, wie sie es in Erinnerung hatte, ungebrochen in ihrer verführerischen Macht, ob er das nun beabsichtigte oder nicht. Etwas in ihrem Innern zog sich zusammen, doch sie beachtete das Gefühl nicht weiter, versuchte nachzudenken.
Die Erkenntnis, dass er der allerletzte Mensch war, den sie hierhaben wollte – innerhalb eines Umkreises von zehn Meilen oder gar mehr –, kam ihr schlagartig und erschütterte sie zutiefst.
»Nun, dem ist aber so. Und jetzt, wenn es dich nicht stört, werde ich mir meinen dringend benötigten Schlaf gönnen.« Sie drückte die Klinke herunter und öffnete die Tür, trat ins Zimmer und schloss sie wieder.
Versuchte es. Die Tür blieb beharrlich einen etwa vier Zoll breiten Spalt offen.
Sie stemmte sich dagegen, dann seufzte sie abgrundtief. Lehnte die Stirn gegen die Tür. Verglichen mit ihm war sie ein Leichtgewicht. Er hielt die Tür mit nur einer Hand auf.
»In Ordnung!« Sie trat zur Seite und warf die Hände in die Luft. »Dann sei eben schwierig«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. So müde, wie sie war, stand sie kurz davor, die Geduld zu verlieren. Sie wusste genau, das war keine gute Voraussetzung, wenn man mit Charles Maximilian Geoffre St. Austell zu tun hatte.
Sie marschierte durchs Zimmer, riss den Hut herunter, setzte sich auf die Bettkante. Mit zusammengezogenen Brauen beobachtete sie, wie er eintrat. Er ließ die Tür halb offen stehen und blickte zu ihr, bevor er sich im Zimmer umschaute.
Er bemerkte ihre Bürsten auf der Frisierkommode, sah zu dem Schrank und die Halbstiefelchen davor und weiter zu dem Bett. Das alles dauerte nicht länger, als er benötigte, um mit sicheren, beinahe arroganten Schritten den Raum zu dem Lehnstuhl am Fenster zu durchqueren. Sein Blick kehrte zu ihr zurück, als er sich hinsetzte. Nicht dass das Wort »setzen« die Bewegung angemessen beschrieb; sein Körper strahlte eine Eleganz und Stärke aus, die unglaublich männlich und selbstsicher wirkte.
Sein schwarzes Haar war lockig. Im Moment trug er es kurz geschnitten, aber dennoch umrahmte es üppig sein Gesicht. Er hatte markante Züge, dunkle Brauen über großen, tief liegenden Augen, eine gerade Nase und ein energisches Kinn sowie Lippen, über die sie besser nicht länger nachdachte.
Für die Dauer von zwei Herzschlägen blieb sein Blick auf ihr ruhen – sie konnte es spüren trotz des schwachen Lichtes. Er hatte immer schon besser im Dunkeln sehen können als sie. Wenn sie diese Befragung überstehen sollte, ohne ihre Geheimnisse preiszugeben, dann würde sie sich fest in der Hand haben müssen.
Die Initiative zu ergreifen schien nur klug.
»Was tust du zu Hause?« Ihre ganze Überzeugung, die Abbey sei ein sicherer Hafen, klang aus diesen Worten, ließ die Frage vorwurfsvoll erscheinen.
»Ich lebe hier, schon vergessen?« Nach einem Augenblick fügte er hinzu: »Genau genommen gehört die Abbey mir, und das ganze Land auch.«
»Ja, aber …« Sie würde nicht zulassen, dass er sich auf die Argumentation verlegte, dass er ihr Gastgeber sei und daher am Ende in irgendeiner Weise verantwortlich für sie. »Marissa, Jacqueline und Lydia, Annabelle und Helen sind nach London gefahren, um dir dabei zu helfen, eine Frau zu finden. Meine Stiefmutter, deine Patentante, und meine Schwestern befinden sich ebenfalls dort. Voller Elan sind sie abgereist, mit geblähten Segeln sozusagen. In den Salons hier und auf Wallingham hat es seit Waterloo kaum ein anderes Gesprächsthema gegeben. Du solltest dort sein, nicht hier.« Sie machte eine Pause, schaute ihn blinzelnd an und fragte: »Wissen sie eigentlich, dass du hier bist?«
Da sie ihn kannte, wusste sie, dass dies die entscheidende Frage war.
Obwohl er sich keine Gefühlsregung anmerken ließ, spürte sie seine Verärgerung, merkte bei seiner Antwort jedoch, dass sie nicht ihr galt.
»Sie wissen, dass ich herkommen musste.«
Musste? Sie rang darum, ihre Betroffenheit zu verbergen. »Warum?«
Sicherlich, sicherlich konnte es nicht sein …?
Charles wünschte sich, es gäbe mehr Licht oder der Stuhl stünde näher am Bett, denn er konnte Pennys Augen nicht richtig sehen und auch ihren Gesichtsausdruck im Dämmerlicht nicht deuten. Er hatte den sicheren Abstand des Lehnstuhls gewählt aus Rücksicht auf sie beide. Der Augenblick im Flur war schlimm genug gewesen und der Drang, sie zu packen, so stark und unerwartet mächtig, dass es seiner ganzen Selbstbeherrschung bedurft hatte, ihm zu widerstehen.
Er fühlte sich immer noch leicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Er würde schön hier sitzen bleiben.
Sie war noch genauso, wie er sie in seiner Erinnerung vor sich sah: groß, schlank und biegsam, eine hellhäutige Elfe, die ihm trotz ihrer äußeren Zartheit immer Paroli geboten hatte. Sie schien sich kaum verändert zu haben, aber er traute dem äußeren Schein nicht wirklich. Auch bei einer Tochter aus besten Kreisen konnten dreizehn Jahre nicht spurlos vorübergehen. Sie musste jetzt neunundzwanzig sein.
Eines merkte er jedoch deutlich: Ihr Verstand war nach wie vor hellwach und messerscharf.
»Ich bin geschäftlich hier.«
»Was für Geschäfte?«
»So dies und das.«
»Wegen des Landsitzes?«
»Ich werde mich aller Sachen annehmen, die auf meinem Schreibtisch landen, während ich hier bin.«
»Aber eigentlich bist du aus einem anderen Grund gekommen?«
Er spürte, dass sich hinter ihren Worten mehr verbarg – dass etwas sie beschäftigte, ja sogar beunruhigte. Sofort waren all seine Instinkte geweckt und sein Argwohn. Er könnte es ihr erzählen, denn niemand hatte ihm die Verpflichtung zum Schweigen auferlegt, und doch zögerte er, es zu tun.
Aber wenn sie fragte, dann war der geradlinigste Weg der, es ihr mitzuteilen und zu sehen, wie sie reagierte. Andererseits interessierte ihn im Moment erheblich mehr, was zum Teufel sie hier mitten in der Nacht trieb. Dazu in Männerkleidern. Warum überhaupt war sie nicht auf Wallingham Hall, das nur knappe vier Meilen entfernt lag? Und wenn er es recht bedachte, warum war sie eigentlich nicht in London oder verheiratet und lebte irgendwo bei ihrem Ehemann? O ja, er wollte Antworten auf all diese Fragen, was bedeutete, dass er näher an sie heranrücken musste, um ihr ins Gesicht sehen zu können, wenn sie zu lügen versuchte.
Ohne Hast erhob er sich. Ohne den Blick von ihr zu nehmen, bemühte er sich, so wenig bedrohlich wie nur möglich zu wirken, und ging zum Bett hinüber. Lehnte sich mit einer Schulter gegen einen der Bettpfosten am Fußende. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. »Ich werde dir verraten, warum genau ich hier bin, wenn du mir im Gegenzug erklärst, warum du dich um diese Stunde und in dieser Aufmachung hier herumtreibst.«
Ihr Griff um die Bettkante festigte sich, doch ansonsten wirkte sie entspannt. Sie erwiderte seinen Blick eine Weile, dann schaute sie zur Tür. »Ich bin hungrig.«
Sagte es, stand auf und ging zur Tür und verschwand auf dem Flur, ohne noch einmal zurückzuschauen.
Um seine Lippen zuckte es, er stieß sich vom Bettpfosten ab und folgte ihr, schloss hinter sich die Tür.
Auf der Treppe holte er sie ein und lief hinter ihr her zur Küche. Sie marschierte hinein und begab sich geradewegs zur Spüle, fasste den Pumpenschwengel und begann einen Wasserkessel zu füllen. Charles trat zum Herd, ging in die Hocke, öffnete die Feuerklappe und rüttelte an dem Rost, bis die Kohlen rot glühten. Dann legte er Zunder auf die Glut und schichtete ein paar Holzscheite darüber. Die ganze Zeit über spürte er förmlich ihre prüfenden Blicke, die sie ihm immer wieder zuwarf, während sie im Raum hantierte.
Sobald das Feuer im Herd hell loderte, schloss er die Klappe und erhob sich. Sie beugte sich vor, stellte den Kessel auf die Platte und eine Teekanne daneben, in die sie mehrere Löffel Teeblätter füllte. Er schaute zum Tisch und bemerkte die Tassen und Untertassen, den Teller mit Mrs. Slatterys Mandelkeksen. Sie wusste genau, wo alles in dieser Küche untergebracht war – besser als er selbst.
Er musterte sie, als er auf den Stuhl am Ende des Tisches sank. Mrs. Slattery, die Köchin der Abbey und gleichzeitig Haushälterin, hätte nie zugelassen, dass sie sich selbst bediente. Was bedeutete, dass Penelope auf eigene Faust herausgefunden hatte, wo sich was befand, vermutlich auf nächtlichen Streifzügen wie diesem hier.
Sie hatte seine Tasse und Untertasse ein Stück von ihrem Gedeck entfernt auf dem Tisch platziert, dazwischen den Keksteller und eine einzelne Kerze, die einen hellen Schein verbreitete. Er zog einen Stuhl wortlos heran – endlich konnte er ihr Gesicht deutlich erkennen.
Sie nahm einen Keks und aß davon, sah ihm in die Augen. »Also, warum bist du hier?«
Er lehnte sich zurück und widerstand fürs Erste den Versuchungen des Kekstellers, musterte sie. Wenn er einfach und ehrlich antwortete, wie standen dann seine Chancen, etwas aus ihr herauszubekommen? »Mein früherer Vorgesetzter hat mich gebeten, mich hier in der Gegend umzusehen und umzuhören.«
Und wie sollte er weitermachen? Er konnte die Frage in ihren graublauen Augen lesen und wunderte sich, dass sie so überaus vorsichtig wirkte.
»Dieser Vorgesetzte …« Sie zögerte, dann fragte sie: »Wo genau hast du gedient, Charles?«
Das wussten nur sehr wenige. »Weder in der Armee noch in der Marine.«
»Welches Regiment?«
»Theoretisch gehörte ich zu den Garderegimentern.«
»Und in Wirklichkeit?«
Wenn er es ihr nicht sagte, würde sie den Rest nicht verstehen.
Sie runzelte die Stirn. »Wo warst du all die Jahre?«
»In Toulouse.«
Sie blinzelte, ihr Stirnrunzeln verstärkte sich. »Bei deinen Verwandten mütterlicherseits?«
Er schüttelte den Kopf. »Die sind außer Landes. Ein Stück weiter südlich von da, sodass mein Akzent und mein Äußeres nicht auffielen, aber weit genug weg, um nicht wiedererkannt zu werden.«
Jetzt verstand sie, begriff nach und nach, was er damit sagte. In ihre Augen trat ein entrückter Ausdruck, ihre Miene wurde ausdruckslos, dann richtete sie jäh ihren Blick auf sein Gesicht, verbarg nicht ihren Schrecken und ihr Entsetzen. »Du warst ein Spion?«
Er hatte sich innerlich gerüstet für diese Frage und blieb scheinbar gleichmütig. »Ein inoffizieller Agent der Regierung Seiner Majestät.«
Der Kessel begann genau in diesem Moment zu pfeifen. Seine Worte hatten gelassen und weltmännisch geklungen, beinahe wegwerfend. Aber mit einem Mal hatte er das Gefühl, dringend einen Schluck Tee zu brauchen.
Sie stand auf, starrte ihn immer noch an, den Mund leicht geöffnet. Ihre Augen waren groß, aber er konnte den Ausdruck darin nicht sehen. Dann drehte sie sich um, nahm den Kessel und goss das kochende Wasser über die Blätter. Sie stellte ihn wieder ab, schwenkte die Kanne und ließ den Tee ziehen.
Als sie sich wieder zu ihm umwandte, glitt ihr Blick über sein Gesicht. Sie rieb ihre Hände über ihre Hosen und setzte sich langsam. Dieses Mal lehnte sie sich vor, das Kerzenlicht erreichte ihre Augen.
»All die Jahre?«
Bis zu diesem Moment hatte er keine Ahnung gehabt, wie sie reagierte, ob sie entsetzt wäre wegen der Ehrlosigkeit, mit der viele die Tätigkeit eines Spions gleichsetzten, oder ob sie verstehen würde.
Sie verstand. Eine schwere Last schien von seinen Schultern genommen. Er atmete ein, zuckte die Achseln. »Jemand musste es tun.«
»Aber von wann an?«
»Ich wurde rekrutiert, sobald ich zur Garde kam.«
»Aber du warst doch gerade erst zwanzig.« Sie klang entsetzt – und sie war es auch.
»Ich war zur Hälfte Franzose, sah fraglos französisch aus und sprach so, als ob ich aus Südfrankreich stammte. Es war also kein Problem.« Er fing ihren Blick auf. »Und ich war mehr als reif, mich in ein verrücktes Abenteuer zu stürzen.«
Er würde ihr nie verraten, dass sie ihren Teil zu dieser Verrücktheit beigetragen hatte.
»Aber …« Sie versuchte, sich einen Reim darauf zu machen.
Er seufzte. »Damals war es noch nicht schwer, nach Frankreich zu gelangen. Binnen weniger Monate lebte ich mit einer falschen Identität als einfacher Geschäftsmann in Toulouse.«
Sie betrachtete ihn argwöhnisch. »Du siehst doch viel zu aristokratisch aus und benimmst dich auch so. Deine Arroganz müsste dich eigentlich jederzeit und überall verraten haben.«
Er lächelte, zeigte dabei seine Zähne. »Ich habe das Gerücht ausgestreut, ich sei der Bastard einer inzwischen ausgestorbenen Familie, auf deren Grab ich nur zu gerne tanzen würde.«
Sie musterte ihn prüfend, dann nickte sie. »In Ordnung. Und dann hast du was getan?«
»Ich habe mich konsequent bemüht, mit jedem militärischen und zivilen Würdenträger auf gutem Fuße zu stehen, und dabei so viele Informationen wie möglich gesammelt.«
Wie genau er das angestellt hatte, das wollte er lieber nicht preisgeben. Zum Glück fragte sie nicht danach.
»Du hast also die Informationen hergeschickt, bist aber selbst dort geblieben. Die ganze Zeit?«
»Ja.«
Sie stand auf, um den Tee zu holen, kehrte zum Tisch zurück und schenkte sich ein. Er beobachtete sie dabei, von der einfachen häuslichen Tätigkeit seltsam berührt. Sie war so abgelenkt, dass sie nichts zu bemerken schien. Als sie sich vorbeugte, um seine Tasse zu füllen, wanderte sein Blick über den Schwung ihrer Hüften, und am liebsten hätte er sie umfasst, doch er hielt sich mit eiserner Entschlossenheit zurück, nickte stattdessen dankend, nahm die Tasse zwischen beide Hände und trank einen Schluck, bevor er weitersprach.
»Sobald klarwurde, dass ich mir problemlos Zutritt zu den höchsten militärischen und gesellschaftlichen Kreisen verschaffen konnte, stand mehr auf dem Spiel. Die Stadt zu verlassen wurde zu riskant. Die Franzosen mussten glauben, dass ich mich ständig dort aufhielt, oder zumindest brauchte ich einen guten Vorwand, wenn ich woandershin wollte. Nicht der leiseste Zweifel durfte aufkommen, dass ich nicht ein ganz normaler französischer Bürger war.«
Sie stellte die Teekanne auf die Spüle und kehrte zu ihrem Stuhl zurück. »Daher bist du also nicht zu James’ Beerdigung gekommen.«
»Es ist mir gelungen, Frankreich zu verlassen und herzureisen, als Papa und Frederick starben, aber zu dem Zeitpunkt, als das Unglück mit James passierte, rückten Wellingtons Truppen gerade heran und standen dicht vor Toulouse. Es war wichtiger denn je zuvor, dass ich vor Ort blieb.« Frederick, sein ältester Bruder, hatte sich das Genick bei einem Reitunfall auf der Jagd gebrochen; James, der Zweitgeborene, war Frederick als Earl nachgefolgt, nur um kurze Zeit später bei einem Bootsunfall zu ertrinken. Charles war der dritte Sohn des sechsten Earl und nun offiziell der neunte Earl of Lostwithiel. Es war einer der üblen Streiche, die das Schicksal ihm gespielt hatte.
Sie nickte; ihr Blick ging in die Ferne. Langsam hob sie ihre Tasse an die Lippen und nippte.
Schließlich sah sie wieder ihn an. »Warst du in Waterloo dabei?«
Er zögerte, aber er wollte die Wahrheit – die ganze Wahrheit – von ihr hören. »Ja, aber hinter den französischen Linien. Ich habe ein paar andere Halbfranzosen angeführt, damit wir uns einer Abordnung aus Toulouse anschließen. Sie haben die Artillerie auf einem Hügel oberhalb des Schlachtfelds bewacht.«
»Du hast den Beschuss eingestellt?«
»Zu dem Zweck waren wir da.«
Ihr Blick blieb fest auf sein Gesicht gerichtet. »Um das Abschlachten der britischen Truppen zu beenden.«
Indem andere abgeschlachtet wurden, dachte er, doch das blieb ungesagt.
»Aber nach Waterloo bist du aus dem Dienst ausgeschieden.«
»Es gab keine weitere Verwendung für uns – für Agenten, wie ich einer war. Außerdem warteten auf mich andere Verpflichtungen.«
Ihre Lippen verzogen sich. »Pflichten, von denen du und alle anderen nie gedacht hätten, dass du sie je würdest übernehmen müssen.«
Allerdings. Der Titel eines Earl war ihm zugefallen, dem wildesten und anscheinend am wenigsten geeigneten der drei Söhne – und zudem dem in keiner Weise auf diese Würde und die damit verbundenen Pflichten vorbereiteten.
Sie betrachtete ihn weiter, und nach einem Moment fragte sie: »Wie fühlt es sich an, Earl zu sein?«
Sie hatte immer schon die verblüffende Fähigkeit besessen, die empfindlichste Stelle zu treffen. »Seltsam.« Er setzte sich auf seinem Stuhl anders hin, starrte in seine halb leere Tasse.
Er war nicht imstande, das Gefühl zu beschreiben, das ihn erfasst hatte, als er vor ein paar Stunden die Eingangsstufen hochgestiegen und durch die imposante Eingangstür getreten war. Der Titel und die Abbey gehörten nun ihm, aber nicht nur sie. Auch die ausgedehnten Ländereien und die Verantwortung, die sie mit sich brachten, waren auf ihn übergegangen. Er hatte das Erbe seiner Familie angetreten, denn die Abbey war nicht nur das Zuhause seiner Kindheit, sondern auch der Sitz seiner Ahnen, der Ort, wo sein Geschlecht verwurzelt war. Und er musste dafür sorgen, dass dies auch so blieb und der Besitz unbeschadet an die nächste Generation weitergegeben werden konnte – nicht nur ungeschmälert, sondern nach Möglichkeit besser, schöner und größer.
Das Gefühl war verlockend wie der Ruf eines Jagdhorns, doch was genau in ihm dadurch geweckt wurde, das blieb nebulös für ihn. Was ihm zunächst auch zweitrangig erschien, denn seine vordringlichste Aufgabe bestand darin, sich eine passende Countess zu suchen und in seiner alten Umgebung wieder heimisch zu werden.
»Es kommt mir immer noch komisch vor, wenn Filchett und Crewther mich mit ›Mylord‹ anreden.« Filchett und Crewther waren seine Butler, der eine hier und der andere in der Stadt.
Charles fand, dass er ihr genug erzählt hatte. Er leerte seine Tasse und wollte mit seinen Fragen beginnen. Doch noch kam er nicht dazu.
»Ich habe gehört, du und ein paar andere, ihr hättet eine Art Club gegründet, um euch gegenseitig bei der Brautschau zu helfen.«
Er starrte sie an. »Warst du kürzlich in London?«
»Seit sieben Jahren nicht.«
Er hatte akzeptiert, dass Dalziel alles über den Bastion Club wusste, aber andere? »Woher, zur Hölle, weißt du das?«
Sie stellte ihre Tasse ab. »Marissa hat es von Lady Amery erfahren.«
Er seufzte. Er hätte nicht vergessen dürfen, dass Tony Blakes Mutter und seine Patin Französinnen waren, Teil des Netzes adeliger Emigranten, die vor dem Terror der Revolution nach England geflohen waren. So wie seine Mutter auch. Er runzelte die Stirn. »Sie hat mir nicht verraten, dass sie es weiß.«
Penny schnaubte wenig damenhaft und stand auf, um die Tassen zu nehmen. »Sie und der Rest sind erst vor vier Wochen in die Stadt gefahren. Wie viel Zeit hast du mit ihr verbracht?«
»Ich war beschäftigt.« Er war dankbar dafür, dass er nicht leicht rot wurde. Denn in Wahrheit hatte er sie absichtlich gemieden – weniger seine Mutter, sondern seine jüngeren Schwestern Jacqueline und Lydia und mehr noch seine Schwägerinnen Annabelle, Fredericks Witwe, und Helen, die mit James verheiratet gewesen war.
Ihre Ehemänner waren ohne männliche Nachkommen gestorben, was sie aus irgendeinem geheimnisvollen Grund zu den leidenschaftlichsten Verfechterinnen der Ansicht gemacht zu haben schien, dass er unbedingt heiraten müsse. Inzwischen waren seine Schwestern von ihrem Eifer angesteckt worden. Jedes Mal, wenn ihn eine der vier sah, ließ sie beiläufig Namen fallen. Er wagte es kaum noch, auszureiten oder im Park spazieren zu gehen – aus Angst, dass sie ihm auflauern und dazu nötigen könnten, mit irgendeinem geistlosen und rückgratlosen Dämchen, das in ihren Augen wie geschaffen für ihn war, Artigkeiten auszutauschen.
Ursprünglich fand er ihre Hilfe gar nicht so unwillkommen, auch wenn er oft genug seine Ablehnung solch weiblicher Unterstützung bekundet hatte, aber dann erkannte er, dass die jungen Damen, die sie ihm vorführten, alle ungeeignet waren – dass es offenbar in ganz London nicht eine gab, die in seinen Augen passend wäre. Aber er wusste nicht, wie er das erklären, wie er sie aufhalten sollte, und konnte sich nicht dazu überwinden, ein einfaches »Nein« zu äußern. Denn im Geiste sah er die Enttäuschung auf ihren Gesichtern, den verletzten Ausdruck in ihren Augen – der Gedanke allein reichte, dass ihm unbehaglich zumute wurde.
»Haben sie dich aus der Stadt vertrieben?« Penny bemerkte, wie er jäh den Kopf hob und seine Augen schmal wurden. Leicht amüsiert erwiderte sie seinen Blick. »Ich habe sie gewarnt – und Elaine und meine Schwestern auch –, aber sie waren so überzeugt davon, genau zu wissen, wer zu dir passt, und dass du dich über ihre Hilfe freuen würdest.«
Er gab einen abfälligen Laut von sich. »Was die schon wissen …«
Sie hakte nach. »Die Saison hat gerade erst begonnen, die allererste Woche – und du bist schon ausgerissen.«
»Allerdings.« Seine Stimme wurde hart. »Genug von mir.« Seine Augen ruhten auf ihrem Gesicht. Sie hätte nicht hinschauen müssen, um zu wissen, dass sie mitternachtsblau, fast schwarz waren. Jetzt ruhten sie auf ihrem Gesicht. »Was hattest du heute Nacht in Männerkleidern draußen zu suchen, zu Pferde nehme ich an?« Mit seinen Augen deutete er auf ihre unkonventionelle Kleidung.
Sie zuckte die Achseln. »Es reitet sich besser so als in Röcken, besonders in der Nacht.«
»Zweifelsfrei. Warum um Himmels willen bist du überhaupt nachts ausgeritten – und offensichtlich weit, wenn du den Herren- dem Damensattel vorziehst.«
Sie zögerte, dann gab sie nach. Das war gefährlich, aber … »Ich bin jemandem gefolgt.«
»Der was getan hat?«
»Das weiß ich nicht, deshalb bin ich ihm ja gefolgt.«
»Wer ist es, und wohin ist er gegangen?«
Sie erwiderte seinen Blick. Es ihm zu verraten, das empfand sie als ein zu großes Risiko, solange sie nicht wusste, weshalb genau er sich hier aufhielt. Besonders nachdem sie die Wahrheit über seine Vergangenheit kannte.
Obwohl das kein sonderlicher Schreck für sie gewesen war, vielleicht nicht einmal eine große Überraschung. Dazu war sie mit Charles früher zu vertraut gewesen … Trotzdem wusste sie nicht, wie weit sie ihm trauen konnte, denn immerhin waren viele Jahre vergangen. »Du hast gesagt, du seiest von deinem ehemaligen Vorgesetzten gebeten worden, dich hier umzusehen. Was für einen ehemaligen Vorgesetzten hat ein früherer Spion?«
»Einen entschlossenen.« Als sie einfach wartete, sprach er widerstrebend weiter: »Dalziel ist ein einflussreicher Mann im Regierungsviertel von Whitehall – was genau seine Position oder seine Aufgabe ist, habe ich nie erfahren. Er hat die Einsätze aller britischen Spione auf feindlichem Boden mindestens in den vergangenen dreizehn Jahren koordiniert.«
»Und auf was sollst du hier achten?«
Er zögerte. Sie konnte sehen, dass er das Risiko abwog, es ihr zu sagen, ihr dieses letzte Stück Information zu geben, das sie brauchte, ohne sich darauf verlassen zu können, es mit derselben Aufrichtigkeit gedankt zu bekommen.
Sie wartete weiter, schaute ihn einfach an.
Ein Muskel in seiner Wange zuckte. Sein Blick wurde kühler. »Es gibt Hinweise, die die Vermutung nahelegen, dass es einen Spion im Foreign Office gab oder noch gibt, der über Jahre während des Krieges Geheimnisse an die Franzosen weitergegeben hat. Und der Verdacht liegt nahe, dass der Weg, den die Informationen genommen haben, irgendwo in der Nähe von Fowey verläuft, höchstwahrscheinlich über eine der Schmugglerbanden, die hier in der Gegend operieren.«
Sie hatte geglaubt, sie könnte es verbergen, und sich so darauf konzentriert, eine unbeteiligte Miene zu zeigen. Doch das leichte Zittern ihrer Hände verriet sie – bevor sie es zu unterdrücken vermochte, fühlte sie schon seinen Blick dorthin wandern.
Dann wandte er die Augen wieder ihrem Gesicht zu. »Was weißt du darüber?«
Sein Tonfall war härter geworden, eindringlicher und zwingender. Sie spielte einen Moment mit dem Gedanken, die Ahnungslose zu spielen, aber das war witzlos bei ihm. Er wusste es, und es gab keine Ausflüchte. Und auch nichts, um ihn abzulenken.
Sie konnte sich höchstens weigern, ihm alles zu sagen, bevor sie nicht Zeit fand, darüber nachzudenken und all die Tatsachen und Beobachtungen zu bewerten. Genau das zu tun, was sie sich eigentlich für morgen vorgenommen hatte.
Sie schaute zu der alten Uhr auf dem Regal über dem Herd, die stetig vor sich hin tickte. Es war weit nach eins. »Ich muss schlafen gehen.«
»Penny.«
Sie schob ihren Stuhl zurück, beging dann den Fehler, aufzuschauen und ihm in die Augen zu sehen. Die Kerzenflamme spiegelte sich in seinen Augen und verlieh seinem Aussehen etwas Teuflisches. Unter halb geschlossenen Lidern fixierte er sie, sein Kinn wirkte wie gemeißelt. Nur seine sanft geschwungenen Lippen minderten diesen Eindruck – stattdessen schienen sie wie geschaffen, Frauen ins Verderben zu locken.
Was seinen restlichen Körper anging, seine breiten Schultern, den schlanken Oberkörper und die muskulösen Arme und Beine, so strahlte er eine Stärke, gepaart mit Eleganz aus, wie sie nur wenige Männer besaßen. Seine Hände waren schmal, die Finger lang und wohl geformt, und das Gesamtpaket reichte aus, einen Engel zum Weinen zu bringen.
Dennoch ging von seiner sinnlichen Ausstrahlung nicht die größte Bedrohung für sie aus. Schlimmer war, dass er sie kannte, und zwar besser als sonst jemand auf der Welt. Diesen Trumpf im Ärmel, den er jederzeit ausspielen konnte – raffinierter als sonst ein Mann –, den fürchtete sie. Es war eine Waffe, die sicherstellte, dass sie sich seinen Wünschen fügte.
Während er dasaß und sie anschaute, nicht mehr tat, als seinen Blick auf ihr ruhen zu lassen, versuchte sie sich vorzustellen, wie sein Leben in den vergangenen dreizehn Jahren ausgesehen haben mochte. Er brauchte ihr nicht zu sagen, dass er die ganze Zeit alleine gewesen war, dass er auf Befehl getötet hatte mit seinen bloßen Händen. Sie wusste, dass er nicht nur die Kraft besaß, so etwas zu tun, sondern auch den Mut und die Entschlossenheit.
Er nannte sie nie Penelope, außer bei offiziellen Anlässen; er sagte Penny im Kreis der Familien. Ganz allein mit ihr hatte er Squib zu ihr gesagt – Fröschlein. Das sagte alles über ihr Kräfteverhältnis. Allerdings drehte es sich hier um etwas anderes, und was Durchsetzungsvermögen und Standhaftigkeit betraf, da war er nicht von vornherein der Überlegene. Schließlich wurde sie früher ganz gut mit ihm fertig.
Sie erwiderte seinen Blick und stand auf. »Ich kann es dir nicht sagen, noch nicht. Ich muss erst in Ruhe nachdenken.« Damit ging sie um den Tisch herum und weiter zur Tür.
Als sie an ihm vorbeikam, drehte er sich um. Sie konnte spüren, wie seine Muskeln sich anspannten, doch er blieb sitzen.
Sie erreichte die Tür und atmete langsam durch.
»Mon ange …«
Sie erstarrte. Er hatte sie erst ein Mal so gerufen. Eine Drohung lag in seinem Tonfall, unausgesprochen, aber unmissverständlich.
Sie wartete einen Herzschlag lang. Als er nicht weitersprach, drehte sie den Kopf in seine Richtung. Er hatte sich nicht bewegt; starrte in die Kerze. Er wandte sich nicht zu ihr um.
Er konnte ihr nicht ins Gesicht schauen …
Der Knoten in ihr löste sich; die Spannung ließ nach. Sie lächelte sanft, wusste, dass er es nicht sehen konnte. »Du kannst dir die Mühe sparen, es ist vergeblich. Ich kenne dich, schon vergessen? Du bist nicht der Typ Mann, der das tun würde.«
Sie wartete noch einen Moment, dann sagte sie leise »Gute Nacht«.
Er antwortete nicht, rührte sich nicht. Sie wandte sich ab und entfernte sich über den Flur.
Charles lauschte ihren verklingenden Schritten und fragte sich, welches böswillige Schicksal beschlossen hatte, dass er sich mit so etwas konfrontiert sah. Er und kein Mann, der eine Dame erpressen würde? Sie hatte ja keine Ahnung. Mehr als zehn Jahre lang war er exakt ein solcher Mann gewesen.
Er hörte, wie sie die Eingangshalle erreichte, und atmete aus, langsam und tief. Sie kannte beileibe nicht nur einen kleinen Teil des Puzzles, sondern hatte weitergehende Informationen. Er vertraute ihrer Intelligenz und war sicher, dass sie nicht überreagierte oder die Geschichte aufbauschte. Aber …
»Verdammt!« Er stieß sich vom Tisch ab, stand auf und kehrte zur Bibliothek zurück und rief Brutus und Cassius zu sich. Dann verließ er mit ihnen das Haus, um auf den Wällen spazieren zu gehen. Hielt das Gesicht in die frische Nachtluft und die kühle Meeresbrise, um die Spinnweben der alten Erinnerungen aus seinem Kopf zu vertreiben. Er konnte es nicht gebrauchen, wenn sie seine Urteilskraft behinderten, besonders jetzt nicht.
Die Erdwälle waren vor langer Zeit um die Abbey herum aufgeschüttet worden und umgaben die Gärten im Süden. Von der breiten grasbewachsenen Kuppe aus konnte man fast den ganzen Mündungsarm des Fowey überblicken. Und an klaren Tagen sah man sogar das Meer, das verlockend in der Ferne glitzerte.
Er schritt aus, versuchte an Alltägliches zu denken, spielte mit den Wolfshunden, die übermütig um ihn herumtollten, mal ein Stück vorausliefen, um eine Spur aufzunehmen, dann wieder an seine Seite zurückkehrten. Seine ersten Hunde hatte er mit acht Jahren bekommen, und beide waren erst im hohen Alter gestorben, ein paar Monate bevor er der Garde beitrat. Nach seiner ersten Heimkehr vor zwei Jahren hatte er diese beiden erstanden, nicht damit rechnend, noch einmal zurückbeordert zu werden. Doch als Napoleon aus Elba geflohen war, musste er zurück auf seinen Posten, und Lydia kümmerte sich um Cassius und Brutus.
Obwohl seine Schwester das liebevoll getan hatte, waren die beiden Rüden mit fliegenden Fahnen wieder zu ihm gewechselt, als er das nächste Mal heimkam. Zu Lydias Enttäusching, aber trotzdem steckte sie den beiden immer noch Leckereien zu.
Was sollte er nur mit Penny anstellen?
Schlagartig konnte er an nichts anderes mehr denken. Er blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken, füllte seine Lungen mit der kühlen, salzigen Nachtluft. Schloss dann die Augen und ließ sich alles durch den Kopf gehen, was er von der erwachsenen Penny wusste – von der Frau, die sie jetzt war.
Bei seiner Ankunft zu Hause hatte seine Mutter ihm ungefragt mitgeteilt, dass sie nicht verheiratet sei, obwohl sie vier überaus erfolgreiche Londoner Saisons hinter sich habe, und überdies als Tochter des verstorbenen Earl über eine ansehnliche Mitgift verfüge. Zwar konnte man Penny nicht gerade als überwältigende Schönheit bezeichnen, doch ihre zarten Züge, die makellose Haut und das lange flachsblonde Haar, dazu die sturmgrauen Augen – das alles zusammen ließ sie mehr als nur einigermaßen hübsch aussehen. Sie war in einer aparten Weise höchst attraktiv. Einen gewissen Makel indes stellte zumindest für einige ihre beachtliche Größe dar, denn sie war nur einen halben Kopf kleiner als er und überragte nicht wenige Männer. Und sie war ziemlich dünn, wobei er lieber von schlank und biegsam sprach, aber manch einem fehlten bei ihr die üppigen, weiblichen Rundungen.
Auch ihre Intelligenz und ihre oft scharfe Zunge waren nicht jedermanns Sache – nicht wenn man auf der Suche nach einer fügsamen Frau war. Ihn störte nichts davon – eigentlich war ihm beides lieber als das Gegenteil –, doch nicht alle Herren schätzten diese Eigenschaften bei ihrer Frau, fühlten sich vielmehr auf eine bedrohliche Weise herausgefordert.
Genau das hatte Penny bei ihm getan, immer und immer wieder, aber er liebte das an ihr, genoss dieses intellektuelle Kräftemessen. Wie eben jetzt auch. Trotz des Ernstes der Lage wurde ihm zunehmend bewusst, dass sich die Vergangenheit zu regen begann, Elemente ihrer längst beendeten Beziehung an die Oberfläche seines Bewusstseins trieben, wozu auch die Herausforderung gehörte, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Seiner Mutter zufolge hatte sie dutzende attraktiver Heiratsanträge erhalten und ausgeschlagen. Weil kein einziger davon sie wirklich überzeugt und mit Begeisterung erfüllt habe, wie sie erklärte. Sie schien glücklich mit ihrem Leben zu Hause in Cornwall, wo sie seit sieben Jahren die Aufsicht über den Besitz führte.
Penelope war das einzige Kind des verstorbenen Earl of Wallingham aus dessen erster Ehe – die Mutter starb, als sie noch ganz klein war –, und der Vater hatte erneut geheiratet. Elaine, mit der er einen Sohn und drei Töchter bekam, war eine warmherzige, freundliche Dame, die Penny liebvoll unter ihre Fittiche nahm. Im Laufe der Jahre waren sie im Grunde genommen weniger wie Mutter und Tochter, sondern wie gute Freundinnen miteinander umgegangen.
Als vor fünf Jahren der Earl starb, erbte Pennys Halbbruder Granville den Titel, das einzige männliche Wesen unter vier Schwestern und von seiner vernarrten Mutter nach Strich und Faden verzogen. Mit der Folge, dass der junge Mann leichtsinnig und gedankenlos wurde – die Folgen blieben nicht aus, denn ständig steckte Granville in der Klemme.
Zuletzt hatte er ihn 1814 gesehen, und damals war er immer noch rastlos und wild gewesen. Als dann erneut zu den Waffen gegen Napoleon gerufen wurde, ließ sich der junge Earl von der patriotischen Begeisterung anstecken und schloss sich, taub für das Flehen von Mutter und Schwestern, einem Regiment an. Irgendwo war er dann bei Waterloo auf dem verdammten Feld gefallen.
Titel und Besitz gingen an einen entfernten Cousin, den Marquis of Amberly, einen älteren Herrn, der Elaine und ihren Töchtern versicherte, dass sie ihr gewohntes Leben auf Wallingham Hall fortführen könnten. Man war einander verbunden, zumal Amberly als Granvilles Vormund bis zu dessen Volljährigkeit bestellt gewesen war. Trotzdem standen die Damen des Hauses jetzt praktisch ohne männlichen Schutz da.
Das, entschied Charles, war es, was ihn am meisten störte. Penny konnte in Gott weiß was hineingeraten, und es gab keinen Mann, der auf sie aufpasste. Außer ihm.
Was sie allerdings davon halten würde, wusste er nicht.
In seinem Hinterkopf nistete sich hartnäckig ein Verdacht ein. Weshalb hatte sie eigentlich all die Jahre nicht heiraten wollen? Warum war es keinem Bewerber gelungen, sie zum Altar zu führen. Hatte es vielleicht mit ihm zu tun? Aber was sie wirklich von ihm hielt, was sich hinter ihrer Kratzbürstigkeit verbarg, das vermochte er beim besten Willen nicht zu sagen.
Er wusste ja selbst nicht richtig, was er für sie empfand, und die Begegnung war ihm ganz und gar nicht willkommen gewesen. Er hatte gedacht, dreizehn Jahre würden reichen, ihrer Faszination nicht mehr zu erliegen, doch das war nicht der Fall. Nicht im Mindesten.
Seit er der Armee angehörte, war er ihr nur ein paarmal begegnet, 1814 beispielsweise und in den vergangenen sechs Monaten gelegentlich, allerdings lediglich aus der Entfernung oder im Beisein seiner oder ihrer Familie. Niemals ungestört oder gar alleine. Heute Nacht aber, nach der unerwarteten Begegnung, war das alte Verlangen mit unerhörter Macht zurückgekehrt. Wie ein wildes Tier, das ihn packte und seine Klauen in ihn grub.
Charles fühlte sich zutiefst aufgewühlt.
Egal, es gab nichts, um diesen Schmerz zu lindern. Sie war es gewesen, die vor dreizehn Jahren die Verbindung beendet, das enge Band zwischen ihnen durchtrennt hatte. Nutzlos, mit angehaltenem Atem darauf zu warten, dass sie ihre Meinung änderte. Er wusste es besser: Sie war unglaublich stur, seit Kindesbeinen an.
Sie würden diesen Teil ihrer Vergangenheit beiseiteschieben müssen. Sie konnten einander unmöglich völlig ignorieren – dazu ging bei beiden die Sache noch zu tief. Aber wenn sie sich Mühe gaben, konnten sie sich vielleicht zusammentun, um gemeinsam den merkwürdigen Dingen, die in der Gegend vor sich gingen, auf die Spur zu kommen.
Sie stand auf derselben Seite wie er, das wusste er, doch sie verbarg etwas vor ihm. Vermutlich schützte sie jemanden, aber wen? Wie lange würde es dauern, bis sie beschloss, es ihm zu verraten? Er hatte keine Ahnung. Trotzdem musste er handeln, denn es blieb nicht viel Zeit. Es war seine Mission, und er wollte die Dinge aufmischen und schauen, was dabei an die Oberfläche kam.
Wenn sie es ihm nicht verriet, musste er auf andere Weise hinter ihr Geheimnis kommen.
Er blieb noch eine halbe Stunde auf den Wällen, bevor er in die Abbey zurückkehrte und sich in seinem Schlafzimmer ins Bett fallen ließ, um sofort in einen tiefen Schlaf zu sinken.
2
Am nächsten Morgen wachte er von dem Geräusch trappelnder Hufe auf. Nicht auf dem Kies der Auffahrt zum Haus, sondern von weiter her.
Er hatte die bodenhohen Fenster an seinem Balkon offen gelassen, eine sehr unenglische Angewohnheit, die sich seinem langen Aufenthalt in Toulouse verdankte.
Charles rollte sich aus dem Bett, reckte sich und ging durchs Zimmer. Nackt stand er in der Balkontür und schaute Penny nach, die in einem goldfarbenen Reitkostüm davonritt. Wenn die Fenster nicht offen gewesen wären, hätte er sie nie gehört, denn die Stallungen lagen ein Stück vom Haus entfernt. Im Damensattel entfernte sie sich auf einem Rotbraunen ohne sonderliche Eile in südlicher Richtung.
Nach Fowey? Oder nach Hause? Oder ganz woandershin?
Fünf Minuten später schlenderte er in die Küche.
»Mylord!« Mrs. Slattery war sichtlich erschreckt, ihn hier so früh zu sehen. »Wir beginnen gerade erst, Ihr Frühstück zuzubereiten – ich hatte keine Ahnung …«
»Es ist allein meine Schuld.« Er lächelte entschuldigend. »Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich heute Morgen ausreiten will. Gibt es schon einen Schluck Kaffee? Und vielleicht ein Stück Kuchen oder zwei?«
Zwischen finsteren Warnungen, was einem Gentleman drohe, der seinen Tag ohne ausgiebiges Frühstück beginne, und unter völliger Nichtbeachtung seines mehrfach wiederholten Hinweises, dass er sich an das französische Frühstück gewöhnt habe – »Nun, jetzt sind Sie aber ein anständiger englischer Earl, daher vergessen Sie lieber so heidnische Sitten« –, servierte Mrs. Slattery ihm einen Becher starken schwarzen Kaffee und drei kleine Pasteten.
Eine davon verschlang er sofort, spülte alles mit dem Kaffee herunter und nahm dann die restlichen Teigtaschen, drückte der überraschten Köchin einen Kuss auf die Wange, was ihm ein Kreischen eintrug und ein: »Jetzt aber fort mit Ihnen, junger Herr …, ich meine, Mylord.« Dann lief er durch die Hintertür zu den Stallungen und ritt eine Viertelstunde später auf Domino, seinem grauen Jagdpferd, aus dem Stallhof, um sich an die Verfolgung zu machen.
Seit Anfang März hatte er den großen Grauen nicht mehr geritten. Domino war mehr als bereit, wollte schon losstürmen, bevor er die Zügel freigab. Sobald sie die Auffahrt hinter sich gelassen hatten und sich auf saftigem Gras befanden, ließ er dem Wallach seinen Willen. Sie preschten übers Gelände, schienen fast zu fliegen.
Er beugte sich dicht über den Hals des Tieres, lenkte den Wallach mit Händen und Knien, suchte dabei mit den Augen den Horizont ab, während sie sich südwestlich hielten. Penny, die im Damensattel ritt und deshalb auf den befestigten Wegen blieb, würde länger als er auf seinem Querfeldeinritt brauchen, sofern er ihr Ziel richtig erraten hatte. Plötzlich entdeckte er sie, immer noch ein gutes Stück vor ihm, wie sie außerhalb des Dorfes Lostwithiel die Brücke über den Fowey überquerte, etwa eine Meile vor der Stelle, wo der Fluss in den Meeresarm mündete. Lächelnd zügelte er sein Pferd und ritt fünf Minuten später ebenfalls über die Brücke.
Er folgte ihr in sicherer Entfernung oberhalb des Weges auf einer Anhöhe. Wohin sie wohl wollte? Nach Fowey, nach Hause oder irgendwo andershin? Aber dann bog sie nicht in die Landstraße ein, die Richtung Westen und nach Wallingham Hall führte, sondern blieb auf der Straße nach Süden, die sich am Westufer des Meeresarms bis Fowey an der Flussmündung entlangzog.
Doch bis zur Stadt waren es noch ein paar Meilen, und dazwischen gab es eine Reihe anderer Orte. Der Morgen war sonnig und schön, perfekt für einen Ausritt. Sie hielt ein stetes Tempo, und er passte sich ihr an.
Als sie ihren Braunen zügelte und nach Westen in eine schmalere Landstraße einbog, verließ er die Höhe und folgte ihr auf der Straße nach Essington Manor. Ahnungslos ritt sie die Auffahrt hinauf bis zu den Eingangsstufen, während er sich hinter dem Herrenhaus einen Flecken im Wald suchte, von wo aus er die Stallungen und den Platz vor dem Gebäude beobachten konnte. Als er sah, wie ein Stallbursche gerade Pennys Pferd wegführte, saß er ab, band Domino auf einer Lichtung in der Nähe fest und kehrte auf seinen Beobachtungsposten zurück.
Eine halbe Stunde später brachte ein Pferdeknecht eine leichte, offene Kutsche aus den Ställen zum Eingang, und ein weiterer folgte mit Pennys Rotbraunem. Charles ging ein wenig weiter, bis er die Eingangsstufen sehen konnte, beobachtete, wie Penny erschien, gefolgt von zwei weiteren jungen Damen ihres Alters, die ihm vage vertraut vorkamen. Die Frauen der Brüder Essington? Die beiden kletterten in den Wagen, während Penny sich von einem Pferdeknecht in den Damensattel helfen ließ. Charles holte Domino.
Rechtzeitig, um sich davon zu überzeugen, dass sich die jungen Damen in der Tat auf dem Weg nach Süden befanden, erreichte er die Abzweigung an der Straße nach Fowey. Vermutlich wollten sie in die Stadt zum Einkaufen.
Charles saß auf Domino und dachte nach. Über Penny und die Mission, die er erfüllen sollte. Welche Verbindung bestand da?
Sie war besorgt genug, um nachts Männern quer durchs Land zu folgen, besorgt genug, um sich zu weigern, ihm ihre Beobachtungen zu verraten – zumindest nicht, ohne zuerst sorgfältig und in Ruhe darüber nachzudenken. Dennoch war sie heute hier, brach scheinbar unbekümmert zu einem Einkaufsbummel auf und wirkte keineswegs beunruhigt. Er wusste sich keinen Reim darauf zu machen.
Penny begleitete die ersten anderthalb Stunden Millie und Julia Essington auf dem lange geplanten Ausflug zu zwei Modegeschäften, einem Herrenausstatter, dem alten Handschuhmacher und zwei Tuchhändlern. Als sie den Laden des zweiten Händlers verließen, blieb Penny auf dem Gehsteig stehen. »Ich schaue jetzt kurz nach unserem alten Diener. Warum geht ihr beide nicht rasch zur Apotheke vor, und wir treffen uns nachher im Pelikan zum Lunch?«
Sie hatte bereits morgens angekündigt, dass die nach einem ehemaligen Bediensteten schauen wolle, der in Fowey lebe und schwer erkrankt sei.
»In Ordnung!« Julia, deren Wangenfarbe immer rosig und deren Laune immer bestens war, hakte sich bei Millie unter. »Wenn du keine Unterstützung brauchst? Es würde uns nichts ausmachen, mit dir zu kommen, ehrlich.«
»Nein, dazu besteht keine Notwendigkeit, lasst euch das versichern.« Sie lächelte. »Es ist nicht so ernst, dass es um Leben oder Tod ginge, wenigstens noch nicht.« Sie vermied es, einen Namen zu nennen, denn bei beiden jungen Ladys handelte es sich um Töchter von Gutsbesitzern aus der näheren Umgebung, und auch die Bediensteten auf den verschiedenen Besitzen waren teilweise miteinander verwandt, sodass man durchaus einige namentlich kannte. Genau das wollte sie verhindern.
»Ich werde nicht lange brauchen.« Sie trat einen Schritt zur Seite. »Ich komme dann in den Pelikan.«
»Gut.«
»Wir bestellen schon für dich, ja?«
»Ja, bitte, tut das, falls ich nicht rechtzeitig dort bin.«
Mit einem freundlichen Lächeln verließ sie die Schwägerinnen und überquerte die mit Kopfsteinen gepflasterte Straße, ging langsam ein Stück bergan, bis das leise Klingeln einer Türglocke ihr verriet, dass Millie und Julia gerade den winzigen Laden des Apothekers betraten.
Penny bog schnell in eine Straße auf der rechten Seite ein.
Sie kannte sich in Fowey bestens aus, lief erst durch die eine, dann durch die andere Gasse, bis sie schließlich am Hafen ankam, um von dort wieder ein Stück hinaufzusteigen zu den ältesten Gebäuden des Ortes, die sich oberhalb des Kais dicht an den Hang schmiegten. Obwohl vor dem Wind einigermaßen geschützt, duckten sich die winzigen Häuschen dicht nebeneinander auf den Boden, als könnten sie sich auf diese Weise besser auf dem felsigen Grund festklammern. In den ärmlichen Quartieren hausten überwiegend Fischer mit ihren Familien – und Schmuggler, die hier als zahlende Gäste jederzeit Unterschlupf fanden.
Penny erreichte einen steil bergan führenden Durchgang, der kaum breiter war als die Abflussrinne, die in der Mitte verlief. Auf halbem Weg blieb sie stehen und fasste die kurze Schleppe ihres Rockes fester, bevor sie herrisch an eine schwere Holztür klopfte.
Sie wartete, klopfte dann erneut. Ringsum war niemand zu sehen. Nicht zu dieser Stunde und in dieser Gegend, denn die Flotte war ausgelaufen. Eine perfekte Zeit, um Mutter Gibbs aufzusuchen.
Endlich öffnete sich die Tür einen Spalt – gerade so viel, dass Penny ein blutunterlaufenes Auge sehen konnte. Ein Schnauben ertönte, und die Tür wurde weit aufgerissen.
»Nun, Miss Feinsäuberlich, was kann ich für Sie tun?«
Als Penny die Behausung eine halbe Stunde später verließ, war sie zwar nicht wesentlich klüger, aber zumindest, so hoffte sie, einen kleinen Schritt näher an der Wahrheit dran. Rasch lief sie den Weg zurück, um noch einigermaßen rechtzeitig im Gasthaus Pelikan einzutreffen, oben an der Hauptstraße, im besseren Teil der Stadt.
Sie kam ans Ende des schmalen Gässchens, bog rasch um die Ecke und prallte gegen eine Wand aus Muskeln und Knochen.
Er fing sie auf, als sie ins Stolpern geriet, drückte sie an sich. Er hielt sie zwar nicht richtig fest, noch nicht – und dennoch konnte sie sich nicht bewegen.
Schaffte es nicht einmal zu blinzeln, während sie ihn anstarrte. Seine Augen dicht über ihren schimmerten bei Tageslicht in einem tiefen Dunkelblau, schauten sie klug und wissend an. Penelope geriet aus dem Gleichgewicht.
Wegen seiner Augen und wegen der Tatsache, dass sie aufgehört hatte zu atmen. Sie vermochte ihre Lungen einfach nicht dazu zu bringen, sich zu dehnen und mit Luft zu füllen. Nicht solange er sie so eng an sich gedrückt hielt.
Hatte er etwas gesehen? Wusste er Bescheid?
»Ja, ich habe gesehen, aus welchem Haus du gerade gekommen bist. Ja, ich weiß, wessen Haus das ist. Ja, ich kann mich erinnern, was darin vor sich geht.« Sein Blick war scharf wie ein Messer, und sie wunderte sich, dass sie nicht blutete. »Willst du mir verraten, was du im berüchtigsten Bordell in Fowey zu schaffen hattest?«
Verdammt. Sie merkte, dass ihre Hände schlaff auf seiner Brust ruhten. Sie stemmte sich gegen ihn, holte tief Luft, als er sie losließ, und machte einen Schritt nach hinten.
Jetzt, wo Raum zwischen ihnen war, ging es ihr besser, und auch ihre Lungen nahmen ihre Arbeit wieder auf, der Schwindel ließ nach. Sie raffte ihre Röcke und ging um ihn herum. »Nein.«
Er atmete zischend zwischen zusammengebissenen Zähnen aus. »Penny.« Er streckte eine Hand aus und griff nach ihr.
Sie blieb stehen und schaute auf seine langen gebräunten Finger, die sich um ihr schmales Handgelenk schlossen. »Nicht.«
Er seufzte erneut und ließ sie los. Als ihr die Essingtons einfielen, beschleunigte sie ihre Schritte. Er lief neben ihr.
»Was könntest du nur von Mutter Gibbs wollen?«
Sie warf ihm einen kurzen Blick von der Seite zu. »Eine Auskunft.«
Eine Antwort, die ihn nur kurz beschwichtigte, genau für sechs Schritte. »Was hast du erfahren?«
»Bislang nichts.«
Wieder ein paar Schritte. »Wie, um alles in der Welt, hast du – Lady Penelope Selborne of Wallingham Hall – nur die Bekanntschaft dieser Frau gemacht?«
Sie erwog, ihn zu fragen, wie er als Earl of Lostwithiel denn an Mutter Gibbs geraten war, aber seine Antwort würde ihr am Ende Informationen liefern, die sie gar nicht wissen wollte. »Ich kenne sie durch Granville«, sagte sie stattdessen.
Er blieb jäh stehen. »Was?«
»Nein, ich meine nicht, dass er mich mit ihr bekannt gemacht hat oder so etwas.« Sie ging weiter, und mit zwei Schritten war er wieder neben ihr.
»Du willst mir, hoffe ich sehr, doch nicht weismachen, dass Granville so dämlich war, ihr Etablissement zu frequentieren?«
Dämlich? Vielleicht hatte er die Alte ja überhaupt nicht über ihr Geschäft kennengelernt. »Nicht wirklich.«
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »A Lady of his Own« bei Avon Books, an imprint of HarperCollins Publishers, New York
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Dezember 2011 bei
Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe