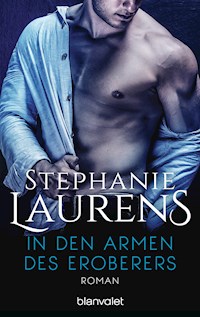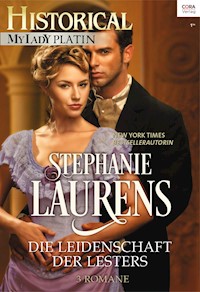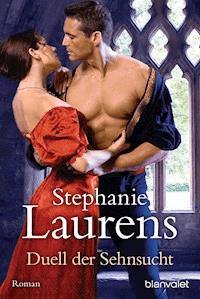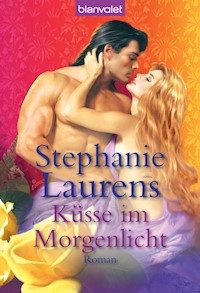4,99 €
4,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bastion Club
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Tristan Wemyss, Earl of Trentham, braucht dringend eine Ehefrau, um sein Erbe zu sichern. Seine Wahl fällt auf die bildschöne Nachbarstochter Leonora Carling. Doch die heißblütige Leonora denkt nicht daran, willenlos in seine Arme zu sinken, auch wenn es zwischen beiden heftig knistert. Erst als ihre Familie von Unbekannten bedroht wird, akzeptiert sie seine Hilfe – und lernt schon bald seine Qualitäten als Beschützer und erfahrener Verführer kennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 722
4,6 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Lady Chosen« bei Avon Books, an imprint of HarperCollinsPublishers, New York.
Deutsche Erstausgabe Mai 2010 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © der Originalausgabe 2003 by
Savdek Management Proprietory Ltd.
Published by arrangement with William Morrow,
an imprint of HarperCollinsPublishers
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by
Blanvalet Verlag, München, in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Inhaltsverzeichnis
Der Bastion-Klub
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Anmerkung der Autorin
Buch
Tristan Wemyss, Earl of Trentham, hätte es nie für möglich gehalten, dass er eines Tages würde heiraten müssen, um sein Erbe zu sichern – und zu allem Überdruss auch noch innerhalb eines Jahres! Woher denn nun die geeignete Gattin nehmen? Die Vorstellung, sich einer jener kuppelnden Gesellschaftsdamen anzudienen, behagt ihm außerordentlich schlecht. Dann doch lieber auf Altbekanntes zurückgreifen: zum Beispiel auf die niedliche Nachbarstochter, die zudem auch noch bildschön, geistreich und leidenschaftlich ist.
Nur leider ist Heiraten das Letzte, woran die heißblütige Miss Leonora Carling denken mag. Denn schon einmal hat ein Mann ihr Herz gebrochen, und ein zweites Mal sollen ihr diese Schmach und das Leid nicht widerfahren. Wie bedauerlich ist es da, dass Tristan ein durchaus unterhaltsamer Zeitgenosse ist – und ein hilfreicher obendrein. Denn als Leonoras Familie von einem Unbekannten bedroht wird, stellt er sich den Carlings zur Seite und beweist Leonora seine Qualität als Beschützer, Verführer – und Ehemann!
Autorin
Stephanie Laurens schrieb sich, als sie mal nichts zu lesen fand, kurzerhand ihren eigenen ersten Roman. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie aus dem Hobby einen Beruf machte. Sie gehört inzwischen zu den meistgelesenen und populärsten Liebesromanautorinnen der Welt. Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne/Australien.
Von Stephanie Laurens sind außerdem bei Blanvalet lieferbar: Verheißungsvolle Küsse / Der Liebesschwur (37372; Doppelband) · In den Armen des Eroberers (35838) · Gezähmt von sanfter Hand (36085) . In den Fesseln der Liebe (36098) . Ein unmoralischer Handel (36099) . Nur in deinen Armen (36472) . Nur mit deinen Küssen (36490) . Küsse im Mondschein (36528) . Küsse im Morgenlicht (36529) . Verführt zur Liebe (36759) · Was dein Herz dir sagt (36806) · In den Armen des Eroberers (37197) · Hauch der Verführung (36807) · Eine Nacht wie Samt und Seide (36808) · Sturm der Verführung (37298) · Im Feuer der Nacht (37376)
Der Bastion-Klub
Eine letzte Bastiongegen die Kupplerinnen der Gesellschaft
Christian Allardyce,Marquess of Dearne
Anthony Blake,Viscount Torrington
Jocelyn Deverell,Viscount Paignton
Charles St. Austell,Earl of Lostwithiel
Gervase Tregarth,Earl of Crowhurst
Jack Warnefleet,Baron Warnefleet of Minchinbury
Tristan Wemyss,Earl of Trentham
Prolog
Royal Pavilion, BrightonOktober 1815
»Seine Königliche Majestät muss sich ja in einer argen Notlage befinden, wenn er die Elite der britischen Krone extra herbeizitiert, um sich schlicht und ergreifend in ihrem Ruhme zu sonnen.«
Der beiläufige Kommentar triefte nur so vor Sarkasmus; Tristan Wemyss, vierter Earl of Trentham, ließ seinen Blick flüchtig über den stickigen Musiksalon schweifen, wo sich Gäste, Opportunisten und Speichellecker aller Art drängten.
Prinny – wie der Prinzregent gemeinhin genannt wurde – stand von Bewunderern dicht umringt. Ganz in Purpur und mit Goldtressen und gefransten Epauletten ausstaffiert, verströmte der Regent leutselige Geselligkeit und schwelgte in lebhaften Nacherzählungen wagemutiger Taten, die er den Depeschen über die jüngsten militärischen Engagements, vornehmlich denen in Waterloo, entnommen hatte.
Tristan ebenso wie der Gentleman an seiner Seite, Christian Allardyce, Marquess of Dearne, kannten die bittere Wahrheit hinter den Geschichten; sie waren selbst dabei gewesen. Die beiden hatten sich ein wenig von der Menge abgesondert und in einem ruhigeren Winkel des opulenten Saals Zuflucht gesucht, um sich weitere kunstvolle Lügen des Regenten zu ersparen.
Der sarkastische Kommentar stammte von Christian.
»Im Grunde«, murmelte Tristan, »würde ich den heutigen Abend eher als eine Art Ablenkungsmanöver betrachten – eine Finte, wenn man so will.«
Christian zog seine dichten Brauen hoch. »Erhört meine Lobreden auf Englands Ruhm … und vergesst, dass die Kassen leer sind und die Menschen hungern?«
Tristans Mundwinkel verzogen sich. »So was in der Art.« Christian wandte seinen Blick von Prinny und dessen Gefolge ab und ließ ihn stattdessen prüfend über die übrige Menge in dem kreisrunden Saal wandern. Es war eine rein männliche Veranstaltung, die sich in erster Linie aus Vertretern aller wichtigen Regimenter und Truppen zusammensetzte, die vor Kurzem noch im aktiven Dienst gestanden hatten; der Raum war ein bunter Ozean von verschiedenen Paradeuniformen, verziert mit Tressen, Pelzbesatz, glänzendem Leder und sogar Federn. »Die Tatsache, dass er seine aufwendig inszenierte Siegesfeier hier in Brighton stattfinden lässt und nicht in London, lässt tief blicken, findest du nicht? Ich frage mich, ob Dalziel da nicht ein Wörtchen mitzureden hatte.«
»Soweit mir zu Ohren gekommen ist, wird der Prinz in London nicht allzu gern gesehen; aber wie mir scheint, ist unser vormaliger Befehlshaber mit seinen Vorschlägen zur Gästeliste keinerlei Risiko eingegangen.«
»Ach?«
Sie sprachen leise, wie immer bestrebt, ihre Unterhaltung nach belanglosem Geplänkel unter Bekannten aussehen zu lassen. Die Macht der Gewohnheit. Sie ließ sich nur schwer abschütteln, zumal eine solche Verhaltensweise bis vor Kurzem noch für beide unerlässlich gewesen war – um zu überleben.
Tristan lächelte oberflächlich, und zwar geradewegs durch einen Gentleman hindurch, dessen Blick eben in ihre Richtung gewandert war; der Herr entschied sich, die beiden lieber nicht zu unterbrechen. »Ich bin bei Tisch Deverell begegnet – er saß nicht weit weg von mir. Er erwähnte, dass Warnefleet und St. Austell auch hier seien.«
»Tregarth und Blake ebenfalls. Sie sind mir aufgefallen, als ich hereinkam …« Christian brach nachdenklich ab. »Ach, verstehe. Dalziel hat wohl nur denjenigen eine Einladung zugestanden, die ihren Dienst kürzlich beendet haben?«
Tristan sah ihn vielsagend an; das Lächeln, das seinen ausdrucksstarken Lippen nie fern war, wurde intensiver. »Du glaubst doch wohl nicht, Dalziel würde es irgendjemandem – und sei es Prinny – gestatten, die geheimsten seiner Geheimagenten der Öffentlichkeit preiszugeben?«
Christian unterdrückte ein Grinsen, hob sein Glas an die Lippen und nahm einen Schluck.
Dalziel – niemand nannte ihn je bei seinem vollen Namen oder Titel – hielt die Zügel der englischen Außenpolitik fest in den Händen; in seinem Büro in Whitehall liefen sämtliche Fäden des britischen Spionageapparats zusammen – ein Apparat, der Englands Siege auf der Iberischen Halbinsel und kürzlich bei Waterloo überhaupt erst möglich gemacht hatte. Gemeinsam mit einem gewissen Lord Whitley, seinem persönlichen Gegenstück im Innenministerium, war Dalziel für alle verdeckten Operationen innerhalb und außerhalb Englands verantwortlich.
»Mir war nicht bewusst, dass Tregarth und Blake mit uns im selben Boot sitzen; die beiden anderen kenne ich nur vom Hörensagen.« Christian sah Tristan flüchtig an. »Bist du dir sicher, dass die vier ebenfalls ausscheiden?«
»Von Warnefleet und Blake weiß ich, dass sie aus ähnlichen Gründen ausscheiden wie wir. Bei den anderen beiden ist es pure Spekulation, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dalziel die Integrität eines Agenten vom Kaliber eines St. Austell – oder auch eines Tregarth oder Deverell – gefährden würde, nur um Prinnys Launen zu befriedigen.«
»Wohl war.« Christian ließ seinen Blick erneut über das Meer von Köpfen gleiten.
Er und Tristan waren beide hochgewachsen, breitschultrig, schlank und hatten den typisch muskulösen Körperbau von Männern, die regelmäßig an aktiven Kampfhandlungen teilnahmen – eine Tatsache, die von ihrer elegant geschnittenen Abendgarderobe nur ansatzweise vertuscht wurde. Unter ihrer Kleidung trugen beide die Narben des jahrelangen Militäreinsatzes; und obwohl ihre Fingernägel makellos manikürt waren, würde es noch Monate dauern, ehe die letzten Spuren – Schwielen, Rauheit, lederartige Haut – ihrer außergewöhnlichen und oftmals groben Tätigkeit ganz von ihren Händen verschwunden waren.
Die beiden Männer hatten – ebenso wie die fünf anderen Kollegen, von deren Anwesenheit sie wussten – über zehn Jahre lang in Dalziels Diensten und denen ihres Vaterlandes gestanden; Christian sogar fast fünfzehn Jahre lang. Ihren Pflichten entsprechend hatten sie jede erdenkliche Rolle gespielt – die des Adeligen wie die des Straßenkehrers, die des Kaufmanns wie die des Dachdeckers. Erfolg bedeutete für sie nur eines: die geheimen Informationen einzutreiben, um derentwillen man sie in feindliches Gebiet entsandt hatte, und lange genug zu überleben, um selbige Informationen an Dalziel zu übergeben.
Christian leerte sein Glas und seufzte. »Ich werde das alles vermissen.«
Tristan lachte knapp. »Werden wir das nicht alle?«
»In Anbetracht der Tatsache, dass wir von nun an nicht mehr auf der Gehaltsliste Ihrer Majestät stehen«, Christian stellte sein Glas auf eine nahe gelegene Anrichte, »sehe ich nicht ein, warum wir eigentlich noch hier herumstehen und uns unterhalten, wo wir dies doch genauso gut in einer sehr viel angenehmeren Umgebung tun könnten …« Sein ausdrucksloser Blick kreuzte sich mit dem eines Gentleman, der anscheinend erwogen hatte, zu ihnen herüberzukommen; er revidierte seine Entscheidung und wandte sich ab. »Und zwar ohne ständig Gefahr zu laufen, einem dieser Kriecher in die Hände zu fallen und ihm artig von unseren Abenteuern berichten zu müssen.«
Er sah Tristan mit hochgezogenen Brauen an. »Was meinst du …? Wollen wir uns in freundlichere Gefilde begeben?«
»Unbedingt.« Tristan übergab sein Glas einem vorbeigehenden Diener. »Hast du einen bestimmten Ort im Sinn?«
»Ich hatte schon immer eine Schwäche für das Ship and Anchor. Mir gefällt die behagliche Atmosphäre dort.«
Tristan nickte ihm zu. »Also, auf ins Ship and Anchor. Meinst du, wir können es wagen, gemeinsam hinauszugehen?«
Christians Lippen zuckten amüsiert. »Wenn wir mit ernster Miene und zusammengesteckten Köpfen – natürlich gewichtig flüsternd – gleichermaßen zielstrebig wie unauffällig auf den Ausgang zusteuern, werden wir höchstwahrscheinlich unbehelligt durchkommen.«
Ihr Plan ging auf. Jeder, der sie bemerkte, nahm an, dass einer der beiden geschickt worden war, um den anderen zu einem äußerst wichtigen und natürlich hochgeheimen Treffen zu geleiten; die Diener beeilten sich, ihre Mäntel zu holen, und bald traten die beiden Männer hinaus in die frische Nachtluft.
Sie hielten kurz inne und atmeten tief ein, so als müssten sie ihre Lungen von der lähmend stickigen Luft des überheizten Palastes reinigen. Dann lächelten sie einander fast unmerklich zu und ließen den Royal Pavilion hinter sich.
Sie entfernten sich von dem hell erleuchteten Eingangsportal und bogen in die North Street ein. Mit dem entspannten, aber entschlossenen Schritt zweier Gentlemen, die genau wissen, wohin sie wollen, wandten sie sich nach rechts und steuerten auf den Brighton Square und die dahinter befindlichen Sträßchen zu. Als sie die schmalen, von Fischerhäusern gesäumten, gepflasterten Gassen erreichten, mussten sie hintereinander hergehen; sie tauschten an jeder Weggabelung ihre Positionen und spähten prüfend in jeden Winkel … Falls einem der beiden in diesem Moment bewusst war, dass dieser Ort zu Hause und Frieden bedeutete, dass sie fortan nicht länger auf der Flucht, nicht länger im Krieg waren, so unterließen doch beide jeglichen Kommentar und machten keinerlei Anstalten, jenes seltsame Verhalten zu unterdrücken, das ihnen beiden so selbstverständlich geworden war.
Sie gingen kontinuierlich in Richtung Süden – auf das Geräusch des Meeres zu, das in der Dunkelheit gegen das Ufer rauschte. Schließlich bogen sie in die Black Lion Street ein. Am Ende der Straße befand sich der Ärmelkanal – jene Grenze, hinter der sie den überwiegenden Teil der vergangenen zehn Jahre verbracht hatten. Unter dem schaukelnden Schild des Ship and Anchor blieben sie stehen und hielten kurz inne. Eine salzige Brise und der vertraute Geruch von Meer und Algen umfingen die beiden Männer.
Die Erinnerung zog sie vorübergehend in ihren Bann, doch wie in stummer Übereinkunft wandten sie sich im nächsten Moment ab. Christian öffnete die Tür, und sie traten gemeinsam ein.
Einladende Wärme, der Klang englischer Stimmen und der Duft guten englischen Biers schlugen ihnen entgegen. Beide entspannten sich, so als wäre eine unbestimmte Last ganz unvermittelt von ihnen gefallen. Christian trat an den Tresen. »Zwei Krüge Ihres Allerbesten.«
Der Wirt nickte zur Begrüßung und zapfte umgehend zwei Pints.
Christians Blick fiel auf die Tür hinter der Bar. »Wir setzen uns in Ihr Hinterzimmer.«
Der Wirt blickte kurz auf, stellte dann zwei schaumgekrönte Humpen auf die Theke. Sein Blick wanderte zu der besagten Tür. »Nun, das Hinterzimmer, Sir … Sonst jederzeit gern, nur heut sitzen da schon ein paar Gen’lemen, und denen wär’s wohl nich so recht, wenn da noch fremde Gesellschaft hinzukäm, wie?«
Christian zog die Augenbrauen hoch. Er griff nach der Klappe in der Theke und hob sie an. Während er hindurchtrat, schnappte er sich einen der Humpen. »Wir werden es einfach mal riskieren.«
Tristan unterdrückte ein Grinsen, warf dem Wirt ein paar Münzen für das Bier hin, schnappte sich das zweite Ale und folgte seinem Freund auf dem Fuße.
Er stand direkt neben ihm, als dieser die Tür zum Hinterzimmer weit aufstieß. Die Gruppe von Männern, die es sich um zwei zusammengeschobene Tische herum bequem gemacht hatte, blickte geschlossen auf; fünf Augenpaare waren fest auf Christian und Tristan gerichtet.
Ein fünffaches Grinsen begrüßte sie.
Charles St. Austell, der am gegenüberliegenden Ende des Tisches saß, lehnte sich zurück und winkte sie großmütig herein. »Was seid ihr zwei doch für ehrbare Männer. Wir wollten schon Wetten darauf abschließen, wie lange ihr es wohl aushalten würdet.«
Alle standen auf, um Tische und Stühle umzustellen. Tristan schloss die Tür hinter sich, stellte seinen Humpen ab und gesellte sich dazu, während man einander bereits vorstellte.
Obwohl jeder von ihnen in Dalziels Diensten gestanden hatte, waren sie sich in dieser Konstellation noch nie begegnet. Jeder kannte den einen oder anderen, doch niemand kannte sie alle.
Der Älteste unter ihnen, Christian Allardyce, der zugleich am längsten gedient hatte, war zumeist im Osten Frankreichs sowie in der Schweiz, Preußen und einigen kleineren Staaten und Fürstentümern zum Einsatz gekommen; mit seinem blonden Haar und einem besonderen Talent für Sprachen hatte er sich mühelos in diese Gegenden eingefügt.
Tristan selbst war weit herumgekommen und oft mitten im Herzen des Geschehens – in Paris oder anderen industriellen Metropolen – eingesetzt worden; die Tatsache, dass er fließend Französisch sprach, ebenso wie Deutsch und Italienisch, und dazu die Kombination von braunem Haar und braunen Augen, gepaart mit seinem unwiderstehlichen Charme, hatten ihm und seinem Vaterland gute Dienste geleistet.
Er war Charles St. Austell, der einen besonderen Hang zur Extravaganz zu haben schien, noch nie zuvor begegnet. Mit seinen zerzausten, schwarzen Locken und seinen strahlend dunkelblauen Augen zog Charles die Frauen, jung wie alt, gewiss in Scharen an. Er war Halbfranzose und besaß sowohl eine schnelle Zunge wie auch einen schnellen Intellekt, weshalb er sein Äußeres mühelos zu seinem größten Vorteil einzusetzen wusste; er war Dalziels wichtigster Agent in Südfrankreich – vornehmlich in Carcassonne und Toulouse – gewesen.
Der aus Cornwall stammende Gervase Tregarth, mit lockigem braunem Haar und haselnussbraunen Augen, hatte, wie man Tristan erklärte, den überwiegenden Teil der vergangenen zehn Jahre in der Bretagne und in der Normandie verbracht. Er war mit St. Austell bekannt, hatte aber nie mit ihm zusammengearbeitet.
Tony Blake kam ebenfalls aus einem englischen Hause mit zur Hälfte französischer Abstammung. Sein dunkles Haar und seine dunklen Augen verliehen ihm eine ganz besondere Eleganz, die ihn von den anderen abhob, doch hinter seiner edlen Fassade ahnte man eine gewisse Härte; ihn hatte Dalziel am häufigsten beauftragt, um in das Spionagenetz der Franzosen einzudringen und dieses von innen heraus fehlzuleiten, ein überaus gefährliches Unterfangen, das sich zumeist auf die nordfranzösischen Hafenstädte konzentrierte. Allein schon die Tatsache, dass Tony noch am Leben war, bewies die stählerne Zähigkeit dieses Mannes.
Jack Warnefleet war auf den ersten Blick ein Mysterium; er sah so durch und durch englisch aus und war noch dazu außergewöhnlich gut aussehend, mit hellbraunem Haar und ebenso hellbraunen Augen, dass man sich kaum vorstellen konnte, wie es ihm jahrelang gelungen war, in sämtliche Bereiche der französischen Schifffahrt und in sonstige Handelsgeschäfte unbegrenzt Einblick zu erhalten. Er war, mehr noch als alle anderen, wandelbar wie ein Chamäleon und hatte eine solch ungezwungene, überschwängliche Art, dass kaum jemand hinter seine Fassade blickte.
Zuletzt schüttelte Tristan die Hand von Deverell, einem Gentleman mit gepflegter Erscheinung, einem ungezwungenen Lächeln, dunkelbraunem Haar und grünlichen Augen. Trotz seines attraktiven Äußeren hatte er die Gabe, sich unauffällig in jede beliebige Gruppe einzufügen. Er hatte fast ausschließlich in Paris gearbeitet und war nie aufgeflogen.
Nachdem sich alle miteinander bekannt gemacht hatten, nahm man wieder Platz. Das Hinterzimmer war nun angenehm gefüllt; im Kamin brannte ein heimeliges Feuer, das den Raum in flackerndes Licht tauchte, während die Männer sich beinahe Schulter an Schulter um die beiden Tische scharten.
Sie waren allesamt kräftig gebaut; jeder hatte als Gardist in dem einen oder anderen Regiment gedient, bevor Dalziel ihn aufgespürt und davon überzeugt hatte, sich in seine Dienste zu begeben.
Allzu viel Überzeugungskraft war freilich nicht vonnöten gewesen.
Tristan nahm einen ersten genüsslichen Schluck von seinem Ale und ließ den Blick über die Gruppe wandern. Rein äußerlich hatten sie nicht viel gemeinsam, doch unter der Oberfläche waren sie eindeutig miteinander verwandt. Sie waren allesamt adeliger Abstammung, besaßen ähnliche Fähigkeiten, Qualitäten und Talente, wenn auch in unterschiedlicher Verteilung. Doch vor allem war jeder von ihnen willens und in der Lage, der Gefahr ins Auge zu sehen und ohne zu zögern – vielmehr mit einem natürlichen Selbstvertrauen, das an leichtsinnige Arroganz grenzte – ein Spiel auf Leben und Tod zu spielen.
Es floss weit mehr als nur eine Spur von Abenteuerlust in ihren Adern. Und sie waren alle loyal bis aufs Blut.
Deverell stellte seinen Krug ab. »Stimmt es, dass wir allesamt ausscheiden?« Zustimmendes Nicken und neugierige Blicke von allen Seiten; Deverell grinste. »Wäre es unhöflich zu fragen, warum?« Er wandte sich an Christian. »In deinem Fall gehe ich davon aus, dass Allardyce durch Dearne ersetzt werden soll. Richtig?«
Christian neigte zynisch den Kopf. »In der Tat. Nachdem mein Vater gestorben ist und ich somit den Titel geerbt habe, bleibt mir keine andere Wahl. Wäre Waterloo nicht dazwischengekommen, würde ich bereits bis zum Hals in der Schaf- und Viehzucht stecken – und zweifellos in Ketten liegen.«
Sein leicht angewiderter Tonfall trug ihm die mitfühlenden Blicke der anderen ein.
»Das kommt mir nur allzu bekannt vor.« Charles St. Austell starrte vor sich auf den Tisch. »Ich hatte nie damit gerechnet, den Titel zu erben, aber während ich fort war, haben meine beiden Brüder mich sträflich im Stich gelassen.« Er verzog das Gesicht. »Und nun bin ich der Earl of Lostwithiel – und, wie meine Schwestern, Schwägerinnen und meine werte Mutter mir unablässig in Erinnerung rufen, längst überfällig, vor den Traualtar zu treten.«
Jack Warnefleets Lachen klang wenig amüsiert. »Und unerwarteterweise muss auch ich mich eurem Klub anschließen. Der Titel war zwar keineswegs unerwartet – mein Herr Vater hat ihn mir hinterlassen -, aber die Häuser und Ländereien stammen von einer entfernten Großtante, von der ich gerade mal wusste, dass es sie gibt. Und nun – so habe ich mir sagen lassen – stehe ich ganz weit oben auf der Liste begehrter Junggesellen und kann mich so lange auf eine erbitterte Jagd einstellen, bis ich schließlich kapituliere und mich in die Zwänge der Ehe begebe.«
»Moi aussi.« Gervase Tregarth nickte Jack beipflichtend zu. »Bei mir war es ein Cousin, welcher der Schwindsucht erlegen und somit völlig verfrüht gestorben ist; mit einem Mal bin ich der Earl of Crowhurst, besitze ein Haus in London, das ich noch nie gesehen habe, und muss mir, wie ich ständig zu hören bekomme, schleunigst eine Ehefrau suchen, um mit ihr einen Erben zu zeugen, da ansonsten die Linie der Crowhursts auszusterben droht.«
Tony Blake machte ein abwehrendes Geräusch. »Zumindest hast du keine französische Mutter – ihr könnt mir glauben, wenn es darum geht, jemanden vor den Altar zu treiben, sind sie nicht zu übertreffen.«
»Also, auf dich!« Charles erhob seinen Krug. »Aber soll das etwa bedeuten, dass du ebenfalls seit deiner Rückkehr belagert wirst?«
Tony rümpfte die Nase. »Ich habe es meinem Vater zu verdanken, dass ich mich nunmehr Viscount Torrington schimpfen darf – ich hatte ja gehofft, dass er sich noch ein paar Jahre Zeit lässt, aber …«, er zuckte die Schultern. »Mir war hingegen nicht bewusst, dass mein alter Herr in den vergangenen zehn Jahren umfangreiche Investitionen getätigt hat. Ich wusste durchaus, dass ich ein ordentliches Auskommen erben würde, aber auf diesen geballten Reichtum war ich beileibe nicht gefasst. Und dann musste ich auch noch feststellen, dass die gesamte feine Gesellschaft bereits bestens darüber Bescheid weiß. Auf meinem Weg hierher habe ich einen kurzen Zwischenstopp in der Stadt eingelegt, um meiner Patentante einen Besuch abzustatten.« Er schauderte. »Man ist regelrecht über mich hergefallen. Es war grauenhaft.«
»Das rührt daher, dass wir in Waterloo so hohe Verluste verzeichnen mussten.« Deverell starrte nachdenklich in seinen Krug; einen Moment lang herrschte Stille. Jeder hing seinen Erinnerungen an verlorene Kameraden nach, dann erhoben alle ihre Krüge und tranken.
»Ich muss gestehen, mir ist ein ganz ähnliches Schicksal widerfahren«, bemerkte Deverell, während er seinen Humpen abstellte. »Als ich England verließ, hatte ich keinerlei Aussichten auf einen Titel, doch als ich zurückkehrte, musste ich feststellen, dass ein entfernter Cousin dritten Grades kürzlich das Zeitliche gesegnet und ich seinen Titel Viscount Paignton geerbt hatte, mitsamt den Häusern, dem Einkommen und – ebenso wie ihr – dem drängenden Zwang, mir eine Gattin suchen zu müssen. Mit dem Land und dem Geld kann ich umgehen, nicht aber mit den Häusern, geschweige denn den daran gebundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen – jedem französischen Komplott könnte man eher entrinnen als diesem verhängnisvollen Netz.«
»Und wenn man scheitert, kann man sich gleich sein eigenes Grab dazu schaufeln«, fügte St. Austell hinzu.
Von allen Seiten erklang bittere Zustimmung. Alle Blicke richteten sich auf Tristan.
»Das ist schon eine recht eindrucksvolle Litanei, aber ich garantiere euch, ich kann all eure Geschichten noch mühelos übertreffen.« Er ließ den Blick sinken und schob seinen Krug gedankenverloren in den Händen hin und her. »Seit meiner Rückkehr habe ich ebenfalls eine ungewohnte Last zu tragen: einen Titel, zwei Häuser, eine Jagdhütte und ein erhebliches Vermögen. Allerdings beherbergen diese besagten Häuser zudem ein buntes Sortiment an älteren Damen – Großtanten, Cousinen und entferntere Verwandte. Das Erbe stammt von meinem Großonkel, dem kürzlich verstorbenen dritten Earl of Trentham, der seinen Bruder – das heißt, meinen Großvater – wie auch meinen Vater und mich abgrundtief verabscheute.
Er war der Meinung, wir wären allesamt Prasser, Taugenichtse, die kommen und gehen, wie es ihnen gerade passt, die ständig durch die Weltgeschichte reisen und so weiter. Ich muss schon zugeben, jetzt, da ich meine Großtanten und ihr weibliches Gefolge kennengelernt habe, kann ich seinen Groll durchaus nachvollziehen. Der alte Knabe wurde geradezu Opfer seiner gesellschaftlichen Stellung, gefangen von einer Horde überfürsorglicher Frauen, die sich bei allem einmischen.«
Ein regelrechtes Schaudern erfasste den ganzen Raum.
Tristans Blick verfinsterte sich. »Als zuerst sein Enkelsohn und dann sein Sohn starben und dem alten Herrn somit bewusst wurde, dass ich ihn eines Tages beerben würde, ließ er sein Testament um eine tückische Klausel erweitern. Ein Jahr lang steht mir das volle Erbe zur Verfügung, sprich Titel, Ländereien, Häuser sowie das gesamte Vermögen. Sollte ich allerdings nach Ablauf dieses Jahres noch nicht vermählt sein, bleiben mir zwar der Titel, die Ländereien und die Häuser, das ungeheure Vermögen hingegen, das nötig ist, um die umfangreichen Anwesen zu betreiben, würde mir abgesprochen und stattdessen für mildtätige Zwecke gespendet.«
Es herrschte Stille, dann fragte Jack Warnefleet: »Und was würde aus der Horde älterer Damen werden?«
Tristan sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Darin besteht ja gerade die besondere Tücke. Sie würden ihr Leben lang bei mir wohnen. Wo sollten sie auch sonst hin – ich könnte sie wohl kaum vor die Tür setzen.«
Alle starrten ihn an, sichtlich betroffen von seinem schweren Los.
»Wie überaus niederträchtig.« Gervase machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter: »Und wann läuft dein Jahr ab?«
»Juli.«
»Dir bleibt demnach noch die nächste Saison, um deine Wahl zu treffen.«
Charles stellte seinen Humpen ab und schob ihn von sich. »Wir sitzen also alle mehr oder minder im selben Boot. Wenn ich bis dahin keine Ehefrau gefunden habe, werden meine Schwestern, Schwägerinnen und meine geliebte Mutter mich in den Wahnsinn treiben.«
»Wir begeben uns da keineswegs in ruhiges Fahrwasser, so viel steht fest.« Tony Blake blickte in die Runde. »Nachdem ich meiner Patentante nur knapp entronnen war, suchte ich Zuflucht bei Boodle’s.« Er schüttelte den Kopf. »Fataler Fehler. In weniger als einer Stunde hatten mich nicht einer, sondern gleich zwei wildfremde Gentlemen angesprochen und zum Dinner eingeladen!«
»Du wurdest in deinem eigenen Klub verfolgt und gejagt!« Jack verlieh dem Entsetzen Ausdruck, das sie alle befallen hatte.
Tony nickte grimmig. »Und es kam sogar noch schlimmer. Als ich mein Haus betrat, erwartete mich bereits ein Stapel von Einladungen – ohne Übertreibung einen Fuß hoch -, die allesamt eingetroffen waren seit meiner Ankündigung, nach Hause zu kommen. Ich hatte meine Tante unglücklicherweise vorgewarnt, dass ich vermutlich bei ihr vorbeischauen würde.«
Schweigen legte sich über die Gruppe, während ein jeder die Nachrichten verdaute, Schlüsse zog, Überlegungen anstellte …
Christian beugte sich vor. »Ist sonst schon irgendjemand in der Stadt gewesen?«
Alle schüttelten die Köpfe. Sie waren erst kürzlich nach England zurückgekehrt und hatten sich umgehend auf ihre jeweiligen Landsitze zurückgezogen.
»Na schön«, fuhr Christian fort. »Meint ihr, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle so erbarmungslos gejagt werden, sobald wir uns in der Stadt zeigen?«
Sie malten sich die Lage aus …
»Um ehrlich zu sein«, begann Deverell, »ich fürchte, es wird noch viel schlimmer werden. Viele Familien trauern noch. Selbst wenn sie bereits in der Stadt sind, werden sie sich kaum in der Öffentlichkeit zeigen. Dementsprechend dürfte es zurzeit nur recht wenige Einladungen geben.«
Alle Blicke richteten sich fragend auf Tony, doch dieser schüttelte nur den Kopf. »Kann ich nicht sagen – ich hatte keinerlei Drang, das herauszufinden.«
»Aber Deverell hat recht, es muss so sein.« Gervases Züge hatten sich verhärtet. »Aber wenn die neue Saison beginnt, ist die obligatorische Trauerzeit längst beendet, und dann werden die Geier kreisen und sich nur so auf ihre Opfer stürzen – verzweifelter und entschlossener denn je.«
»Gott bewahre!«, rief Charles und sprach damit allen aus der Seele. »Wir werden«, er gestikulierte heftig, »Opfer genau der Hetzjagd werden, der wir uns in den letzten zehn Jahren so hartnäckig entzogen haben.«
Christian nickte ernst und bemerkte nüchtern: »Wir stehen auf einem anderen Schlachtfeld, aber wir befinden uns nach wie vor im Krieg – anders kann man dieses gesellschaftliche Spielchen der Damenwelt nicht nennen.«
Tristan lehnte sich kopfschüttelnd zurück. »Es ist schon ein Trauerspiel, wenn wir allen erdenklichen Grausamkeiten der Franzosen zum Trotz heldenhaft nach England zurückkehren, nur um hier einer noch größeren Gefahr ausgesetzt zu werden.«
»Und zwar einer Gefahr, die unsere gesamte Zukunft aufs Spiel setzt und der wir, dank unseres unermüdlichen Einsatzes für König und Vaterland, weit weniger gewachsen sind als manch anderer, jüngerer Gentleman«, fügte Jack hinzu.
Stille.
»Aber wisst ihr was …?« Charles St. Austell schob seinen Bierkrug ziellos im Kreis herum. »Wir haben schon schlimmeren Feinden ins Auge gesehen – und gewonnen.« Er blickte in die Runde. »Wir sind alle etwa im gleichen Alter … Wie viele Jahre mögen wohl zwischen uns liegen? Fünf vielleicht? Wir sehen uns alle der gleichen Gefahr ausgesetzt, haben ähnliche Ziele und ähnliche Beweggründe. Sollten wir uns nicht sinnvollerweise zusammentun und einander unterstützen?«
»Einer für alle, alle für einen?«, fragte Gervase.
»Warum nicht.« Charles ließ seinen Blick weiter über die Runde wandern. »Was strategische Planung angeht, haben wir reichlich Erfahrung. Ich sehe keinen guten Grund, warum wir dieses Problem nicht wie jeden anderen Kampfeinsatz angehen sollten.«
Jack erhob sich. »Und es ist schließlich nicht so, als wenn wir einen ernsthaften Konkurrenzkampf zu befürchten hätten.« Er sah ebenfalls jeden der Reihe nach an. »Wir sind uns alle in gewisser Weise ähnlich, doch wir unterscheiden uns in ebenso vielen Punkten, wir entstammen unterschiedlichen Familien, unterschiedlichen Grafschaften. Und es ist schließlich nicht so, als gäbe es zu wenig junge Damen, die um unsere Gunst buhlen, es gibt vielmehr zu viele – darin besteht ja gerade das Problem.«
»Also, ich finde die Idee hervorragend.« Christian hatte seine Arme auf den Tisch gestützt und blickte erst Charles, dann die anderen an. »Wir müssen alle heiraten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht – ich jedenfalls werde bis aufs Blut kämpfen, um mein Schicksal fest in den Händen zu behalten. Ich werde meine Braut selber wählen und sie mir nicht in irgendeiner Weise aufdrängen lassen. Dank Tonys unfreiwilliger Erkundung wissen wir, dass der Feind bereits auf der Lauer liegt und uns angreifen wird, sobald wir unsere Deckung verlassen.« Er blickte sich erneut um. »Welche Initiative sollen wir ergreifen?«
»Die übliche«, entgegnete Tristan. »Fundierte Informationen sind der Schlüssel zum Sieg. Wir werden all unser Wissen teilen – über die Grundhaltung des Feindes, seine Angewohnheiten, seine bevorzugten Handlungsweisen.«
Deverell nickte. »Wir lassen die anderen wissen, wenn sich eine Taktik als erfolgreich erweist, und warnen einander vor besonderen Gefahren.«
»Aber was wir vor allen Dingen brauchen«, schaltete Tony sich ein, »ist ein sicherer Rückzugsort. Dies ist unweigerlich der erste Schritt, wenn man sich auf feindliches Territorium begibt.«
Sie schwiegen für einen Moment, überlegten.
Charles verzog das Gesicht. »Bevor wir uns hier ausgetauscht haben, hätte ich gesagt, einer unserer Klubs würde einen geeigneten Ort abgeben, aber dem ist offenbar nicht so.«
»Keineswegs, und unsere eigenen Häuser scheiden ebenfalls aus – und zwar aus ganz ähnlichen Gründen.« Jack runzelte die Stirn. »Tony hat vollkommen recht, wir brauchen einen absolut sicheren Rückzugsort, an dem wir uns ungestört treffen und Informationen austauschen können.« Er zog seine Augenbrauen hoch. »Wer weiß? Es könnte sich sogar noch als nützlich erweisen, wenn man unsere Verbindungen nicht kennt – zumindest nicht unsere privaten.«
Die anderen nickten und sahen einander an.
Christian sprach aus, was die anderen dachten. »Wir brauchen einen privaten Klub. Nicht, um dort zu wohnen – obwohl ein paar Schlafzimmer unter Umständen ganz nützlich sein könnten -, sondern einen Klub, der uns als Treffpunkt dient und wo wir unsere Aktionen gezielt planen und in die Tat umsetzen können, ohne dabei Angst haben zu müssen, dass uns jemand in den Rücken fällt.«
»Aber nicht irgend so ein Schlupfloch«, kommentierte Charles. »Eher eine Art Festung …«
»Ein Bollwerk auf feindlichem Terrain.« Deverell nickte entschlossen. »Ohne welches wir dem Feind schutzlos ausgeliefert wären.«
»Außerdem sind wir zu lange fort gewesen«, knurrte Gervase. »Wenn wir uns völlig unvorbereitet aufs gesellschaftliche Schlachtfeld begeben, werden die Harpyien nur so über uns herfallen und uns in Fesseln schlagen. Wir sind schließlich völlig aus der Übung – wenn wir die überhaupt je hatten.«
Sie waren sich stillschweigend einig, dass sie sich in unbekannte und somit gefährliche Gewässer begaben. Nicht einer von ihnen hatte sich je über einen längeren Zeitraum in gesellschaftlichen Kreisen bewegt – zumindest nicht mehr, seit sie zwanzig waren.
Christian ließ seinen Blick in die Runde schweifen. »Uns bleiben volle fünf Monate, ehe wir unsere Zuflucht wirklich benötigen. Wenn sie uns ab Ende Februar zur Verfügung steht, können wir uns an den feindlichen Posten vorbei ungefährdet in die Stadt schleichen und jederzeit untertauchen …«
»Mein Anwesen liegt in Surrey.« Tristan sah die anderen an. »Wenn wir uns darauf einigen, wie und wo wir unsere Festung errichten wollen, könnte ich mich ganz unauffällig in die Stadt begeben und alles Nötige regeln, ohne dabei irgendwelche Wellen zu schlagen.«
Charles kniff die Augen zusammen; sein Blick wirkte abwesend. »Wir brauchen einen Ort, der nahe am Geschehen ist, aber auch wiederum nicht zu nah.«
»Eine Gegend, die gut erreichbar, aber wenig offensichtlich ist.« Deverell trommelte gedankenverloren auf den Tisch. »Je weniger man uns in der Nachbarschaft kennt, desto besser.«
»Vielleicht ein Haus, das …«
Sie wogen die verschiedenen Anforderungen gegeneinander ab und kamen zu dem Schluss, dass ein Haus außerhalb von Mayfair – aber in dessen Nachbarschaft und zwar auf der dem Stadtkern abgelegen Seite – am ehesten ihren Ansprüchen genügen würde. Das Haus sollte mehrere Empfangszimmer besitzen, die ausreichend Platz bieten müssten, um sich – gegebenenfalls in Damengesellschaft – bequem dort treffen zu können; der übrige Teil des Hauses sollte zur damenfreien Zone erklärt werden und – für den Notfall – zumindest drei Schlafzimmer, eine Küche sowie Wirtschafts- und Personalräume umfassen; natürlich müsste das Personal den besonderen Ansprüchen der Herren gerecht werden …
»So weit, so gut.« Jack schlug auf den Tisch. »Also!« Er nahm seinen Krug und hielt ihn in die Luft. »Auf Prinny und seine geringe Popularität – denn ohne ihn wären wir heute nicht hier versammelt und hätten keinerlei Gelegenheit, unser aller Leben deutlich sicherer zu gestalten.«
Mit einem breiten Grinsen nahm jeder einen Schluck aus seinem Humpen. Dann schob Charles seinen Stuhl zurück, stand auf und erhob seinen Krug. »Gentlemen, auf unseren Klub! Eine letzte Bastion gegen die Kupplerinnen der Gesellschaft und ein sicherer Stützpunkt, von dem aus wir die weiblichen Kreise infiltrieren, die Braut unserer Wahl identifizieren und isolieren werden, um die weibliche Gesellschaft schließlich im Sturme zu erobern und unsere Siegestrophäe heimzuführen!«
Alle jubelten, trommelten auf die Tische und erhoben sich.
Charles nickte Christian zu. »Auf unsere Bastion! Die uns erlauben wird, unser Schicksal fest in den eigenen Händen zu behalten und selbst darüber zu regieren. Gentlemen!« Charles hob seinen Krug hoch in die Luft. »Auf den Bastion-Klub!«
Alle jubelten und tranken voller Begeisterung.
Der Bastion-Klub war geboren.
1
Lust und eine tugendhafte Frau – nur ein Narr würde versuchen, das eine mit dem anderen in Einklang zu bringen.
Tristan Wemyss, der vierte Earl of Trentham, hatte sich nur selten einen Narren schimpfen lassen, und dennoch stand er hier am Fenster in Betrachtungen einer eindeutig tugendhaften Dame versunken und gab sich dabei allerlei lüsternen Gedanken hin.
Was vielleicht sogar nachvollziehbar war; besagte Dame war nämlich groß, dunkelhaarig und von schlanker wie sanft kurvenreicher Gestalt – die überdies perfekt zur Geltung kam, während sie müßig durch den benachbarten Garten streifte und sich gelegentlich hinunterbeugte, um hier und da ein Blatt oder eine Blüte näher zu betrachten, welche in den üppigen und eigentümlich wild erscheinenden Beeten prächtig gediehen.
Es war Februar und das Wetter genauso trüb und kalt, wie der Monat es erwarten ließ, und dennoch war der Garten nebenan voller Leben – der Frost schien dem dichten dunkelgrünen Blattwerk und den kupfern schimmernden, exotischen Pflanzen nichts anhaben zu können. Natürlich waren einige Bäume und Büsche kahl und leblos, doch alles in allem strahlte der Garten eine Art winterliche Lebendigkeit aus, die für Londoner Gärten zu dieser Jahreszeit völlig untypisch war.
Nicht, dass er sich auch nur im Geringsten für Gartenkunst interessierte; was ihn hingegen faszinierte war jene junge Frau, die leicht und elegant durch den Garten schwebte und ihren Kopf schräg legte, wenn sie eine Blüte betrachtete. Ihr tief mahagonifarbenes Haar hatte sie zu einer Art Krone hochgesteckt. Er konnte den Ausdruck auf ihrem blassen, ovalen Gesicht nicht richtig erkennen, aber ihre Züge wirkten zart und rein.
Ein Irischer Wolfshund mit rauem, zottigem Fell schnüffelte behäbig um sie herum; wenn sie im Garten war, leistete der Hund ihr meistens Gesellschaft.
Sein scharfer und überaus zuverlässiger Instinkt verriet Tristan, dass ihr Interesse heute nur oberflächlicher Natur war, ein vorübergehender Zeitvertreib, so als würde sie auf irgendetwas warten. Oder auf jemanden.
»Mylord?«
Tristan drehte sich um. Er stand im ersten Stock am Erkerfenster der Bibliothek, die im hinteren Teil des Hauses Nummer zwölf am Montrose Place gelegen war. Er und seine sechs Mitverschwörer, die Mitglieder des Bastion-Klubs, hatten das Haus drei Wochen zuvor erworben und waren nun dabei, es zu ihrer privaten Festung – einer letzten Bastion gegen die Kupplerinnen der Gesellschaft – umgestalten zu lassen. Das Haus hatte die perfekte Lage für ihre Zwecke; es befand sich in einem ruhigen Teil von Belgravia, nur wenige Straßen südöstlich des großen Parks gelegen, welcher den Stadtteil von Mayfair trennte, wo jeder der Junggesellen ein Haus besaß.
Das Bibliotheksfenster überblickte den hinteren Garten von Nummer zwölf sowie den Garten des etwas größeren Nachbarhauses Nummer vierzehn, in dem besagte Dame wohnte.
Billings, der Tischler, der für sie die Renovierungsarbeiten leitete, war im Türrahmen erschienen und studierte ein zerknittertes Blatt Papier.
»Ich würd vorschlagen, da wir ja jetzt mit den Neuanfertigungen im Groben fertig sind, mal abgesehen von den paar Schränken fürs Büro …«, er schaute auf. »Wenn Sie vielleicht mal’nen Blick draufwerfen würden, ob das alles so in Ihrem Sinne ist, dann könnten wir schon mit dem Streichen und Polieren weitermachen und mit dem Saubermachen anfangen, damit Sie’s sich hier recht bald gemütlich machen können.«
»Sehr gern.« Tristan schickte sich an, ihm zu folgen. »Ich komme sofort.« Er warf einen letzten Blick in den Nachbargarten und sah, wie ein flachsblonder Junge auf die Frau zulief. Sie drehte sich um, sah ihn erwartungsvoll an … und erhielt ganz offensichtlich die Nachricht, mit der sie gerechnet hatte.
Ihm war nicht klar, was ihn eigentlich so sehr an ihr faszinierte; zum einen bevorzugte er blonde Frauen mit üppigeren Reizen, und zum anderen war sie – angesichts seiner dringenden Suche nach einer Ehefrau – ganz offensichtlich zu alt, um dem Heiratsmarkt noch zur Verfügung zu stehen; sicherlich war sie bereits verheiratet.
Er zwang sich, den Blick von ihr abzuwenden. »Was denken Sie, wie lange wird es noch dauern, ehe man hier einziehen kann?«
»Nur’n paar Tage, im Höchstfall’ne Woche. Das Untergeschoss ist so gut wie fertig.«
Tristan gab Billings ein Zeichen voranzugehen und folgte ihm aus dem Raum.
»Miss, Miss! Der Gentleman is da!«
Na endlich! Leonora Carling atmete tief durch. Sie richtete sich auf, streckte den Rücken durch und löste die Spannung wieder, um dem Laufburschen ein Lächeln zu schenken. »Danke, Toby. Ist es derselbe Gentleman wie zuvor?«
Toby nickte. »Der, von dem Quiggs meint, es wär einer von den Besitzern.«
Quiggs war ein Tischlergeselle, der im Nachbarhaus arbeitete; neugierig, wie Toby war, hatte er mit dem Jungen Freundschaft geschlossen. Auf diesem Weg hatte Leonora schon so einiges über die Pläne der neuen Besitzer in Erfahrung bringen können – genug, um noch mehr erfahren zu wollen. Noch sehr viel mehr.
Tobys Haar war zerzaust, seine Wangen vom Wind gerötet; ungeduldig hüpfte er von einem Bein aufs andere. »Aber Sie müssen sich beeilen, wenn Sie ihn noch erwischen wollen. Quiggs hat gesagt, Billings will nur kurz mit ihm reden, und dann wird er wohl verschwinden.«
»Danke schön.« Leonora legte Toby eine Hand auf die Schulter und zog ihn mit sich, während sie zügig auf die Hintertür des Hauses zusteuerte. Henrietta, ihr Wolfshund, sprang aufgeregt um sie herum. »Ich werde gleich hinübergehen. Du warst mir eine große Hilfe – vielleicht können wir die Köchin ja davon überzeugen, dir ein Marmeladentörtchen abzutreten.«
»Klasse!« Tobys Augen weiteten sich; die Marmeladentörtchen waren geradezu legendär.
Harriet, Leonoras Zofe, eine etwas mollige und gewitzte Frau mit dichtem, rot gelocktem Haar, die schon seit vielen Jahren zum Haushalt gehörte, erwartete sie unmittelbar hinter der Tür zum Flur. Leonora forderte Toby auf, sich seine Belohnung abzuholen. Harriet wartete gerade so lange, bis der Junge außer Hörweite war, um Leonora zu fragen: »Sie werden doch wohl nichts Unüberlegtes tun?«
»Natürlich nicht.« Leonora blickte an sich herab und rückte das Oberteil ihres Kleides zurecht. »Aber ich muss unbedingt herausfinden, ob diese Gentlemen von nebenan dieselben Leute sind, die zuvor unser Haus kaufen wollten.«
»Und wenn sie es sind?«
»Wenn sie es sind, dann steckten sie vermutlich hinter all den Vorfällen, womit besagte Vorfälle ein für alle Mal beendet wären, oder aber sie wissen gar nichts von den versuchten Einbrüchen und den übrigen Ereignissen, was wiederum bedeuten würde …« Sie runzelte die Stirn und schob sich an Harriet vorbei. »Ich muss jetzt los. Toby sagte, der Herr sei im Begriff zu gehen.«
Leonora ignorierte Harriets besorgten Gesichtsausdruck und eilte durch die Küche. Sie wehrte all die üblichen Haushaltsfragen der Köchin, der Haushälterin Mrs Wantage und Castors, des uralten Butlers ihres Onkels, erfolgreich ab mit dem Versprechen, im Handumdrehen zurückzukehren und sich dann um alles zu kümmern; dann drängte sie durch die stoffbespannte Pendeltür hindurch in den Hauptflur.
Castor folgte ihr auf dem Fuß. »Soll ich Ihnen eine Droschke bestellen, Miss? Oder möchten Sie vielleicht von einem Diener begleitet werden …?«
»Weder noch.« Sie griff nach ihrem Mantel, warf ihn sich über die Schultern und band ihn hastig zu. »Ich werde nur kurz hinausgehen – ich bin sofort wieder zurück.«
Sie schnappte sich ihre Haube und setzte sie hastig auf. Dann warf sie einen knappen Blick in den Spiegel, um sich die Bänder zuzubinden. Sie beäugte sich einen Moment lang kritisch. Nicht perfekt, aber durchaus akzeptabel. Die Befragung fremder Männer gehörte nicht gerade zu ihren gewohnten Tätigkeiten, doch davon würde sie sich keinesfalls beirren lassen. Dafür war die Situation viel zu ernst.
Sie wandte sich zur Tür.
Castor stand bereit und sah sie mit leicht besorgter Miene an. »Was soll ich Sir Humphrey oder Mr Jeremy ausrichten, wenn sie fragen sollten, wohin Sie gegangen sind?«
»Sie werden nicht fragen. Und falls doch, sagen Sie einfach, dass ich mich im Nachbarhaus aufhalte.« Sie würden davon ausgehen, dass sie zu Miss Timmins gegangen war, die im Haus Nummer sechzehn wohnte, und nicht zu Nummer zwölf.
Henrietta saß mit geöffnetem Maul und hängender Zunge an der Tür, ihren hoffnungsvollen Hundeblick fest auf Leonora gerichtet …
»Du bleibst hier.«
Winselnd legte sich der große Jagdhund nieder und ließ seinen riesigen Kopf mit offenkundiger Empörung auf die Pfoten sinken.
Leonora ignorierte ihn. Sie wies ungeduldig auf die Tür; Castor hatte sie noch nicht ganz geöffnet, da trat sie bereits auf den Absatz der Eingangstreppe hinaus ins Freie. Sie blieb auf den Stufen stehen, um die Straße flüchtig zu überblicken; wie erhofft, war weit und breit niemand zu sehen. Erleichtert stieg sie die Treppe hinunter in den märchenhaften Garten vor ihrem Haus.
Normalerweise hätte der Garten sie abgelenkt oder wenigstens ihre Aufmerksamkeit erregt. Doch als sie heute den Mittelweg hinuntereilte, nahm sie die bezaubernden Büsche, die leuchtenden Beeren an ihren nackten Zweigen, die fremdartig filigranen Blätter kaum wahr. In diesem Augenblick konnten die fantastischen Gartenkünste ihres entfernten Cousins Cedric Carling ihre hastigen Schritte in Richtung Eingangstor nicht im Mindesten bremsen.
Bei den neuen Besitzern des Nachbarhauses handelte es sich um eine Gruppe adeliger Herren – so hatte es sich Toby zumindest erzählen lassen. In jedem Fall waren es Gentlemen, die in gesellschaftlichen Kreisen verkehrten. Anscheinend ließen sie das Haus komplett renovieren und umgestalten, obgleich niemand von ihnen vorhatte, dort zu wohnen – ein Umstand, den man zweifellos als sonderbar, um nicht zu sagen verdächtig beschreiben konnte. Und dann diese sonderbaren Zwischenfälle … Sie war fest entschlossen herauszufinden, ob da eine Verbindung bestand.
In den vergangenen drei Monaten hatte man sie und ihre Familie beharrlich dazu gedrängt, ihr Haus zu verkaufen. Zunächst war einer der örtlichen Makler an sie herangetreten. Was mit lästigen Überredungsversuchen begonnen hatte, verschlimmerte sich rasch zu harter, aggressiver Nötigung. Nichtsdestotrotz war es ihr irgendwann gelungen, den Makler und anscheinend auch dessen Kunden davon zu überzeugen, dass ihr Onkel nicht gewillt war, das Haus zu verkaufen.
Doch ihre Erleichterung war nur von kurzer Dauer gewesen.
Innerhalb weniger Wochen hatte man gleich zweimal versucht, bei ihnen einzubrechen. Beide Male war der Täter verjagt worden, einmal vom Personal und das andere Mal von Henrietta. Leonora hätte dies als Zufall abgetan, hätte man sie nicht kurz darauf persönlich angegriffen.
Und diese körperlichen Übergriffe waren noch weitaus beängstigender als alles andere.
Außer Harriet hatte sie niemandem davon erzählt, weder ihrem Onkel Humphrey noch ihrem Bruder Jeremy und ebenso wenig den Angestellten. Sie hatte das Personal nicht beunruhigen wollen, und was ihren Onkel und ihren Bruder anging …, sofern sie ihr überhaupt Glauben geschenkt hätten – anstatt die Vorfälle ihrer überspannten weiblichen Fantasie zuzuschreiben -, wären sie sicherlich bestrebt gewesen, Leonoras Freiheit einzuschränken, und hätten es ihr damit erschwert, das Problem selbst in die Hand zu nehmen – nämlich herauszufinden, wer hinter der ganzen Sache steckte, dessen Beweggründe zu erfahren und weitere Vorfälle zu unterbinden.
Dies war ihr Ziel; sie hoffte, dass der Gentleman von nebenan sie in ihren Bestrebungen einen guten Schritt voranbringen würde.
Sie erreichte das große schmiedeeiserne Tor, das die hohe Mauer durchbrach, zog es auf und schlüpfte rasch hindurch. Dann wandte sie sich eilig nach rechts zum Haus Nummer zwölf …
Und kollidierte mit einem lebenden Monument.
»Oh!«
Sie prallte ab wie von einer Wand.
Der kräftige Körper gab keinen Millimeter nach, reagierte dafür jedoch blitzschnell.
Ehe sie sichs versah, hatten zwei starke Hände sie oberhalb der Ellbogen gepackt.
Funken stoben und knisterten, ausgelöst durch die Kollision. Ein eigentümliches Gefühl durchfuhr ihren Körper, ausgehend vom Griff seiner Hände.
Er hielt sie fest, damit sie nicht fiel.
Doch er hielt sie zugleich gefangen.
Leonora stockte der Atem. Ihre weit aufgerissenen Augen begegneten dem starren haselnussbraunen Blick ihres Gegenübers und blieben gebannt daran hängen. Sein Blick war überaus durchdringend. Im nächsten Moment blinzelte er; schwere Lider verhüllten für einen kurzen Moment seine Augen. Seine wie in Granit gemeißelten Züge wurden weich und nahmen einen durch und durch charmanten Ausdruck an.
Seine Lippen verwandelten sich von einer schmalen Linie harter Entschlossenheit in weiche, sinnliche Kurven.
Er lächelte.
Sie zwang ihren Blick zurück zu seinen Augen. Und errötete.
»Es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte vielmals.« Sie trat nervös einen Schritt zurück, befreite sich. Seine Finger lockerten sich; seine Hände glitten von ihren Armen. Bildete sie sich das nur ein, oder ließ er sie nur widerwillig los? Ihre Haut prickelte; ihre Nerven lagen blank. Während sie hastig weiterredete, fühlte sie sich seltsam atemlos. »Ich habe Sie gar nicht kommen sehen …«
Ihr Blick wanderte für einen Moment hinüber zum Haus Nummer zwölf. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, aus welcher Richtung er gekommen sein musste – die Bäume entlang der Grundstücksmauer zwischen den beiden Häusern waren die einzige mögliche Erklärung, weshalb er ihr nicht aufgefallen war, als sie die Straße inspiziert hatte.
Ihre Nervosität löste sich in Luft auf; sie blickte wieder zu ihm auf. »Sind Sie der Gentleman von Nummer zwölf?«
Er zuckte mit keiner Wimper; nicht der geringste Anflug von Verwunderung zeigte sich angesichts dieser ungewöhnlichen Begrüßung – dem Ton nach eher eine Anschuldigung – auf seinem attraktiv lebhaften Gesicht. Er hatte dunkelbraunes Haar, das er etwas länger trug, als es die aktuelle Mode vorschrieb; auf seinen Zügen lag ein deutlicher Ausdruck von autokratischer Selbstsicherheit. Ein winziger und doch spürbarer Augenblick verstrich, ehe er seinen Kopf neigte und antwortete: »Tristan Wemyss. Earl of Trentham … zu meinem großen Leidwesen.« Sein Blick fiel an ihr vorbei zum Eingangstor. »Ich nehme an, Sie wohnen hier?«
»Ganz recht. Gemeinsam mit meinem Onkel und meinem Bruder.« Sie hob ihr Kinn, atmete gezwungen ein und betrachtete seine Augen, die hinter den dunklen Wimpern goldbraun schimmerten. »Ich bin froh, dass ich Sie erwischt habe. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob Sie und Ihre Freunde es waren, die im vergangenen November mittels Makler Stolemore versucht haben, meinen Onkel zum Verkauf unseres Hauses zu bewegen.«
Sein Blick kehrte zurück zu ihrem Gesicht; er betrachtete es forschend, so als könne er darin deutlich mehr lesen, als ihr lieb war. Seine Gestalt war groß und breitschultrig; darüber hinaus ließ sein eindringlicher Blick keine weitergehende Betrachtung zu, doch ihrem ersten Eindruck nach ruhte hinter der schlichten eleganten Fassade ein unerwartet muskulöser Kern. Sie hatte einen gewissen Widerspruch wahrgenommen, als sie in ihn hineingerannt war; wie er aussah und wie er sich anfühlte, schien nicht recht zusammenpassen zu wollen.
Weder sein Name noch der Titel sagten ihr irgendetwas. Noch nicht; sie würde nachher in Debrett’s Adelsverzeichnis nachschlagen. Ihr fiel auf, dass seine Haut leicht sonnengebräunt war, eine Tatsache, die ebenfalls nicht so recht zu einem Gentleman passte … Ihr war so, als wolle ihr jeden Moment eine Erklärung hierfür einfallen, aber sein intensiver Blick lenkte sie zu sehr ab, um diesen Gedanken weiterverfolgen zu können. Sanft gewelltes Haar umrahmte seine hohe Stirn, die sich leicht kräuselte, als er seine fein geschwungenen Augenbrauen nachdenklich zusammenzog.
»Nein.« Er zögerte kurz, dann fügte er hinzu: »Wir haben Mitte Januar von einem Bekannten erfahren, dass das Haus Nummer zwölf zum Verkauf steht. Stolemore hat den Kauf zwar vermittelt, doch alles Weitere haben wir mit den Besitzern selbst geregelt.«
»Ach.« All ihre Gewissheit wich; ihre Streitlust verebbte. Dennoch folgte sie ihrem Drang zu fragen: »Dann haben Sie also mit den damaligen Offerten nichts zu tun? Oder mit den übrigen Vorfällen?«
»Offerten? Demnach war jemand interessiert daran, das Haus Ihres Onkels zu kaufen?«
»Und ob. Sehr interessiert sogar.« Das Ganze hatte sie beinahe um den Verstand gebracht. »Wie auch immer, wenn Sie oder Ihre Freunde nichts damit zu tun hatten …« Sie unterbrach sich. »Sie sind sich doch sicher, dass es keiner Ihrer Freunde …?«
»Ganz sicher. Wir haben von vornherein alles gemeinsam geregelt.«
»Verstehe.« Sie atmete entschlossen ein und hob ihr Kinn noch ein wenig höher. Er war einen ganzen Kopf größer als sie; es fiel ihr daher nicht leicht, eine gestrenge Haltung einzunehmen. »In jedem Fall habe ich wohl das Recht zu erfahren, was Sie mit dem Haus, das Sie nun erworben haben, zu tun gedenken? Soweit ich gehört habe, werden weder Sie noch einer Ihrer Freunde dort einziehen?«
Ihre Vermutung – ihr Verdacht – strahlte nur so aus ihren hübschen blauen Augen hervor. Sie hatte eine atemberaubende Augenfarbe – weder violett noch schlicht blau; sie erinnerte Tristan an die Farbe von Veilchen in der Dämmerung. Ihr unerwartetes Auftauchen, der flüchtige Moment ihrer kurzen – viel zu kurzen – Kollision, als sie ihm wider aller Wahrscheinlichkeit geradewegs in die Arme gelaufen war … Angesichts seiner unzüchtigen Gedanken von vorhin und der Leidenschaft, die sich in den vergangenen Wochen aufgestaut hatte, während er vom Bibliotheksfenster aus beobachtet hatte, wie sie durch den Garten schlenderte – angesichts all dessen hatte ihn ihre unerwartet stürmische Bekanntmachung etwas aus dem Konzept gebracht.
Ihre offenkundigen Befürchtungen brachten ihn unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück.
Er zog eine Augenbraue hoch und entgegnete mit einem Anflug von Arroganz: »Meine Freunde und ich waren lediglich auf der Suche nach einem ruhigen Ort, an den wir uns zurückziehen können. Ich versichere Ihnen, unsere Absichten sind in keiner Weise anstößig, illegal oder …« Er hatte hinzufügen wollen »gesellschaftlich inakzeptabel«, aber die Anstandsdamen der feinen Gesellschaft würden das wahrscheinlich anders sehen. Ohne seinen Blick abzuwenden, improvisierte er mühelos: »… der Art, die unter prüden Seelen Aufsehen erregen würde«.
Anstatt sich davon den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen, kniff sie die Augen zusammen und erwiderte: »Ich dachte, das sei der Sinn und Zweck solcher Herrenklubs. Nur ein paar Straßen von hier entfernt, in Mayfair, befinden sich viele derartige Etablissements.«
»Durchaus. Wir hingegen legen Wert auf ein bisschen Privatsphäre. « Er war nicht gewillt, ihr die wahren Interessen ihres Klubs offenzulegen. Bevor sie einen neuerlichen Angriff starten konnte, nahm er die Unterhaltung selbst in die Hand. »Die Leute, die das Haus Ihres Onkels kaufen wollten – waren sie sehr aufdringlich?«
Die Erinnerung weckte in ihr eine neuerliche Wut. »Und ob! Sie, besser gesagt, ihr Makler entwickelte sich zu einer regelrechten Plage.«
»Die Interessenten haben sich also nie persönlich an Ihren Onkel gewandt?«
Sie runzelte die Stirn. »Nein. Stolemore trat mit ihren Angeboten an uns heran, aber das war schon schlimm genug.«
»Inwiefern?«
Als sie zögerte, machte er ihr einen Vorschlag. »Stolemore ist der Makler, der uns unser Haus vermittelt hat. Ich wollte ohnehin heute noch mit ihm sprechen. War er es, der sich so unangenehm verhalten hat, oder …«
Sie verzog das Gesicht. »Ich möchte nicht behaupten, dass er sich aus eigenem Antrieb so verhalten hat. Ich nehme eher an, es lag an den Leuten, die ihn beauftragt haben – kein Makler könnte lange im Geschäft bleiben, wenn er sich immer derart aufführt; und bisweilen schien ihm sein eigenes Verhalten sogar regelrecht unangenehm zu sein.«
»Verstehe.« Er sah sie wieder an. »Und von welchen anderen Vorfällen haben Sie gesprochen?«
Sie war nicht gewillt, mit ihm darüber zu sprechen, und wünschte sich inständig, sie hätte die Vorfälle gar nicht erst erwähnt; ihre Augen und ihre Lippen verrieten dies nur allzu deutlich.
Er wartete ab und sah ihr unverwandt in die Augen; unbeirrt ließ er die Stille andauern, seine Haltung unnachgiebig, aber nicht drängend. Wie schon viele andere vor ihr deutete sie seine Botschaft richtig und gab spitz zurück: »Man hat zweimal versucht, bei uns einzubrechen.«
Er sah sie nachdenklich an. »Beide Male, nachdem Sie den Kauf abgelehnt hatten?«
»Der erste Einbruchsversuch geschah eine Woche nachdem Stolemore aufgegeben hatte und uns endlich in Ruhe ließ.«
Tristan zögerte, doch sie sprach seine Gedanken aus.
»Natürlich besteht zwischen den Einbruchsversuchen und dem Kaufangebot kein eindeutiger Zusammenhang.«
Außer, dass sie selbst felsenfest davon überzeugt war.
»Ich nahm an«, fuhr sie fort, »wenn Sie und Ihre Freunde hinter diesen mysteriösen Offerten gesteckt hätten, so würde dies bedeuten, dass die versuchten Einbrüche und …«, sie unterbrach sich gerade noch rechtzeitig und nahm einen tiefen Atemzug, »nichts mit dem Verkauf zu tun hätten, sondern andere Gründe haben müssten.«
Er nickte leicht; ihre Argumentation war stichhaltig, und dennoch hatte sie ihm ganz offensichtlich etwas vorenthalten. Er war einen Moment lang unschlüssig, ob er sie zu einer Antwort drängen und sie geradeheraus fragen sollte, ob die versuchten Einbrüche der einzige Grund waren, weshalb sie zu ihm herausgestürzt war, um sich – allen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zum Trotz – hier ein Gefecht mit ihm zu liefern. Sie warf einen kurzen Blick hinüber zum Eingangstor. Eine solche Befragung konnte warten; wie die Dinge standen, mochte ein Gespräch mit Stolemore sich als aufschlussreicher erweisen. Als ihr Blick zu ihm zurückkehrte, lächelte er sie an. Und zwar äußerst charmant. »Ich würde sagen, Sie haben mir etwas voraus.«
Als sie ihn verständnislos anblinzelte, fuhr er fort: »Da wir von nun an gewissermaßen Nachbarn sind, wäre es doch sicher nicht unangemessen, wenn Sie mir Ihren Namen verrieten.«
Sie musterte ihn – nicht argwöhnisch, aber abschätzend. Dann nickte sie und hielt ihm die Hand hin. »Miss Leonora Carling.«
Sein Lächeln wurde breiter. Er ergriff für einen kurzen Moment ihre Finger und verspürte den unbändigen Drang, diese festzuhalten. Sie war also keineswegs verheiratet. »Freut mich, Miss Carling. Und Ihr Onkel ist …?«
»Sir Humphrey Carling.«
»Und Ihr Bruder?«
Ihre Augen funkelten skeptisch. »Jeremy Carling.«
Er lächelte unbeirrt weiter, um mögliche Bedenken zu zerstreuen. »Leben Sie schon lange hier? Dies scheint mir auf den ersten Blick eine eher friedliche Gegend zu sein, oder täuscht dieser Eindruck?«
Ihre leicht zusammengekniffenen Augen verrieten, dass sie sich nicht von ihm täuschen ließ. Sie beantwortete nur seine zweite Frage. »Überaus friedlich.«
Zumindest bis vor Kurzem. Sie hielt seinem unangenehm eindringlichen Blick stand. Dann fügte sie mit unmissverständlichem Nachdruck hinzu: »Wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt.«
Sie sah, wie seine Mundwinkel flüchtig zuckten, ehe er seinen Blick zu Boden sinken ließ.
»In der Tat.« Mit einer einladenden Bewegung bot er an, sie die paar Schritte zum Tor zu begleiten. Sie wandte sich bereitwillig um, doch im nächsten Moment wurde ihr schmerzlich bewusst, dass sie ihm damit stillschweigend eingestanden hatte, nur seinetwegen aus dem Haus gestürmt zu sein. Sie sah zu ihm auf und erkannte an seinem Blick, dass er ihr Eingeständnis durchschaut hatte. Schlimm genug. Doch der funkelnde Ausdruck in seinen haselnussbraunen Augen, der all ihre Sinne durchzuckte und ihr den Atem stocken ließ, war noch unendlich viel schlimmer.
Aber schließlich ließ er seine Augenlider sinken und lächelte so charmant wie zuvor. Sie kam immer mehr zu der Überzeugung, dass sein Ausdruck nichts weiter war als eine Maske.
Vor dem Tor blieb er stehen und streckte ihr die Hand hin.
Die Höflichkeit verlangte, dass sie ihm ihre Finger erneut auslieferte.
Seine Hand schloss sich um die ihre; sein viel zu scharfsichtiger Blick hielt sie gefangen. »Ich hoffe, wir werden unsere Bekanntschaft bald vertiefen, Miss Carling. Bitte übermitteln Sie Ihrem Onkel meine aufrichtigen Grüße; ich werde ihm, sobald es geht, meine Aufwartungen machen.«
Sie neigte höflich den Kopf, der Etikette bewusst gehorchend, obwohl sie ihm am liebsten auf der Stelle ihre Hand entzogen hätte. Es kostete sie einige Mühe, das Zittern ihrer Finger zu unterdrücken. Sein kühler, fester, vielleicht etwas zu starker Händedruck brachte ihr Gleichgewicht auf eine ganz und gar seltsame Art ins Wanken. »Guten Tag, Lord Trentham.«
Er gab ihre Hand frei und verneigte sich.
Sie drehte sich um, trat durchs Tor und warf es hinter sich zu. Ihre Blicke trafen sich flüchtig, bevor sie sich endgültig dem Haus zuwandte.
Dieser winzige Augenblick reichte aus, um ihr erneut den Atem zu rauben.
Während sie den Weg entlangschritt, bemühte sie sich vergeblich weiterzuatmen – sie spürte seinen Blick nach wie vor auf ihr ruhen. Dann erkannte sie am Geräusch seiner Schuhe, dass er sich umdrehte, und schließlich hörte sie seine festen Schritte, die sich auf dem Gehweg entfernten. Endlich nahm sie einen tiefen Atemzug und ließ die Luft erleichtert entweichen. Was hatte Trentham nur an sich, dass er sie derart nervös machte?
Nervös weswegen?
Das Gefühl seiner harten, beinahe schwieligen Hand unter ihren Fingern wirkte noch nach – wie eine sinnliche Erinnerung, die sich ihr eingebrannt hatte. Ein vager Gedanke versuchte, wie bereits zuvor, Gestalt anzunehmen, doch er entglitt ihr erneut. Obwohl sie Trentham noch nie zuvor begegnet war – daran bestand kein Zweifel -, kam ihr irgendetwas an ihm vertraut vor.
Während sie die Treppe zum Eingang hinaufstieg, schüttelte sie innerlich den Kopf und zwang sich, ihre Gedanken ausschließlich auf die von ihr zuvor vernachlässigten Pflichten zu richten.
Tristan schlenderte auf eine kleine Ansammlung von Ladenlokalen in der Motcomb Street zu, wo sich auch Earnest Stolemores Maklerbüro befand. Das Gespräch mit Leonora Carling hatte seine Sinne geschärft und Instinkte in ihm wachgerufen, die noch vor nicht allzu langer Zeit fester Bestandteil seines alltäglichen Lebens gewesen waren. Nicht selten hatte sein Leben davon abgehangen, dass er diese Instinkte genau analysierte und korrekt interpretierte.
Er war sich nicht ganz sicher, was er von Miss Carling – oder Leonora, wie er sie innerlich nannte, immerhin hatte er sie bereits volle drei Monate lang beobachtet – eigentlich halten sollte. Sie war noch deutlich attraktiver, als er es aus der Entfernung angenommen hatte. Ihr dichtes mahagonifarbenes Haar war durchzogen von granatfarbenen Reflexen; ihre ungewöhnlich blauvioletten Augen waren groß und mandelförmig und wurden von feinen, dunklen Augenbrauen überspannt. Sie hatte eine gerade Nase, fein modellierte Züge, hohe Wangenknochen und eine blasse, makellose Haut. Doch es waren ihre Lippen, die ihrem Gesicht einen ganz besonderen Charakter verliehen – volle, weich geschwungene Lippen von dunklem Rosa, die einen Mann regelrecht dazu aufforderten, sie zu schmecken, sie zu kosten.
Seine spontane körperliche Reaktion, ebenso wie die ihre, war ihm durchaus nicht entgangen. Es war vor allem ihre Reaktion, die ihn so faszinierte; es schien, als wäre ihr gar nicht bewusst, was es mit diesem plötzlichen Aufflammen sinnlicher Empfindungen eigentlich auf sich hatte.
Woraus sich einige höchst interessante Fragen ergaben, die er sicherlich noch weiterverfolgen würde – allerdings nicht jetzt. Im Moment waren es vielmehr die banalen Fakten, die sich aus ihrer Unterhaltung ergeben hatten, welche seinen Intellekt beschäftigten.
Ihre Ängste und Befürchtungen bezüglich der versuchten Einbrüche mochten ihrer zu ausgeprägten weiblichen Fantasie entsprungen sein, ausgelöst von dem einschüchternden Verhalten Stolemores, der sie zum Verkauf nötigen wollte.
Möglicherweise hatte sie sich die Vorfälle sogar gänzlich eingebildet.
Doch sein Instinkt war da anderer Meinung.
In seinem bisherigen Betätigungsfeld hatte er sich darauf verlassen müssen, Menschen richtig zu deuten, sie richtig einzuschätzen; er hatte den Bogen seit Langem raus. Er war überzeugt davon, dass es sich bei Leonora Carling um eine starke, überaus praktisch veranlagte Frau handelte, die zudem eine ordentliche Portion gesunden Menschenverstand besaß. Gewiss nicht die Art von Frau, die vor einem Schatten zusammenzuckt und sich Einbrüche einbildet.
Wenn ihre Vermutung hingegen stimmte und die Einbrüche tatsächlich mit Stolemores Kunden und dessen Kaufbestrebungen zusammenhingen …
Er kniff die Augen zusammen. Allmählich enthüllte sich ihm ein Bild, das Leonoras Verhalten – ihn so unvermittelt auf der Straße zu konfrontieren – durchaus nachvollziehbar machte. Und dieses Gesamtbild wollte er, nein, würde er keinesfalls akzeptieren. Entschlossenen Schrittes ging er weiter.