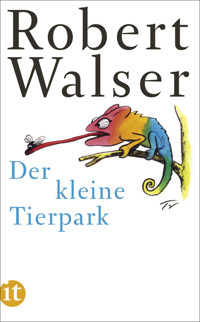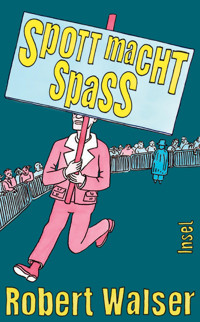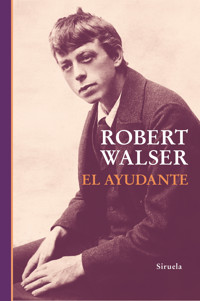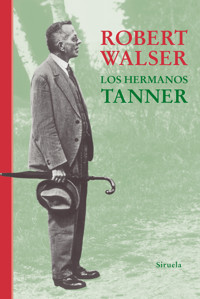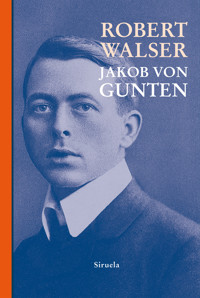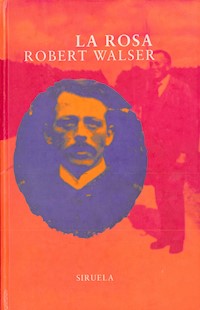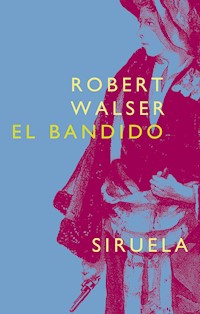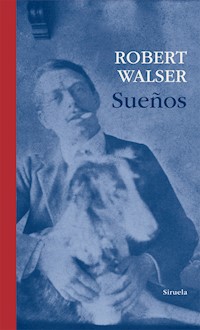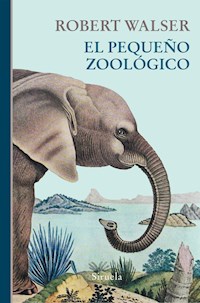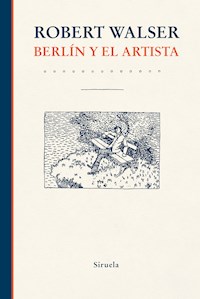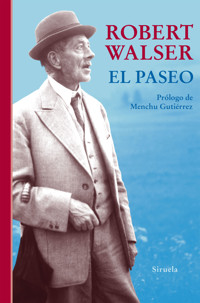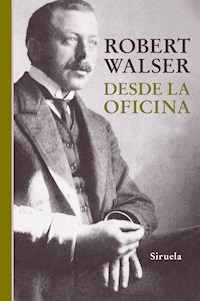11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit jeher hat Robert Walser bildende Künstler auf der ganzen Welt inspiriert. Auch für Thomas Hirschhorn, einem der provokativsten und innovativsten Künstler der Gegenwart, ist er eine Leitfigur, ein »Held«, der für wahres Künstlertum steht. Walsers Kunstanspruch ist stets an einen persönlichen Standpunkt geknüpft, der zum Betrieb Distanz markiert.
Die vorliegende ›Blütenlese‹ enthält eine Auswahl von Robert Walsers besten Texten – ein idealer Einstieg in das Werk eines Autors, dessen poetisch bildhaftes Schreiben eine ungebrochene Wirkungsmacht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Robert Walser
Eine Ohrfeige und sonstiges
Ausgewählt von Thomas Hirschhorn und Reto Sorg
Mit einem Vorwort von Thomas Hirschhorn
Suhrkamp
Inhalt
Vorwort
Warum ich Robert Walser, seine Bücher und seine Texte liebe
Der Greifensee
Ein Maler
Was ist Bühnentalent?
Das Theater, ein Traum
Kennen Sie Meier?
Lustspielabend
Guten Tag, Riesin!
Kleist in Thun
Kutsch
Der Schriftsteller (I)
Tell in Prosa
Der Schriftsteller (II)
Fabelhaft
Aschinger
Die Schlacht bei Sempach
Gebirgshallen
Auf der Elektrischen
Friedrichstraße
Berlin und der Künstler
Die Frau des Dramatikers
Hose
Was aus mir wurde
Zu der Arlesierin von van Gogh
Helblings Geschichte
Brief eines Dichters an einen Herrn
Wirtshäuselei
Das Zimmerstück
Rede an einen Knopf
Würzburg
Nervös
Poetenleben
Büren
Der Sekretär
Basta
Die Wurst
Das letzte Prosastück
Die Gedichte
Freiburg
Der Leseabend
Fidelio
Die Eroberung von Paris
Ich ging wieder einmal ins Theater
Walser über Walser
Tagebuchblatt
Das seltsame Mädchen
Der Affe
Die Kellersche Novelle
Die Schöne und der Treue
Eine Ohrfeige und sonstiges
Kurt
Wladimir
Ich will in diesem zunächst bescheidenen, gleichsam dünnen und kleinen Memorandum
»Verkannte Dichter unter uns?«
Antwort auf eine Umfrage der »Neuen Zürcher Zeitung«
Einmal gab es da so eine Art Persönlichkeit
Krachen wie Schlangen
Der heiße Brei
Minotauros
Meines Wissens gab es einmal einen Dichter, der sich als ein außerordentlich zartsinniger Frauenbegleiter auswies
Ohne mich lang zu besinnen, nenne ich ihn Olivio
Die leichte Hochachtung
Einmal lebte ein für ernste Menschen Lustigkeiten dichtender Spaßmacher
Eine Art Erzählung
Für die Katz
Meine Bemühungen
Textnachweise
Vorwort
Warum ich Robert Walser, seine Bücher und seine Texte liebe
Jeder Text, jedes Buch, jedes der Bücher von Robert Walser ist notwendig für mich, der kürzeste Text, das dünnste Buch. Denn jedes seiner Bücher, jeder seiner Texte zählt. Alle Bücher und alle Texte sind gleich wichtig. Wichtig heißt nicht bedeutsam. Kein Text, kein Buch ist nicht ›bedeutsam‹ oder ›bedeutungsvoll‹, denn auch ›schlechte Bücher‹ sind bedeutungsvoll, das gilt für alle Bücher. Es geht nicht um Bedeutung, es geht nie um Bedeutung. Es geht darum, dass die von mir ausgewählten Texte von Robert Walser unverzichtbar sind. Unverzichtbar sind Wladimir, Meine Bemühungen und auch Berlin und der Künstler. Alle in dieser Anthologie zusammengefassten Texte sind unverzichtbar, und alle diese Texte behaupten einen eigenen Sinn jenseits der Bedeutung.
Diese Texte sind Sinnbehauptungen. Wichtig ist, dass sie Behauptungen sind und dass sie darauf insistieren, Behauptungen – gegen eine Bedeutung – zu sein. Es geht darum, die Texte gegen ihren bloßen ›Inhalt‹ aufzurichten, gegen ihren Inhalt zu verteidigen. Es geht darum, den Text Eine Ohrfeige und sonstiges gegen seinen eigenen Inhalt zu lesen! Nicht um ihn von seinem Inhalt zu entfernen, sondern um zu zeigen, dass die Sinnbehauptung, die sie darstellen, alles ›nur Inhaltliche‹ hinter sich lässt. Es geht darum, dass diese Texte ihren eigenen Inhalt verraten, indem sie auf etwas anderem als auf ihrem Inhalt insistieren.
Ich liebe die Texte und die Bücher von Robert Walser nicht wegen ihres Inhalts. Ich liebe sie als Widerstände, als absolute Forderungen, weil sie Forderungen und Überforderungen sind. Robert Walser war ein Widerständiger. Im kurzen Text Walser über Walser wird das ersichtlich, widersteht Robert Walser doch der ›wohlwollenden‹ Bezeichnung ›Schriftsteller‹. Er wehrt sich, wenn jemand – mit scheinbarem Überblick – sich an ihn, den ›Schriftsteller‹, wendet. Er wehrt sich – präzise und grausam, grausam gegen sich selbst –, auf seine Romane Der Gehülfe und Geschwister Tanner verweisend, weil er genau weiß, was es heißt, den Preis für ›Schriftstellerei‹ zu bezahlen. Robert Walser hat den Preis – den Preis, seine Arbeit zu machen, Schriftsteller zu sein – als Erster bezahlt. So habe ich das ›Nicht-mehr-Schreiben‹ oder ›das Schweigen‹ Robert Walsers – während seiner Herisauer Jahre von 1933 bis 1956 – immer als eine absolute künstlerische Geste, eine souveräne, radikale künstlerische Haltung verstanden. Sein Schweigen kann nicht hoch genug geschätzt werden.
Im Text Brief eines Dichters an einen Herrn schreibt Robert Walser, dass er – oder der arme junge Dichter – jemand sei, den es sich nicht lohnt kennenzulernen. Was als Bescheidenheit, Unterwürfigkeit, mangelndes Selbstvertrauen oder falsche Bescheidenheit oder gespielte Unterwürfigkeit oder vorgespieltes mangelndes Selbstvertrauen verstanden werden kann – und da liegt die Dimensionslosigkeit, das alles Sprengende – von Robert Walsers Schreiben, zeigt die radikale Haltung des Künstlers und des Autors auf.
Er bestimmt: Es geht nur um den Text, es geht nur um den Text Robert Walsers – es geht nicht um die Person – Robert Walser –, die Person, die diesen Text geschrieben hat. Robert Walser zeigt auf: Es geht nie um die Person, es geht nie um ihn, es geht nie um ›das Persönliche‹. Aber, klar, er spielt – wortreich – damit, einmal prahlend, dann sich entschuldigend. Mit dem Feuer spielend, sich selbst verbrennend, verachtet Robert Walser ›das Persönliche‹.
Im Text Das Zimmerstück sieht Robert Walser mit chirurgischer Genauigkeit, wie ein abgenutzter Regenschirm an einem ebenso abgenutzten Nagel hängt. Er beschreibt mit Präzision, »wie Schwaches in seiner Schwachheit anderes Schwaches noch stützt«, und insistiert – mit seinem geschärften Blick ›fürs Schwache‹ –, wie sich ein bodenloser Abgrund eröffnet und wie dieser Abgrund uns Lesenden anbietet, uns zu verschlingen. So lustvoll, wie sich der Autor freiwillig – und sich auf diesem Weg befreiend – selbst verschlingen ließ.
Hier zeigt er mir: Robert Walser war frei, er war frei mit dem ihm Eigenen. Frei zu sein mit dem Eigenen heißt, ganz von diesem Eigenen auszugehen, und es heißt ›Form geben‹ – ausgehend von seinem Eigenen. Das Eigene, womit Robert Walser operiert, hat – an sich – keine Form. Es braucht sie nicht, denn die Form entsteht erst, wenn sie sich an den anderen richtet, wenn sie sich nach außen stülpt – das macht Robert Walser.
So ist mir immer wieder aufgefallen, dass viele Robert Walser für sich selbst behalten wollen. Robert Walser ist jemand, der es schafft, ausschließlich, egoistisch, egotistisch, völlig vereinnahmend, absolut exklusiv geliebt zu werden. Viele denken – auch ich bin keine Ausnahme –, dass nur sie Robert Walser ›richtig‹ verstehen, ›richtig‹ kennen, ›richtig‹ ehren, ›richtig‹ lieben würden. Eine solche Ausschließlichkeit bewirken nur die ganz Großen. Es geht aber nicht darum, diese Ausschließlichkeit zu verstärken, aufzuheben oder zu vermindern, sondern es geht darum, in diese Ausschließlichkeit Löcher zu schlagen und Öffnungen zu schneiden, um Durchlässigkeit zu ermöglichen und einen Durchbruch – unzählige Durchbrüche – zu schaffen.
Robert Walser hat sich selbst verloren, er hat sich für mich verloren, er ist der Schriftsteller des existenziellen Verlusts und der existenziellen Unsicherheit. Er hat sich – für uns – auf seinem Weg verloren. Robert Walser hat dem Prekären, dem Unsicheren, dem Ungewissen, dem Nicht-Garantierten, dem Fragilen, dem Labilen einen Weg geebnet, einen Pfad getreten.
Die Sprache von Robert Walser ist es, die den Weg aufweist, verschlungen, porös, ziellos – ein Holzweg. Seine Sprache zerfließt, hebt sich auf, löst sich auf – wie nasse Fußabdrücke auf einem heißen Steinboden. Es ist eine Sprache der Selbstauflösung, die mir ermöglicht, mich in sie hineinzuleben, ohne mich selbst dabei aufzulösen. Robert Walser hat dafür den Preis bezahlt.
In seiner Radikalität und Bereitschaft, den Preis für seine Arbeit zu bezahlen, ist er ein Beispiel für jede Künstlerin und jeden Künstler, jede Philosophin und jeden Philosophen, jede Schriftstellerin und jeden Schriftsteller. In Brief eines Dichters an einen Herrn schreibt Robert Walser: »Ich stehe auf der Erde: dies ist mein Standpunkt.« Damit gibt er mir den Schlüssel, um in dieser komplexen, ja hyperkomplexen Welt eine Position – meine ganz eigene Position – einzunehmen, zu finden und zu behaupten. Ich stehe auf der Welt, links und rechts, hinten und vorne biegt sie sich zum Abgrund – aber ich stehe darauf – ich stehe!
Robert Walser beleuchtet das Kleine, das Unbeachtete, das Unernste, das Unscheinbare. Er beleuchtet, was im Schatten ist, er hält – für mich – die Taschenlampe im Dunkeln. Ich habe von ihm gelernt, dass alles als wichtig erachtet werden muss, denn alles ist wichtig. Ich habe gelernt, dass alles wichtig sein kann und dass alles wichtig werden kann, und ich habe gelernt, dass nichts unwichtig ist. Robert Walser hat einen Text geschrieben mit dem Titel Wenn Schwache sich für stark halten. Er hat diesen Satz nicht nur niedergeschrieben, sondern er hat ihn vorgelebt, er hat ihn für mich, für uns aufgeschrieben. Er hat es rebellisch und mit Freudigkeit vorgelebt – wahrlich widerständig im Misserfolg und wahrlich widerstrebend gegenüber dem Erfolg.
Robert Walser stellt für mich die Frage: Was bedeutet Erfolg? Was bedeutet Misserfolg? Bin ich bereit, eine Arbeit jenseits von Erfolg und Misserfolg zu machen? Wir müssen erkennen, dass Misserfolg zu haben, nicht heißt, ›Opfer‹ zu sein, Misserfolg zu haben, kann ein Heldenakt sein. Robert Walser ist ein Held.
Ich will Robert Walser als Helden sehen, aber ich will ihn nicht für mich selbst behalten, deshalb diese – zusammen mit Reto Sorg vorgenommene und vorliegende – Text-Auswahl, diese Anthologie oder noch schöner: diese Blütenlese.
Thomas Hirschhorn
Der Greifensee
Es ist ein frischer Morgen und ich fange an, von der großen Stadt und dem großen bekannten See aus nach dem kleinen, fast unbekannten See zu marschieren. Auf dem Weg begegnet mir nichts als alles das, was einem gewöhnlichen Menschen auf gewöhnlichem Wege begegnen kann. Ich sage ein paar fleißigen Schnittern »guten Tag«, das ist alles; ich betrachte mit Aufmerksamkeit die lieben Blumen, das ist wieder alles; ich fange gemütlich an, mit mir zu plaudern, das ist noch einmal alles. Ich achte auf keine landschaftliche Besonderheit, denn ich gehe und denke, daß es hier nichts Besonderes mehr für mich gibt. Und ich gehe so, und wie ich so gehe, habe ich schon das erste Dorf hinter mir, mit den breiten großen Häusern, mit den Gärten, welche zum Ruhen und Vergessen einladen, mit den Brunnen, welche platschen, mit den schönen Bäumen, Höfen, Wirtschaften und anderem, dessen ich mich in diesem vergeßlichen Augenblick nicht mehr erinnere. Ich gehe immer weiter und werde zuerst wieder aufmerksam, wie der See über grünem Laub und über stillen Tannenspitzen hervorschimmert; ich denke, das ist mein See, zu dem ich gehen muß, zu dem es mich hinzieht. Auf welche Weise es mich zieht, und warum es mich zieht, wird der geneigte Leser selber wissen, wenn er das Interesse hat, meiner Beschreibung weiter zu folgen, welche sich erlaubt, über Wege, Wiesen, Wald, Waldbach und Feld zu springen bis an den kleinen See selbst, wo sie stehen bleibt mit mir und sich nicht genug über die unerwartete, nur heimlich geahnte Schönheit desselben verwundern kann. Lassen wir sie doch in ihrer althergebrachten Überschwenglichkeit selber sprechen: Es ist eine weiße, weite Stille, die wieder von grüner luftiger Stille umgrenzt wird; es ist See und umschließender Wald; es ist Himmel, und zwar so lichtblauer, halbbetrübter Himmel; es ist Wasser, und zwar so dem Himmel ähnliches Wasser, daß es nur der Himmel und jener nur blaues Wasser sein kann; es ist süße blaue warme Stille und Morgen; ein schöner, schöner Morgen. Ich komme zu keinen Worten, obgleich mir ist, als mache ich schon zu viel Worte. Ich weiß nicht, wovon ich reden soll; denn es ist alles so schön, so alles der bloßen Schönheit wegen da. Die Sonne brennt herab vom Himmel in den See, der ganz wie Sonne wird, in welcher die schläfrigen Schatten des umrahmenden Lebens leise sich wiegen. Es ist keine Störung da, alles lieblich in der schärfsten Nähe, in der unbestimmtesten Ferne; alle Farben dieser Welt spielen zusammen und sind eine entzückte, entzückende Morgenwelt. Ganz bescheiden ragen die hohen Appenzellerberge in der Weite, sind kein kalter Mißton, nein, scheinen nur ein hohes, fernes, verschwommenes Grün zu sein, welches zu dem Grün gehört, das in aller Umgebung so herrlich, so sanft ist. O wie sanft, wie still, wie unberührt ist diese Umgebung, wird durch sie dieser kleine, fast ungenannte See, ist selber also so still, so sanft, so unberührt. – Auf eine solche Weise spricht die Beschreibung, wahrlich: eine begeisterte, hingerissene Beschreibung. Und was soll ich noch sagen? Ich müßte sprechen wie sie, wenn ich noch einmal anfangen müßte, denn es ist ganz und gar die Beschreibung meines Herzens. Auf dem ganzen See sehe ich nur eine Ente, welche hin und her schwimmt. Schnell ziehe ich meine Kleider aus und tu wie die Ente; ich schwimme mit größter Fröhlichkeit weit hinaus, bis meine Brust arbeiten muß, die Arme müde und die Beine steif werden. Welch eine Lust ist es, sich aus lauter Fröhlichkeit abzuarbeiten! Der eben beschriebene, mit viel zu wenig Herzlichkeit beschriebene Himmel ist über mir, und unter mir ist eine süße, stille Tiefe; und ich arbeite mich mit ängstlicher, beklemmter Brust über der Tiefe wieder ans Land, wo ich zittere und lache und nicht atmen, fast nicht atmen kann. Das alte Schloß Greifensee grüßt herüber, aber es ist mir jetzt gar nicht um die historische Erinnerung zu tun; ich freue mich vielmehr auf einen Abend, auf eine Nacht, die ich hier am gleichen Ort zubringen werde, und sinne hin und her, wie es an dem kleinen See sein wird, wenn das letzte Taglicht über seiner Fläche schwebt, oder wie es sein wird hier, wenn unzählige Sterne oben schweben - und ich schwimme wieder hinaus. –
Ein Maler
Diese Blätter aus dem Notizbuch eines Malers sind mir, wie man so sagt, zufällig in die Hände geraten. Mir erscheinen sie nicht so unbedeutend, als daß ich nicht glaubte, sie veröffentlichen zu dürfen. Über die darin niedergelegten Kunstansichten kann man gewiß verschiedener Meinung sein. Das ist aber auch nicht das Wichtigste, sondern das andere, Dazwischenliegende, das rein Menschliche in den Blättern erschien mir als das Bedeutendere, wirklich Lesenswerte.
Dies soll eine Art Tages- oder Notizbuch werden. Ich werde die Blätter, wenn sie zu Ende geschrieben sind, verbrennen. Wenn sie zufällig aufbewahrt werden, so mögen sie nur einem neugierigen, schwatzhaften Schriftsteller in die Hände fallen; was kann mir daran liegen? Die Welt ist mir gleichgültig, ebenso die Menschen, ebenso diese paar Aufzeichnungen. Ich schreibe zu meinem Vergnügen, so zwischen dem Malen hindurch, wie ein Dieb, wie ein Erzschelm; ich habe immer gern kleine Streiche verübt. Und welch harmloser, unbedeutender Streich ist dieses Aufschreiben! Ich lege etwas von meiner Gesinnung, etwas von meiner Kunstanschauung, etwas von meiner Seele darin ab, wie auf einem kleinen, bescheidenen Opferaltar, könnte ich sagen! Warum auch nicht? Das Schreiben ist überdies für die Malerhand eine amüsante Abwechslung, warum sollte ich das meiner Hand nicht gönnen? Ich bin nun schon seit einigen Wochen in dieser Villa, mitten in den Bergen, unter Tannen, zwischen den lieben, einsamen Felsen. Den ganzen Tag, fast die ganze Woche haben wir Nebel. Der Nebel geht hier nie ganz weg, nur bei ganz klarstem Wetter. Ich liebe den Nebel, so wie ich alles liebe, was feucht, kalt und farblos ist. Ich habe nie Ursache gehabt, mich nach mehr Farben zu sehnen, denn ich habe immer, von frühester Jugend auf, da Farbe gesehen, wo beinahe keine war. Ich habe also des Künstlers Drang, nach südlichen, sonnigen, farbigen Ländern zu gehen, nie begriffen. Mir war grau immer eine der liebsten, vornehmsten, süßesten Farben, und in diesen Bergen herrscht sie zu meinem Entzücken überall. Selbst das Grün erscheint hier grau: die Tannen! Wie ich sie doch liebe, die heiligen Tannen, es ist nicht zu sagen. Dann der Nebel! Ich streiche oft nur umher, um mit dem Nebel in der Wette umherzustreichen. Das steigt, das fällt, das zieht sich hin, das schleicht, das schießt plötzlich seitwärts, es ist wundervoll. Wie weiße Schlangen! Aber ein Dichter kann das nie sagen, das kann nur ein Maler sagen. Ich könnte kein Dichter sein, denn ich liebe die Natur zu ungestüm, und: ich liebe nur sie. Ein Dichter aber soll vorwiegend über Welt und Menschen berichten. In der Naturschilderung wird er immer hinter dem Maler zurückbleiben, es ist nicht anders möglich. Der Pinsel wird auch die feinste Wortübung immer zuschanden machen, und es ist gut, daß es so ist. Jede Kunst soll und muß ihre Grenzen haben, damit nicht die eine die andere verschlingt. Ich werde in diesen Blättern ganz zwanglos zu mir selber reden, aber ich weiß selber nicht, so wie ich fortschreibe, überfällt mich ein gewisses, nicht zu verdrängendes Verantwortungsgefühl für das, was ich schreibe. Liegt das im Schreiben überhaupt, oder habe ich das bloß so? Gut, ich werde es zu erforschen wissen. Wie doch alles seinen besonderen Sinn, und jeder Sinn seine Bedingungen hat! Es ist in der Tat merkwürdig.
Die Villa, in der ich hier lebe, ist nicht etwa meine Villa. Nein, sie gehört einer Gräfin, einer überaus liebenswürdigen, vornehmen Frau, deren Bekanntschaft ich in der Hauptstadt gemacht habe. Auch sie liebt die Stille, die Einsamkeit verschlossener Täler, die Luft der Berge, den Geruch der Tannen und des Nebels. Sie wohnt hier, und ich fühle mich fast wie ihr Gefangener. Seltsam prickelndes, reizendes Gefühl, das! Ich war arm und elend, als ich sie, oder sie mich kennenlernte. Sie schätzte sogleich den Künstler an mir, trieb mich an, die Stadt zu verlassen, ihr in die Berge zu folgen, und ich habe es ohne Bedenken getan. Nie seither habe ich es zu bereuen gehabt. Überdies bereue ich niemals etwas, da ich weiß, daß aus allem etwas Besonderes, oft sogar Schönes entstehen kann. Ich sehne mich nicht nach der Stadt zurück, ich bin über dergleichen Anwandlungen hinaus. Wo ich bin, schaffe ich, und wo ich schaffe, nur da bin ich. Wo ich am ungestörtesten malen darf, muß es mir also am besten behagen. Die Bilder, die ich male, gehören alle, ohne Ausnahme, der Gräfin. Dafür gibt sie mir zu leben, und wie zu leben! Ihre Erziehung, ihr Geschmack, ihr Herz bürgen mir dafür, daß mir das Leben in ihrer Nähe immer etwas Angenehmes sein wird. Könnte man einen bessern Kontrakt eingehen? Überdies darf ich gehen, wenn ich gehen will. Es bindet mich nichts. Aber hier bindet mich alles: die Natur, die Sorglosigkeit, die Kunst, das Gefühl, zu Hause zu sein. Habe ich also nicht recht, wenn ich sage, daß ich wie ein Gefangener der Gräfin lebe? Der Gräfin? Es ist so seltsam! Ich beziehe alles auf sie: die Gegend, die Berggipfel, das schäumende Tal, die Tannen, alles, alles lebt wie in Beziehung zu ihr, der Herrschenden. Es gehört ihr alles. So wenigstens bildet es sich mein Gehirn gern ein. Vielleicht empfinde ich so infolge der Güte und der Achtung und der Zartheit, mit der sie mich und meine Kunstfertigkeit zu behandeln gewohnt ist. Ich betrachte sie leicht und fast selbstverständlich als Herrin über mein Leben, da es angenehm für mich ist, mich geschützt und geschätzt zu wissen. Mit welcher Freundlichkeit nahm sie sich meiner an, als ich im tiefsten Elend und Schmutz lebte, in jener Großstadt, wo Freiheit und Vogelfreiheit oft dasselbe sind, wo der Kummer der Vielen das glänzende Glück der Wenigen ausmacht, wo der Künstler entweder stirbt oder seine Kunst preisgibt, und wo Adel und vornehmes Fühlen in Lumpen einhergehen, während das freche plumpe Laster Paläste bewohnt. Nein, der Gräfin bin ich ganz zu eigen. Ich wäre es sogar noch, wenn sie von meiner Bereitwilligkeit einen schonungsloseren Gebrauch machte, und gern! Aber wie wenig verlangt sie! Sie schätzt die Kunst so hoch, daß sie nicht anders kann, als dem Künstler achtungsvoll zu begegnen. Nie ist die kleinste, geringste, unbewachteste Bewegung an ihr mir gegenüber anders als edel und schön. So kann aber auch nur eine Frau sein. Wirklich, ich habe die Überzeugung, so kann nur eine Frau sein.
Der Ruhm ist mir gleichgültig, da ich die Menschen kenne, wie ihre Sucht, Schönes und Schlimmes dicht hintereinander zu sagen. Die Urteilslosigkeit der Menge ist nur ein breiteres Abbild von der Urteilslosigkeit der Gebildeten. In Kunstsachen namentlich herrscht hüben und drüben ein recht bitterer Mangel an sicherem Urteil, und das ist auch nicht zum Verwundern bei der Ungeschultheit unserer Künstler. So zerfahren das Kunstpublikum ist, der Künstler ist meist noch zerfahrener. Was geht es mich an! Meine Aufgabe ist es nicht, hier Ordnung zu schaffen, wo wahrscheinlich nie Ordnung sein wird. Es gibt unter Kunstkennern und Künstlern herrliche Ausnahmen, die aber meist still und ruhig sind, wenig von sich reden machen, also zu erkennen geben, daß es nicht ihr Plan ist, Einfluß auszuüben. Diese wissen genau, wie viel neuer Irrtum und wie wenig Fortschreitendes aus Einfluß entsprießt. Ruhm ist mir also vollständig Nebensache. Ich möchte gerne berühmt sein, aber unter kraftvolleren, edleren Menschen! Ruhm ist eine wundervolle, göttliche Sache, aber ihr Wert verschwindet, wird sie nur ausgeschrieen, nicht ausgehändigt. Also fort damit. – Mein Malen hat mit der Sucht und Sehnsucht nach Ruhm und Anerkennung nichts mehr zu schaffen. Ich lebe sorgenlos, ich brauche vor dem Morgen keine Angst zu haben; was sollte mir da wohl Anerkennung nützen? Ob ich für tausende, oder nur für eine male, tut der Sache selbst keinen Abbruch. Malen bleibt Malen, ob für viele Augen oder nur ein einziges Auge, ist wirklich gleichgültig. Ich male, vor allem für meine Augen. Ich hätte schon lange keine Augen mehr, wenn ich nicht malen dürfte. Das ist stark gesprochen, aber ich will auch, daß ich mich stark ausdrücke. Die Gräfin hat eine immer wachsende Freude an meinen Bildern. Für eine einzige große, starke Freude malen dürfen, ist viel schöner als für die gesprenkelte, abweichende, haltlose Freude einer Masse. Dazu kommt, daß die Frau Gräfin wirklich allerfeinste Kunstkennerin ist. Sie versteht und fühlt die ganze Aufgabe des Malens. Sie folgt oft den Ausführungen meines Pinsels mit einem Mitleiden, wie wenn ein Menschenleben daran hinge. Die Vollendung eines neuen Bildes erfüllt ihre Seele mit dem kindlichsten Glück. Sie weiß, nur Bilder erringen bei mir die Vollendung, die ich unbedingt für geglückt und gelungen halte. Deshalb darf sie sich auch ruhig der Freude überlassen. Wie liebe ich sie, um dieser feinen Empfindungen willen. Nur schöne Menschen haben ungeheuchelte Freude am Schönen. Sind meine Bilder denn schön? Ja, sie sind es! Ich kann und muß mir das sagen. Ohne diese Überzeugung im Herzen würde ich keinen Augenblick länger fortmalen wollen. Übrigens weiß ich, daß ich von einer geradezu krankhaft verletzbaren Bescheidenheit bin. Dies beruhigt mich. Und dann, der Gräfin edler Kunstsinn würde sich niemals einer feigen und plumpen Täuschung hingeben. Man sieht, wohin meine Ruhmsucht strebt.
Was ich male? Nichts als Porträte, Bildnisse der Natur und von Menschen, peinlich genaue Bildnisse. Ich liebe es nicht, mit dem Pinsel zu dichten, zu fabulieren, zu phantasieren, zu erzählen. Dies ist gegen meine Art, gegen meinen Geschmack. Wofür haben wir Dichter? Nein, es kommt mir darauf an, treueste Natur zu geben, sie zu geben, wie meine Seele (und die sitzt vorn in meinem Auge) sie sieht, sie zu sehen, wie sie ist. Nichts anderes. Und das ist so viel. Man kann es auch Phantasieren nennen. Ich phantasiere ja auch, indem ich zu sehen bemüht bin: meine Augen sind es alsdann, die phantasieren. Vor allem eins: mein Verstand hat nichts, oder nur äußerst wenig mit meinem Malen zu tun. Ich lasse meine Empfindung, meinen Instinkt, meinen Geschmack, meine Sinne malen. Der Kunstverstand ist zum Studieren gut, zum Erlernen der Kunstgesetze: mit ihm arbeitet der Schüler. Aber das wissen andere ebensogut wie ich. Man sollte meinen, ich sei viel draußen in der Natur, vielleicht sogar mit dem Skizzenbuch in der Hand! Da würde man irren! Ich sehe die Natur selten mehr an, wenigstens fast nie mit Maleraugen. Ich habe mich satt, fast krank daran gesehen. Weil ich sie liebe, meide ich womöglich ihren gefährlichen Anblick. Er würde direkt lähmend auf meine Produktionslust wirken. Was ich tun kann, und tun muß, ist, in meinem Gedächtnis eine zweite Natur, womöglich ähnlich der ersten, einzigen, auferstehen zu lassen: eine Natur für meine Bilder. Darin also besteht mein Phantasieren. Mein Phantasieren ist selbstverständlicher Sklave der Natur, wenn es nicht selbst die Natur ist. In meinem Gehirn steckt meine ganze jetzige und zukünftige Gemäldesammlung. Bergwände, Schluchten, Täler, Aussichten in Täler, glitzernde Seen, Flüsse, die Windungen des Nebels, die Haltung der Tannen, alles was ich je in der Natur zu Gesicht bekommen habe, was ich so unaussprechlich, so gedankenvoll liebe, das glitzert, schäumt, lagert und erstreckt sich wieder in meiner Phantasie. Man sage also nur nicht, daß Porträtisten nicht phantasieren. Sie tun es vielleicht lebhafter, kräftiger, inniger als alle Historien- und Szenen- und Geschichtenmaler zusammen. Ich würde es verschmähen, meine Phantasie andere Dienste tun zu lassen, als solche, die allein der Übung des Pinsels zugute kommen. Ein Maler kann sein Malen nicht hoch genug achten. Meiner Ansicht nach kommt es doch darauf an, wie viel feine Wiedergabe der Natur, also: wie viel konzentrierte Natur ein Bild enthält. Maler, die brutal mit dem Pinsel dichten (was sie geläufig phantasieren nennen), kann ich zwar lächelnd neben mir dulden, aber ich schätze sie nicht, weil sie ihre Kunst nicht kennen. Es kommt nicht auf ein äußeres, es kommt auf ein inneres Phantasieren an. Dort das flüchtige, dilettantische Phantasieren mit Gestalten, hier das tiefe, fühlende mit der Farbe.
Ein Maler ist ein Mensch, der einen Pinsel in der Hand hält. Am Pinsel ist Farbe. Die Farbe ist nach seinem Geschmack gewählt. Die Hand hat er, um den Pinsel geschickt nach den Befehlen des sehenden und fühlenden Auges zu führen. Er zeichnet und malt zugleich mit dem Pinsel. Eines Pinsels Härchen sind gewöhnlich wunderbar scharf und fein, aber schärfer und feiner ist die Gewissenhaftigkeit, mit der die Sinne, die gesamten, vorgeneigten, gespannten Sinne mitarbeiten. Ein zuverlässiger, exakter Mensch ist ein um so besserer Maler. Edle und vornehme Gesinnung drückt sich in der Pinselführung wunderbar aus. Liederliche Menschen malen auch liederlich. Sie können genial, aber niemals groß malen. Bescheidenes, artiges Wesen wählt seine Farben gewöhnlich mit feiner Vorsicht, nach einem gedankenvolleren Geschmack. Kein Wunder, daß die höflichsten und zuvorkommendsten Menschen, die Franzosen, die bedeutendsten Maler liefern, oder geliefert haben. Impertinenz und Anmaßung bringen nie ein Gemälde zustande. Leicht, still, besonnen, klug und aufs feinste gebildet hat man noch jeden großen Maler angetroffen. Sich weder lange besinnen, noch auch unbesonnen sein, das schafft gute Bilder. Treue der Natur, Treue sogar einem gewissen lächelnden Trotz gegenüber, dagegen Kälte und Verwunderung vor allem sich begierig Aufdrängenden: das ist der Topf, die Palette, wo die süßen, ewigen Farben liegen. Welche Ruhe, welche Stille, welche Zurückhaltung und deshalb: welche Natur in den Gemälden der meisten alten Meister. Die Natur ist nie erregt, obgleich sie voll Leben. Wie kalt scheint die Sonne, wiegen sich die Blätter und Blumen, liegen die Kronen der Bäume, starren die Felsen, klingt der Gesang der Vögel. In der Natur ist keine Wärme, nur der Mensch, der ängstliche, stets eifrige Mensch glaubt sie spüren zu sollen. Wie viel Liebenswürdiges lügen uns nicht die Dichter vor! Dichter kennen die Natur überhaupt selten, lernen sie selten kennen, wollen sie nicht kennen lernen. Sie sind gemeiniglich Starrköpfe. Das Geschäft des Malers bringt es mit sich, hier viel zartere Beobachtungen zu machen. Das Gleichgültige, Starre an der Natur ist es, das den Maler oft die heißesten, glühendsten Farben aufsetzen läßt. Hier heißt es, sich zusammennehmen, hier gilt es, kalt der Kalten gegenüber zu sein. Man kann auch mit großer Herzlichkeit, Innigkeit und Wärme kalt sein, sobald es die Kunst gebietet. Die großen Maler haben das alle gekonnt, haben es alle lernen müssen. Ihre Kunstwerke lassen es deutlich spüren. Malen ist die kälteste Kunst, ist eine Kunst des Geistes, der Beobachtung, des Nachdenkens, der höchst scharf zersetzten Gefühle. Was ist Geschmack anderes als zersetzte Empfindung, zergliedertes Sinnen? Und mit was malt man, als mit dem Geschmack? Sollten nicht Farbensinn und Geruchsinn in engster Berührung zueinander stehen? Sollte nicht ein bestimmter Duft den Eindruck einer bestimmten Farbe hervorrufen können?
Die Vorstellung von einer besonders schönen Farbe kann ich wie eine köstlich zubereitete Speise oder wie eine zauberisch duftende Blume kosten. Süßes eigentümliches Genießen! Ich unterlasse es, so viel ich kann, es würde mich ruinieren. Sind denn nicht alle Sinne durch wunderbare Kanäle untereinander verbunden? Beim Malen selbst habe ich einzig und allein die Fertigstellung des Bildes im Auge und Sinn. Namentlich auch die Überwachung des Handgelenkes, das oft schlafen möchte. Eine Hand ist nicht leicht zu meistern. In einer Hand steckt oft viel störrischer Eigenwille, der gebrochen werden muß. Mit Einsatz eines energischen und sanften Wollens kann man sie wunderbar gefügig, geschmeidig und gehorsam machen. Der Trotz in ihr ist dann wie ein Glied gebrochen, sie arbeitet wie ein seltsamer, talentvoller Diener, kräftigt und verfeinert sich von Tag zu Tag. Das Auge ist wie ein Raubvogel, es sieht die geringfügigste abweichende Bewegung. Die Hand fürchtet aber auch das Auge als ihren ewigen Quäler. Ich weiß selber nicht, wie es mir beim Malen eines Bildes zumute ist. Ein Schaffender ist ein völlig Abwesender, Gefühlloser. Nur wenn ich eine Pause mache, um das Getane zu überschauen, fällt mir oft ein, daß ich zittere vor innerem Glück. Eine Genugtuung, wie ich sie sonst nie kenne, gibt mir eine Sicherheit im Fortfahren, die mich fast von Sinnen bringt. Drum ruhe ich so wenig wie nur möglich aus. Es ist gefährlich, ja tötend! Während des Schaffens habe ich nicht das ausdrückliche, wirkliche Bewußtsein dessen, was ich vollbringe. Alles geschieht unter der Herrschaft eines fremden, mir zugeflogenen, mir übergeworfenen Bewußtseins. Deshalb kann ein Schaffender nicht von Glück während des Schaffens reden. Er empfindet nur nachher noch den weichen, süßen Nachdruck des seligen, kummerlosen Zustandes. Selig ist anders als glücklich. Der Gefühllose einzig ist selig, so wie die Natur. Auch Gefühlüberströmte sind wie Gefühllose! – Wie ich male, kann ich nicht sagen, da ich es in dem mir fremden Zustand mache. Wie man malen muß, das kann man nur malen, nicht sagen. Wie ich male, zeige ich aus fertigen Gemälden, unfertige kommen nie aus meinen Händen. Ich spüre oft in der undeutlichen Erinnerung, welche Freude mir das Aufsetzen einer mir besonders lieben Farbe gemacht haben muß. Ich suche mir dann die betreffende Haltung, den fraglichen Strich und Kniff wieder vorzugaukeln, aber es gelingt selten. Wie ich etwas sehr Liebes und Wirkungsvolles gemacht habe, kann ich mir nachher kaum noch vorstellen. Namentlich an Tannen gelingt mir oft Überraschendes, süß in die Augen Springendes. Ich habe Tannen so fest im Gedächtnis, so fest in der Seele. Ich wünsche oft (und dieser Wunsch ist krankhaft genug) ihren Geruch malen zu können. Obgleich ich Maler bin, wirkt Malen oft, sogar sehr oft, wie etwas Wunderbares, Geisterhaftes, Unbegreifliches auf mich. Das ist vielleicht nur, weil ich keine andere Leidenschaft kenne.
Sehr oft ist die Gräfin zugegen, wenn ich male. Ich nehme nicht die mindeste Rücksicht auf ihre Gegenwart, und sie verlangt es auch keineswegs. Wie kommt es, daß diese Dame sich fester und korrekter zu benehmen versteht als selbst ausgezeichnete Männer? Sie sitzt, den schönen, geistvollen Kopf stützend, wortlos im Sessel, mich und meine Arbeit innig betrachtend. Auch während der Pausen, die ich mache, wagt sie kein Wort zu reden, so zart denkt sie, so rücksichtsvoll behandelt sie einen schaffenden Künstler. Ich habe, so scheint es, die Gewohnheit, während des Malens hin und wieder zu lachen, spöttisch, wenn ich zornig auf meine Leistung bin, froh, wenn ich dazu Ursache habe. Nie, nur später einmal ganz kurz, hat sie deswegen eine Bemerkung gemacht. Sie fühlt mit, das ist klar, und sie ist mit ihrem Mitfühlen beständig auf dem Laufenden, das ist noch klarer. Ihre Gegenwart muß mir demnach wie ein halb fühlbarer, halb ungeahnter verschleierter Hintergrund wirken. Das ist angenehm, weil es nicht störend ist. Es ist da wie etwas, das nur halb da ist, so wie weiche Sonne, oder wie ein Strauß duftender Blumen. Bin ich fertig, so wird unbefangen gesprochen. Man fühlt sich von viel Schwerem befreit, man ist froh, sich wieder leicht zu fühlen. Sie nimmt die Kunst ebenso ernst wie ich, der ausübende Künstler. Es ist meine, meine Kunst, die sie so höflich und liebenswürdig ernst nimmt! Wie dieser Gedanke wohltuend durch die Adern rieselt! Wenn ich fertig bin, ist sie es, die fast froher aufatmet als selbst ich. Wie köstlich muß so etwas anmuten! Wir zeigen uns gegenseitig das Vortreffliche und Lückenhafte in meinem Bilde. Sie sieht fast immer nur Lobenswertes, Schönes, Entzückendes. Mit Tadel ist sie vorsichtiger als mit Lob: eine ihr geziemende, herrliche Eigenschaft. Sie weiß, daß ich mich schonungslos kritisiere. Sie findet es für schöner und passender, mich mit Lob zu erquicken, als mit Tadel unlustig zu machen. O! sie versteht ehrlich Schaffende. Dabei geht sie mit allem so ungezwungen um, so leicht, so klug, so gemessen. Ihr ist jene Überschwenglichkeit fremd, die in Kunstsachen als so eitel und unreif erscheint, die den Inhaber immer unklug und nie angenehm macht. Nachher gehen wir spazieren, im Garten oder in der schönen Umgebung. Sie liebt alles, was ich liebe, ich liebe das doppelt, das sie so liebt. Wir streiten uns nie, obgleich wir oft verschiedene Meinungen haben. Ich bin so glücklich, nicht allzuviel reden zu müssen, da ich beständig von Eindrücken bestürmt werde. Sie ahnt das nicht nur, sie weiß es. Sie läßt lieber eine feine Gesprächswendung mutig und großherzig fallen, um mich nicht zu ermüden; ja, sie hat schon manchmal einen angefangenen Satz einfach hinuntergeschluckt, wenn sie mich gereizt und nachdenklich gesehen hat. Ein herrliches, tapferes Weib! Zwischen uns ist ein Verständnis, eine Einigkeit, die ich viel mehr ihr, der immer Wachsamen und Aufhorchenden, als mir, dem oft Heftigen, zu verdanken habe.
So sehr ich auch das Grau liebe, entzücken mich wiederum sonnige Landschaften. Die Sonne bemühe ich mich so kalt als möglich zu malen: weich, träg, aber kalt. Das gibt etwas Zauberisches, wirklich Sonniges. Nichts ist süßer als von der Sonne durchbebte, durchzitterte, durchstochene Bäume, besonders Kastanien. O wie ich solche Bäume liebe! Wie ich die Sonne liebe, weil sie so weich, so träg, so süß ist! Ich habe eine Mühle am Fluß gemalt, mit vieler Mühe, sie ist eines meiner gelungensten Werke. Eine Ruine, ein herrlicher Stoff, ist in Arbeit. Stoffe drängen andere Stoffe, und dabei male ich so langsam, es ist oft entsetzlich. Warum arbeitet sich ein Künstler so ab? Ist es eine fixe Idee, ist es Wahnsinn? Ich weiß es wahrhaftig nicht. Aber ich soll jetzt vor allen Dingen die Gräfin malen, das beunruhigt mich in der Tat sehr. Bin ich meines Könnens nicht sicher? Doch, sehr! Aber ihr Porträt, das Porträt einer Frau, die – – nun – die man halb liebt! – Es ist überdies eines meiner ersten Menschenbilder. Zu Bildern der Natur habe ich bis dahin mehr Zutrauen gehabt, vielleicht, weil ich fühlte, daß sie mir besser gelingen. Nun, versucht muß es jetzt einmal werden, ich ertrage diese scheußliche Ungewißheit nicht mehr länger. Nur kein Bangen. Was ist denn dabei? Die Gräfin wird stillsitzen wie ein Kind, dem man ein Bilderbuch auf den Schoß gegeben hat, und ich, ich werde malen. Und es wird gelingen! Warum kann mir nur bange sein! – Ich werde sie schön malen, schöner und peinlicher als alle Landschaften. Wie ich mich darauf freue, zum Beispiel ihre Hände zu malen! Ihre Hände! Eine ganz zitternde, furchtsame Freude ergreift mich bei diesem Gedanken. Ihre Hände, die so der Ausdruck ihrer vornehmen Güte sind, die so lang sind, deren Finger so kindlich einfach auseinanderlaufen, so ganz anders, wie an andern Frauen! Gut, ich werde sie zu malen wissen. Ich hasse alles Vorbedeuteln, Vorempfindeln! Laß doch die Sache an dich herankommen, Bursche, wenn du ein beherzter Bursche bist. Das hilft mir. Ich muß zuweilen recht saftig in mich hineinspotten, um mich aufzurütteln. – Ich mache noch schnell vor dem Abendessen einen Rundgang um die Felsen. Das tut wohl. Aber im Gehen habe ich die Empfindung, ich sei nicht mehr der alte, sei ein ganz anderer, was ist das? Das ist wohl recht dummes, stupides Zeug! – Wie die Tannen zu mir sprechen, o, die süßen Tannen! Wie oft kommen sie nicht auf meinen Bildern vor: immer wieder Tannen! Bald im hellen, etwas verwischten Sonnenschein, bald im Nebel, bald so, wie sie am tiefsten und ergreifendsten sind: weder sonnig, noch düster umflort, sondern bloß Tannen, keine Schatten werfend. – Ich pflücke einige schöne Blumen, binde sie zu einem Strauß zusammen, eile wieder abwärts, dem Hause zu. Sie liebt Blumen, sie liebt sie aus meiner Hand, warum sollte ich ihr die Höflichkeit nicht erweisen? Es ist mir lieb, Gelegenheit zu nehmen, mich ihr lieb zu erweisen. Bin ich ihr etwa nicht Dank schuldig? Ich muß lachen.
Dort der gleichgültige, unbewegliche Gegenstand, sei es Natur oder Mensch oder Phantasie, hier die durcheinanderliegenden Farben, zwischen beiden die zitternde, fassende, unfaßliche Hand, das begehrende, sich bezwingende, mühsam sich haltende Auge: das ist das immer wiederkehrende Schicksal des Malers. Ein immer sich erneuernder Kampf. – Ich habe das Bildnis der Gräfin gemalt, und es ist, so scheint es, gelungen. Ich bin müde wie ein geschlagener Hund, und es wundert mich nicht. Das Bild ist in unbegreiflich kurzer Zeit zustande gekommen. Ich habe es mehr hinuntergerissen als gemalt. Welcher satanische Geist ist über mich gekommen! Aber jetzt bin ich furchtbar müde. Ich male fortwährend im Gehirn weiter, furchtbarer Zustand! Die ganze Nacht, in Träumen, entsetzlich wilden, wird fortgemalt. Ich werde heute nacht gar nicht zu Bett gehen. Ich werde trinken! Basta! Die Gräfin, welch eine wundervolle Frau ist sie! Sie hat unermüdlich gesessen. Von morgens bis abends. Ich habe sie in halb sitzender, halb liegender Stellung gemalt, in den Kleidern, in denen ich sie am liebsten sehe. Sie hatte mich wählen lassen. Ich habe natürlich die Wahl ihrem Geschmack überlassen, und sie hat den guten gehabt, zugleich den meinigen unbewußt zu berücksichtigen. Grau, das am Frauenleib so großartig steht, und ein gelbliches Braun, das ich von ganzer Seele liebe. Sie hat kalt und unbeweglich vor sich geschaut. Ich habe deutlich gefühlt, daß sie schon in Ateliers gesessen hat. Ich habe gemalt wie ein armer Schuft vor dem Wunder. Dann bin auch ich, zu meinem Glück, kalt geworden, und es ist, wie man so sagt, »gegangen«. Dann an ihren verzweifelt kalten Augen habe ich wieder gemalt wie ein Verzweifelter. Sie hat Augen, o! Die Hände sind leicht gegangen, und sie sind das Beste am Bilde. Hände gehen mir deshalb leicht, weil ich schon die meinigen in- und auswendig kennengelernt habe. Eine Hand gleicht doch im rohen Äußern der andern, so scharf auch das Besondere, Bezeichnende hervorsticht. Unter ihren reizenden kleinen Füßen hat ein graublauer Teppich gelegen. Ein dicker, weicher, einfarbiger Teppich. Er liegt sehr gut im Bild. Die Augen im Bild sind noch nicht vollendet, und sie sollen auch nicht vollendet werden. Ich würde sie nicht besser machen können. Sie hat lange vor dem beendigten Ding gestanden, nichts gesagt, mir nur nachher stumm und voll Bewegung die Hand dargeboten. Das sei sie wirklich, hat sie mir viel später gesagt. Sie steht jetzt oft lange Zeit davor und betrachtet es wie etwas Fremdes, sie gar nicht Berührendes. Ich weiß, sie betrachtet es nur noch als Kunstwerk. Wenn die Frau so groß ist, bin ich bezahlt für meine Mühe. Der Strauß Blumen im Bilde hat ihr Tränen entlockt. Es ist ein ganz gewöhnlicher Strauß, so gewöhnlich als möglich auch im Bilde gemalt. Aber vielleicht ist es gerade dieser Umstand, der sie so hat erregen können. Dem Bilde fehlt weiter nichts, als daß es kein Besserer, als ich bin, gemalt hat.
Gestern ist ein kranker Dichter hier angekommen. Der scheint alle Laster durchgemacht zu haben, daneben ist er unschuldig wie ein Kind. Seine Gedichte sind weltberühmt, er selber ist ein verstoßner Mensch. Sonderbares, grauenhaftes Schicksal! Die Gräfin, die eine innige Verehrerin und Liebhaberin seiner Verse ist, hat ihn zu sich kommen lassen, um ihn wenigstens anständig und ruhig sterben zu lassen. Er hat in seinen Gedichten, die wirklich herrlich sind, feinste und genaueste Wiederholung des Lebens gegeben. Des tönenden Lebens da draußen und des stillen, seufzenden Lebens der Seele! Kann ein Dichter Besseres geben? Er ist noch so jung, der arme, verkommene Kerl! Wie ich ihn liebe, den blonden, arglosen, träumerischen Menschen! Welche wundersam glänzenden Augen er hat! Wie es schimmert und wehklagt in ihnen! Ein ganz, ganz wahrhafter Dichter: schön und abstoßend zugleich. Armer Bursche! Er hat vollständige Handlungsfreiheit hier. Kein Getränk wird ihm entzogen. Warum sollte man ihm das Sterben, das sicher bevorsteht, beschwerlich machen, ihm die letzten unschuldigen Genüsse verbittern? In dieser Beziehung ist die Gräfin die edelste, uneingeschränkteste Menschenfreundin. Wenn er berauscht ist, so tanzt er. Dann bewegt er seinen verkrüppelten Körper mit entzückender Lebhaftigkeit. Es ist eine seltsame, durchdachte Grazie in seinen Bewegungen. Wie wohllautende Verse muten seine Neigungen und Beugungen an. So tanzt nur ein Dichter! Arme, Hände und Füße bringen eine Musik hervor, die man nirgends mit Ohren hört, die man eher mit Augen sieht. Das Abbrechen seines Tanzes ist schmerzlich, denn nun hat man wieder den entstellten Kranken vor sich. Sein Tanz ließ das völlig vergessen. Wie doch Schönheit die Bewegung und Bewegung den Menschen adelt! Auch die Gräfin hat dem merkwürdigen Schauspiel zugeschaut, und ist tief gerührt darüber gewesen. Dies ist gestern gegen Mitternacht geschehen. Am Morgen ist der Dichter angekommen, und am selben Abend hat er uns schon in seine tiefste Seele blicken lassen: so arglos und schön sind Dichter! Jetzt, während ich dies schreibe, schaut er neben mir zum Fenster hinaus: in den Regen, in die weite, abwärtssinkende Landschaft, in die Tannen und in den feinen, streichenden, fauchenden Nebel. So blickt und blickt er. Es muß ihm gefallen, das stumme, schwermütige Schauspiel da draußen. Vielleicht wirkt es sogar tröstend auf ihn, den Absterbenden. Sonne und Farbengeflimmer würde ihn vielleicht nur traurig stimmen. Vielleicht dichtet er noch etwas hier! Ich werde ihn malen. Ich werde ihn malen, wie er jetzt ist, in derselben zufälligen Haltung, wie er hinausblickt. Ich werde Gelegenheit haben, Tannen zum Fenster hineinblicken zu lassen. Er, wie er hinausblickt, sie, wie sie hineinblicken. Ich will es sogleich anfangen, damit kein neuer Eindruck es mir stehlen kann.
Das Bildnis des Dichters ist fertig, und ich bin fest überzeugt, daß es mein bestes Werk ist. So selbstverständlich tritt die Natur aus keinem meiner bisherigen Bilder. Und doch habe ich das Ganze aus dem Kopf gemalt, nur zu des Dichters Gesichtszügen hat er mir für einige Studien sitzen müssen. Hier habe ich es also deutlich: meine Phantasie ist ganz nur noch ergebene Untertanin und Wiedergeberin der Natur, ist Natur selber! Mein Farbensinn wählt so unbedenklich wie die Natur selber. Es wundert mich nicht; denn wer so, wie ich, stets nur sie im Auge hatte – nun, das mußte so kommen, hat nicht anders kommen können. Ich bin jetzt meiner, meines Geschmacks und Talents überhaupt, vollständig sicher. – Die krankhafte Blässe im Gesicht des Dichters hat mir Anlaß gegeben, meine liebsten und mir treuesten Farben zu gebrauchen. Verwendet habe ich sie sehr einfach; ich bin stolz und kalt mit ihnen umgegangen. Welch ein Widerspruch: verliebt, vergafft in etwas sein, und sich doch kalt ablehnend verhalten müssen! Diese Kunst gelernt zu haben: darin besteht die ganze Hexerei des Malens. Hohes Talent, unbedingte Begabung und gebildeter Geschmack natürlich vorausgesetzt. Diese Farbe von ganzer, heißer Seele lieben, und doch den Wunsch haben, ihr möglichst wenig freundlich und vertraulich zu begegnen. Farben bestürmen einen nämlich! Und diesen Ansturm des Süßen, der verderblich für das Bild werden kann, muß man gelernt haben, kalt und ohne Gnade abzulehnen. Und doch wiederum, im selben Moment, vor der Süße des Süßen beben, sich unendlich freuen, es gebrauchen zu dürfen, es in Anwendung zu bringen: – dies ist Seiltänzerei der Empfindungen, aber vor großer Kunst unentbehrlich. Große Kunst steckt in großen Irrgängen, so wie rührendste Anmut am liebsten in Verrenkungen wohnt. – Wie sehr sticht der Kopf des Dichters von dem der Gräfin ab! Die Bilder hängen dicht nebeneinander. Dort traurigstes Verwelken, hier anmutigste, grundfesteste Gesundheit. Welch ein Unterschied der Lippen, der Wangen, der Augen! Die Gräfin hat Augen, wie sie sehr gute, feste und noble Menschen haben. Dagegen des Dichters Augen, o! Frauen haben in der Regel die kälteren, festeren Augen als Männer. Frauen sind in der Regel gesünder und klüger als Männer. Frauen leben aber auch natürlicher und schicklicher und besser als Männer. Ich spreche natürlich von den Gebildeten! Der Frauen Klugheit paßt sich viel geschmeidiger ihren Empfindungen an; deshalb ist ihre Klugheit meist gut, wirkt als Güte, verdirbt keiner Sache ruhigen Lauf, ist in Ratschlägen viel zutreffender, nützlicher. Ich habe gern mit Frauen zu tun, namentlich gern Geschäfte abzuwickeln, um jener freundlicheren Klugheit willen. Um Gotteswillen: was schadet es, wenn ich die Frauen lobe? Wenn ich eine Frau wäre, würde ich eben die Männer loben.