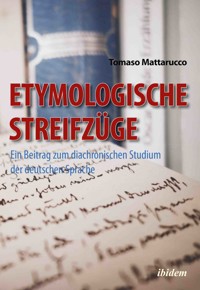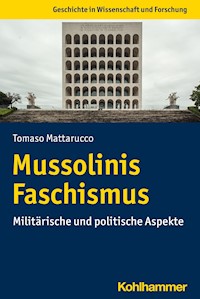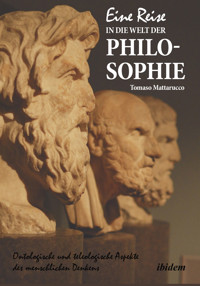
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist der Mensch, wohin steuert er, und warum lebt er? Diese scheinbar einfachen Fragen sind in Wahrheit so essenziell, dass sie zur Definition unserer Spezies dienen könnten, und sie haben seit jeher die Welt der Philosophie beschäftigt, ohne dass jedoch eine endgültige oder auch nur zufriedenstellende Antwort gegeben werden konnte. Mit seiner Reise in die Welt der Philosophie wendet sich Tomaso Mattarucco an philosophisch interessierte Leser. Er rekapituliert in klarer und prägnanter Weise den Stand der philosophischen Forschung – auch mit Blick auf Dogmen, die frei von religiösen Vorurteilen betrachtet werden – und arbeitet anhand moderner Erkenntnisse der Wissenschaft neue Ansätze und interdisziplinäre Zusammenhänge heraus und wie sie in den philosophischen Diskurs eingefügt werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Kapitel 1: Am Anfang war das Nichts: Warum gibt es etwas und nicht nichts?
Kapitel 2: Ontologische und existenzialistische Aspekte: Das moderne Philosophieren im Lichte des Säkularisierungsdramas
2.1 Aristoteles und die primäre Ursache
2.2 Spinoza und das Ende der teleologischen Utopie
2.3 Eine Zwischenbilanz
2.4 Giambattista Vico oder das verum et factum convertuntur.
2.5 Eine Zwischenbilanz
2.6 Nietzsche und Heidegger und die ontologische und teleologische Umorientierung
Kapitel 3: Anthropologische Betrachtungen: Was ist der Mensch?
3.1 Evolution und Aggressivität
3.2 Der Mensch und der Kosmos
3.3. Schlussbemerkung
Bibliografie
Impressum
ibidem-Verlag
Für Julius, Paul und Anne
Vorwort
Die Philosophie hat bekanntlich die Aufgabe, Fragen zu stellen und den Zweifel zu erwecken. Sie will keine Antworten liefern, weil diese sehr schnell dogmatisch werden – das kann man der Religion überlassen - und der Komplexität der Realität nicht gerecht werden können. Die Philosophie versucht, das Phänomen Mensch zu verstehen. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Auch sehr bekannt sind die sogenannten vier Kantischen Fragen, die die Welt der Philosophie abdecken: Was ist der Mensch? Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen?
In diesem philosophischen Sachbuch wird versucht, vor allem auf allgemeine ontologische und teleologische Fragen einzugehen, jedoch - das sei ausdrücklich gesagt - ohne den Anspruch, einen kompletten Überblick zu bieten oder eine klare bzw. endgültige Antwort zu finden. Dies würde unserer bereits erwähnten Auffassung des philosophischen Argumentierens widersprechen.
Im Laufe der menschlichen Geschichte haben sich Milliarden von Menschen gefragt, warum oder wozu sie leben, lieben und leiden, und wohin die Menschheit steuert. Es sind viele Szenarien durchdacht worden und alle haben eine gewisse Legitimierung, vor allem wenn man auch den jeweiligen historischen Kontext und den philosophischen Rahmen berücksichtigt. Gott stand lange im Mittelpunkt dieser Fragestellung und das religiöse Denken hat immer getröstet und den vermeintlich richtigen Weg gezeigt. Irgendwann setzte jedoch das Säkularisierungsdrama ein. Eine neue Epoche des menschlichen Denkens, aber es waren immer noch die alten Fragen, auf die immer noch keine Antwort möglich ist. Welchen Sinn ergibt die menschliche Existenz? Irgendwann, das behaupten Astronomen immer wieder, wird diese Welt untergehen. Was haben Freuden und Schmerzen für einen Sinn? Verfolgt die Natur ein Ziel? Oder hat die Menschheit vielleicht eins?
Man beachte, dass wir bei der Behandlung der philosophischen Modelle der Denker eine bewusste und teilweise schmerzhafte Auswahl treffen mussten. Zum Beispiel wäre es möglich gewesen, sowohl auf Plato als auch auf Aristoteles als Vertreter der Antike einzugehen, aber wir haben uns aus pragmatischen Gründen für den letzteren entschieden. Auch wäre es empfehlenswert gewesen, sich intensiver mit Leibniz oder Hegel auseinanderzusetzen, aber auch in diesem Fall hielten wir es für besser, zu Gunsten unserer Argumentation andere Aspekte der Philosophie der Moderne zu thematisieren. Wir haben auch versucht, die philosophischen Fragen zu stellen (wohlgemerkt: nicht zu lösen!), welche die neusten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder aufwerfen. Nur so kann man eine philosophisch fundierte Analyse durchführen, die den Herausforderungen der säkularisierten Moderne gewachsen ist.
Das vorliegende Buch ist folglich keine Enzyklopädie oder keine Geschichte der Philosophie, sondern es will lediglich einige bestimmte Aspekte des Menschseins unterstreichen. Es ist unser Anliegen, vor allem auf bestimmte Zusammenhänge hinzuweisen, die im Allgemeinen vernachlässigt oder, zum Beispiel in der Schule und im Studium, nicht genug besprochen werden.
Angesprochen werden diejenigen, die sich generell für philosophische Fragen interessieren bzw. einen Einstieg in diese Disziplin benötigen oder eben bestimmte Implikationen des menschlichen Denkens vertiefen wollen.
T.M., Offenburg, im Juli 2018
Kapitel 1Am Anfang war das Nichts: Warum gibt es etwas und nicht nichts?
„Trotz solcher Erfolge hatte diese mathematisierte Naturbetrachtung innerhalb des Ordens heftige Konkurrenz. Vor allem bei den jesuitischen Naturphilosophen regte sich Widerstand. Sie wollten Naturphänomene nicht quantitativ, sondern qualitativ und philosophisch behandeln. Der wichtigste Gegenspieler der Mathematiker am Collegio Romano war Benito Pereira, der die Übertragung der Mathematik auf Naturphänomene für unfruchtbar hielt. Claudius und Pereira waren entsprechend diametral entgegengesetzter Meinung darüber, ob die Astronomie – die ihre Erkenntnisse durch mathematisierte Schlussfolgerungen erreichte – eine echte Wissenschaft mit Erklärungspotenzial für die Betrachtung der Natur sein konnte: Clavius bejahte, Pereira verneinte.“
Markus Friedrich, Die Jesuiten. Aufstieg, Niedergang, Neubeginn.
„Denn Verwunderung war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens, indem sie sich anfangs über das nächstliegende Unerklärte verwunderten, denn allmählich fortschritten und auch über Größeres Fragen aufwarfen, z.B. über die Erscheinungen an dem Mond und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls. Wer sich aber über eine Sache fragt und verwundert, der glaubt sie nicht zu kennen. (Deshalb ist der Freund der Sagen auch in gewisser Weise ein Philosoph; denn die Sage besteht aus Wunderbarem).“, schreibt Aristoteles in seiner Metaphysik.1
Bereits die ersten Menschen haben versucht, die überaus anspruchsvolle und zugleich kindliche Frage zu beantworten: Warum gibt es etwas und nicht nichts? Sowohl die Mythologie als auch die ersten polytheistischen (und letzten Endes auch monotheistischen) Vorstellungen der Kulturen und der antiken Gesellschaften stellen den häufig unbeholfenen, wenn man es so will, Versuch dar, eine Lösung zu finden, sich selbst und ihren Kindern eine Orientierungshilfe zu geben, sich in dem ontologischen Chaos der Kreation zurechtzufinden, wenn auch nur ansatzweise.
Arthur Schopenhauer schreibt in seiner wichtigsten Abhandlung Die Welt als Wille und Vorstellung (die später den deutschen Philosophen Nietzsche so sehr beeinflusste):
"Nur dem gedankenlosen Thiere scheint sich die Welt und das Daseyn von selbst zu verstehen: dem Menschen hingegen ist sie ein Problem, dessen sogar der Roheste und Beschränkteste, in einzelnen helleren Augenblicken, lebhaft inne wird, das aber Jedem um so deutlicher und anhaltender ins Bewusstseyn tritt, ja heller und besonnener dieses ist und je mehr Stoff zu Denken er durch Bildung sich angeeignet hat, welches Alles endlich in den zum Philosiphiren geeigneten Köpfen sich zu Platons ϑαυμαζειν, μαλα φιλοσοφικον παϑος (mirari, valde philosophicus affectus) steigert, nämlich zu derjenigen Verwunderung, die das Problem, welche die edlere Menschheit jeder Zeit und jedes Landes unablässig beschäftigt und ihr keine Ruhe läßt, in seiner ganzen Größe erfasst. In der That ist die Unruhe, welche die nie ablaufende Uhr der Metaphysik in Bewegung erhält, das Bewußtseyn, daß das Nichtseyn dieser Welt eben so möglich sei, wie ihr Daseyn."2
Selbst der große Albert Einstein sagte einmal, dass der Kosmos auf Grund seiner Kräfte eigentlich zu schwer sei, um auf Dauer zu existieren. Doch er existiert tatsächlich (nach wissenschaftlicher Lehrmeinung beträgt der Durchmesser des Universums 93 Milliarden Lichtjahre,3 wobei die Berechnungen variieren; da es sich jedoch seit dem Urknall ausdehnt und die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, können wir Objekte ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr sehen. Manche Wissenschaftler sind der Auffassung, dass das Universum 100.000 Billionen Mal größer ist als das für uns wahrnehmbare All).
Vor 13,8 Milliarden Jahren passierte etwas Unbeschreibliches und Änigmatisches. Aus dem Nichts entstand etwas. Etwas, was wir heute sehen, fühlen, spüren, erleben, beobachten, berechnen und bewundern. Doch was ist das genau, das Nichts? Ist es nicht so, dass das Nichts nicht existieren kann? Das Postulat, dass aus dem Nichts plötzlich etwas entsteht, widerspricht angeblich dem gesunden Menschenverstand. Diese einfache „Wahrheit“ ist in ihren logischen und deduktiven Prämissen so deutlich, dass viele Philosophen sich daran immer orientiert haben und sich auf den sogenannten Khalam (auch Kalam)-Beweis bezogen haben. Es handelt sich dabei um einen ganz einfachen Syllogismus: Alles, was existiert, hat einen Anfang. Die Welt existiert. Also hat die Welt einen Anfang. Dieser Anfang ist Gott.
Wir versuchen, den oben geschilderten Syllogismus zu visualisieren:
Der Kalam-Beweis, der ursprünglich auf Aristoteles zurückgeht, enthält weitere Prämissen und Konklusionen, die letztendlich auf die obige These hinauslaufen.
Sicher scheint das Postulat der Existenz Gottes sowohl eine elegante als auch eine einfache Lösung darzustellen. Der Theologe Hans Küng schreibt zum Beispiel:
„Welt oder Gott – das ist keine Alternative: weder die Welt ohne Gott (Atheismus) noch Gott identisch mit der Welt (Pantheismus)! Sondern Gott in der Welt, und die Welt in Gott. Gott und Welt, Gott und Mensch also nicht als zwei konkurrierende endliche Kausalitäten nebeneinander, wo die eine gewinnt, was die andere verliert sondern ineinander: Wenn Gott wirklich der alles umfassende unendliche geistige Urgrund, Urhalt und Ursinn von Welt und Mensch ist, wird deutlich, dass Gott nichts verliert, wenn der Mensch in seiner Endlichkeit gewinnt, sondern dass Gott gewinnt, wenn der Mensch gewinnt.“4
Jedoch wird Gott auf diese Weise zu einem „Lückenbüßer“ degradiert. Mit anderen Worten: Wir können mit Hilfe der heutigen Wissenschaft in die Vergangenheit reisen, um zu eruieren, wie das Universum entstanden ist. Wir wissen, dass irgendwann in der Vergangenheit eine Explosion stattfand, die sich niemand wirklich vorstellen kann: Ja, die Rede ist von dem Urknall. Dabei entstanden Raum, Zeit und Materie.5 In der Inflationsphase expandierte der Raum so rasant, möglicherweise mit einem Vielfachen der heutigen Lichtgeschwindigkeit, dass aus einem winzigen Universum, das ursprünglich kleiner war als ein Atom, eine riesige Konstruktion wurde, von der wir heute nicht einmal das Licht der ersten Augenblicke abfangen können. In der Vergangenheit wurden andere Szenarien entworfen, wobei die heutige Wissenschaft die Vorstellung eines stabilen und ewigen Weltalls, wie sie früher vom Astronomen Fred Hoyle vertreten wurde, ablehnt. Denn die (indirekten) Beweise für den Urknall lassen sich aus unseren empirischen Beobachtungen ableiten. Die Hintergrundstrahlung zum Beispiel.6 Aber da ist noch die Tatsache, dass die Galaxien nachweislich expandieren und sich folglich voneinander entfernen. Wie bereits erwähnt, können wir uns den Urknall als eine riesige Explosion vorstellen. An einem winzigen Punkt war irgendwann in der Vergangenheit eine unglaubliche Menge an Energie komprimiert. Dann kam die unerklärliche Deflagration – also die physikalisch-mathematische Singularität – und das Weltall entstand. Aber eigentlich sollte die Wucht der Explosion irgendwann abnehmen, was jedoch auf Grund der Antigravitationskraft der dunklen Energie nicht geschieht. Bei der Entstehung des Universums wurden die chemischen Elemente Wasserstoff – zunächst ionisiert - und Helium gebildet, die das Universum nach wie vor imprägnieren und ausmachen.7
Irgendwann stoßen wir an einen Punkt, bei dem wir Halt machen müssen. Es ist nämlich physikalisch nicht möglich, jenseits dieser Grenze zu schauen.
An dieser Stelle kann man nicht umhin, an Kants Worte in der Vorrede zur ersten Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft (1787) zu denken:
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.8
Und wer kann diesen dramatischen Umstand besser als Heinrich Heine poetisch ausdrücken?
Fragen
Am Meer, am wüsten, nächtlichen MeerSteht ein Jüngling-Mann,Die Brust voller Wehmut, das Haupt voll Zweifel,Und mit düstern Lippen fragt er die Wogen:"O löst mir das Rätsel des Lebens,Das qualvoll uralte Rätsel,Worüber schon manche Häupter gegrübelt,Häupter in Hieroglyphenmützen.Häupter im Turban und schwarzem Barett,Perückenhäupter und tausend andreArme, schwitzende Menschenhäupter -Sag mir, was bedeutet der Mensch?Woher ist er kommen? Wo geht er hin?Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?"Es murmeln die Wogen ihr ewges Gemurmel,Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken,Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt,Und ein Narr wartet auf Antwort.
(Buch der Lieder, 1827)
Dieser „Narr“ symbolisiert die gesamte Menschheit (auf der rhetorischen Ebene beachte man die Diskrepanz Jüngling-es).
Auch in anderen Kulturen, wie in dem Gedicht von Heine angedeutet, sind die großen philosophischen Fragen im Prinzip immer die gleichen. Man nehme exemplarisch den persischen Dichter Nezāmi (1141-1204?, er hieß vollständig Neẓām ad-Dīn Abū Muhammad Elyās ibn Yusūf ibn Zakī ibn Mu’ayyid). In seinem um 1200 entstandenen Epos Chosrau und Schirin befindet sich ein interessanter Dialog zwischen dem König Xosrov und dem weisen Bozorgommid. An dieser Stelle wird der Dialog wiedergegeben:
Erste Frage des Königs: Welche ist die Erste Bewegung?
Erste Antwort von Bozorgommid: Wir befinden uns zwischen den zehn stummen Sphären, jedoch sind wir zu weit weg von der Ersten Sphäre. Diejenigen, die zu spät gekommen sind, sind außerstande, ein klares Urteil über diesen Punkt zu sprechen. Nur der Erste kennt die Erste Bewegung.
Zweite Frage: Was ist die Sphäre (des Universums)? Was befindet sich außerhalb? Andere Wesen vielleicht?
Zweite Antwort: Sire, Seien Sie nicht zu neugierig. Nur Gott kann wissen, was jenseits der Himmelssphäre ist. Eine Meinung kann man lediglich von dem haben, was auf der Erde kommt und geht: Es ist nicht erlaubt, so forsch über Sachverhalte zu diskutieren, die man durch die eigenen Augen nicht wahrnehmen kann. Der Himmel ist, vor dem Menschen, eine geschlossene Tür.
Dritte Frage: Was bewegt die Himmelskörper? Ich habe erfahren, dass jeder Stern eine Welt an und für sich ist, mit seinem Himmel und seiner Erde, die sich von den anderen abtrennen.
Dritte Antwort: Das habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht, ob dies der Wahrheit entspricht. Das kann man auch nicht genau wissen.
Vierte Frage: Warum leben wir auf dieser Welt? Woher kommen wir? Wo steuern wir hin?
Vierte Antwort: Das ist ein großes Geheimnis, das du erfahren wirst, wenn du nicht mehr unter den Lebenden bist.
Fünfte Frage: Warum sprechen die Toten nicht zu uns und weisen uns nicht den richtigen Weg?
Fünfte Antwort: Die andere Welt ist die wahre Realität dieser Welt, jedoch ist der Gesang der Totenwelt außerstande, das unvollständige und primitive Musikinstrument, das diese Welt ist. Jegliche Kommunikation ist nicht möglich.
Sechste Frage: Warum scheint die Seele noch lebendig zu sein, selbst wenn der Körper im Schlaf tot erscheint? Wenn die Seele vom Körper losgelöst ist, wohin wandern die Seelen so vieler Lebewesen?
Sechste Antwort: Es ist nicht möglich, sich eine Seele ohne Körper vorzustellen, so wie es unmöglich ist, ohne Zirkel die Bewegung des Kreises zu verstehen.
Siebte Frage: Wenn nur die Seele besteht und die körperliche Form abgeschafft ist, was ist dann die körperliche Form der Toten, die wir im Schlaf sehen?
Siebte Antwort: Das ist Gewohnheit. Wenn die Einbildung zum Schlaf dazu kommt, erscheinen dank der Gewohnheit die Seelen.
Achte Frage: Wenn ich tot sein werde, werde ich mich an das mir auf der Erde Geschehene erinnern?
Achte Antwort: Das glaube ich eher nicht.
Neunte Frage: Erkläre mir, was die Erde und die Luft sind.
Neunte Antwort: Die Luft ist Wind, der unter einem anderen Wind weht (das heißt: Das ist Eitelkeit); die Erde ist Schlamm, der nichts wert ist, und der Mensch ist seine letzte Kreatur.
Zehnte Frage: Gib mir einen guten medizinischen Rat.
Zehnte Antwort: Die medizinische Kunst kann wie folgt zusammengefasst werden: Iss und trink alles, was du willst, jedoch nicht zu viel und nicht zu wenig.
Elfte Frage: Auf welcher Weise verlässt die Seele den Körper?
Elfte Antwort: Darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Ich kann dir die Geschichte der vier mobed erzählen, die genau darüber diskutierten. Der erste sagte: Es ist so, als würde sich jemand im Schlaf in einen Strudel werfen; er versucht, sich über Wasser zu halten, aber er geht immer mehr unter, bis er, einmal aufgewacht, sich mit Schrecken an den Traum erinnert. Der zweite sagte: es ist so, als würde jemand, der gerade von einem hohen Turm hinunterfällt, sich an einem Vorsprung festhalten: trotz des Schmerzens an der Hand klammert er sich immer fester, bis er geschwächt mit dem Stück Mauer ins Leere fällt. Der dritte warf ein: So wie der Hirt, welcher, um die Herde vor dem Wolf zu schützen, der sich an seine Klamotten festgreift, diesen wegzerrt, bis die Klamotten zerrissen sind. Der vierte: Wie ein Bräutigam, der die Braut fest umarmt; diese wird verrückt und der Bräutigam weiß nicht, ob er der Schönheit der Frau verfallen sein oder vor ihrer wütenden Rage fliehen soll; zum Schluss flieht er wie die Gazelle vor dem Löwen weg.
Als die viert jedoch starben, sagten sie: O je, der Tod war wirklich anders, als unsere Eloquenz ihn dargestellt hat.
Zwölfte Frage: Ein Araber verlangt, ein Prophet zu sein. Kann das stimmen? Besteht irgendein Verhältnis zwischen seiner Religion und unserer?
Zwölfte Antwort: Das göttliche Wort ist jenseits der weltlichen Formen der Phänomene. Dieser Mann redet weder über den Himmel über uns noch über die Sterne, die nur Form sind, Er ist jedoch Jünger desjenigen, der der Schöpfer der Formen ist und bis zum hohen neunten Himmel fliegen kann. Aber ich, der diesem Himmel fremd bin, wie kann ich von diesem Geheimnis reden? Sire! Nimm den Glauben der Araber nicht auf die kalte Schulter. Das ist etwas Göttliches und mit Gott scherzt man nicht!
Man beachte die angesprochenen Themen: Seele, Gott, Tod, die großen philosophischen Themen also.
Postuliert wird in der Regel, dass Gott irgendwann die folgenschwere Entscheidung traf, das Universum zu schaffen. Das Universum soll also die Folge eines bewussten Schöpfungsaktes sein. Das ergibt einen Sinn und damit könnte man zufrieden sein. Dieser Ansatz ist der Kern des orthodoxen Denkens der sogenannten Kreationisten. Die Welt als Resultat der göttlichen Kreation (der amerikanische Jesuitenpater Guy Consolmagno selbst behauptete einmal, dass der Kreationismus eine neue Art von Heidentum ist, das Götzen schafft).
Philosophisch gesehen ist dieser Ansatz viel zu einfach und geht mit einer ganzen Reihe von Problemen einher: Im Folgenden wird exemplarisch auf zwei hingewiesen.
Erstens:
Wir versuchen, erstmals theologisch bzw. philosophisch und nicht naturwissenschaftlich zu argumentieren. Wenn Gott irgendwann in der Vergangenheit – wobei dieser Begriff unpassend ist, da Raum und Zeit vor dem Urknall nicht existierten; schon hier müsste das Scheitern dieser Annahme erkennbar sein – das Bedürfnis spürte, das Universum zu kreieren, dann muss Er irgendwann eine Veränderung in sich erlebt haben. Wenn das der Fall ist, dann kann dieses Wesen nicht Gott gewesen sein, der per definitionem perfekt, ewig und unwandelbar ist. So auch in der folgenden Stelle aus Georg Büchners Dantons Tod. In der ersten Szene des dritten Aktes sagt der gefangene Payne:
„Es gibt keinen Gott, denn: entweder hat Gott die Welt geschaffen oder nicht. Hat er sie nicht geschaffen, so hat die Welt ihren Grund in sich und es gibt keinen Gott, da Gott nur dadurch Gott wird, dass er den Grund alles Seins enthält. – Nun kann aber Gott die Welt nicht geschaffen haben, denn entweder ist die Schöpfung ewig wie Gott, oder sie hat einen Anfang. Ist Letzteres der Fall, so muss Gott sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen haben, Gott muss also, nachdem er eine Ewigkeit geruht, einmal tätig geworden sein, muss also einmal eine Veränderung in sich erlitten haben, die den Begriff Zeit auf ihn anwenden lässt, was beides gegen das Wesen Gottes streitet. Gott kann also die Welt nicht geschaffen haben. Da wir nun aber sehr deutlich wissen, dass die Welt oder dass unser Ich wenigstens vorhanden ist und dass sie dem Vorhergehenden nach also auch ihren Grund in sich oder in etwas haben muss, das nicht Gott ist, so kann es keinen Gott geben. Quod erat demonstrandum.“
Die menschliche Vorstellung von ewiger Perfektion verbietet die Annahme einer Veränderung in einem vollkommenen Wesen. Aber vielleicht kann dies trotzdem passieren; falls dies jedoch der Fall sein sollte, müssten die Menschen zwangsweise ihre definitorischen Begriffe revidieren und dieser Umstand würde zu einer kompletten Infragestellung der epistemologischen Prämissen des Denkens und des philosophisch-theologischen Vokabulars führen, mit der Folge, dass die eben vorgestellten Lehren ihre Gültigkeit bzw. ihren Gültigkeitsanspruch einbüßen würden.
Zweitens:
Wenn Gott das Universum erschaffen hat, wer hat Gott erschaffen? Das ist allerdings eine Frage, die sich auch die Theologie gestellt hat und immer noch stellt. Um diese Aporie zu lösen - aber man weiß ja doch, dass man in der Theologie im Prinzip alles zurechtbiegen kann -, greift die Religion auf ein Dogma zurück, das beim genaueren Hinschauen eher als Totschlagargument zu betrachten ist: Gott existiert ab aeterno, Er ist sozusagen causa sui, nichts und niemand hat Ihn erschaffen: Er war schon immer da und wird immer da sein, auch nach dem Untergang des Universums (das übrigens nicht erfolgen wird, da dieses laut Prognose der Experten eher in ewiger Kälte erstarren wird, auf ewig dunkel, leblos und sinnlos).
Gott soll also das Universum ex nihilo erschaffen haben, vielleicht weil Er dazu Lust verspürte (ein Umstand, der uns auf direktem Weg zum bereits geschilderten Problem führt). Manche behaupten sogar, dass Gott dermaßen perfekt ist, dass es nicht einmal notwendig ist, dass Er existiert. Dies würde jedoch das ganze religiöse Konstrukt abermals in Frage stellen.
Wir Menschen können das natürlich nicht verstehen, da wir, so würde es Immanuel Kant erklären, anhand von angeborenen a priori-Kategorien denken (wie zum Beispiel Raum, Zeit und Kausalität), die uns nicht ermöglichen, diese autonome, oder sogar autarke, Wahrheit zu erfassen. Das Problem dabei ist, dass diese Annahme eine Frage des Glaubens ist. Man kann nicht naturwissenschaftlich und theologisch argumentieren, zumindest in diesem kontextuellen Rahmen. Die beiden Jesuiten Guy Consolomagno und Paul Müller schreiben:
„So kann man auch Naturwissenschaft und Glauben zueinander in Beziehung setzen: Als einen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Blicken auf ein und dieselbe Welt. Wir können die Welt durch die Augen der Naturwissenschaft oder des Glaubens sehen. Und wenn wir sie durch die Augen des Glaubens sehen, dann beschäftigen wir uns oft vor allem mit der alltäglichen Erfahrung des Richtigen, Guten und Schönen.“9
An anderer Stelle heißt es: