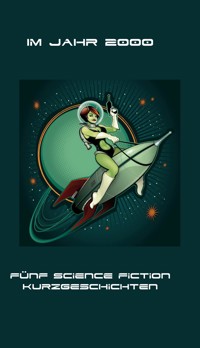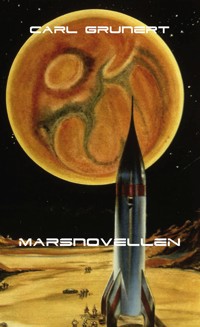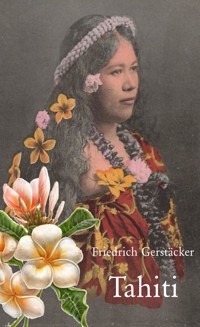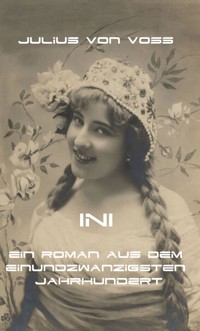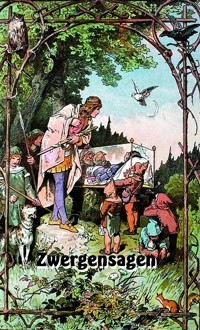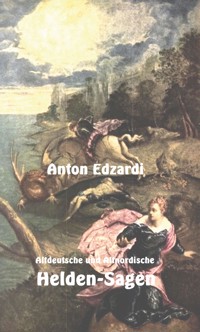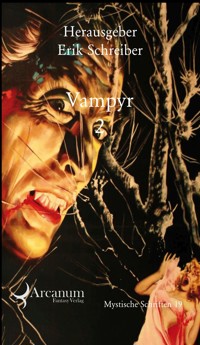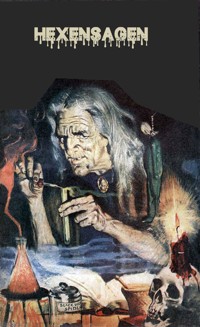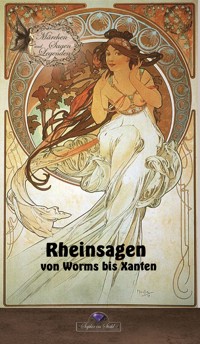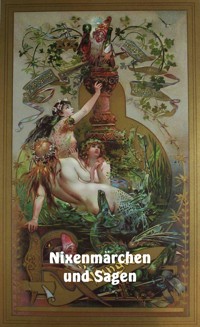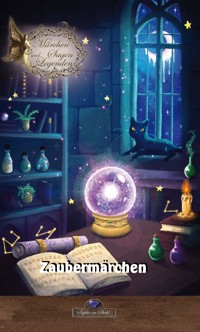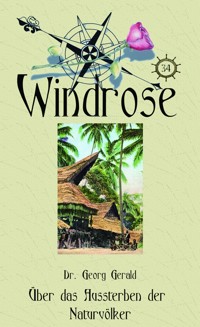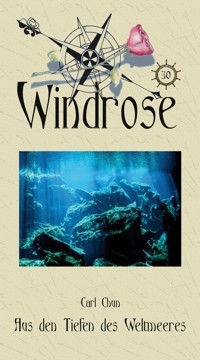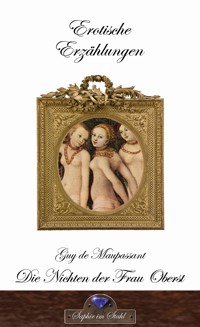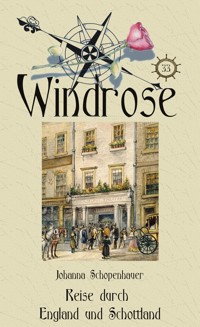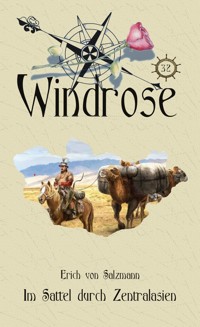4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Reise nach Freiland beschreibt die Reise des Protagonisten in ein neues Land mit einer neuen sozialen Struktur. Es geht dem Autor darum, sich aus dem Leben der europäischen Adelsstrukturen und aufkommenden Demokratieversuche zu lösen und ein ganz neues Land zu erfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Klassische Science Fiction
Theodor Hertzka
Eine Reise nach Freiland
e-book 24
Klassische Science Fiction
Theodor Hertzka - Eine Reise nach Freiland (1893)
Erscheinungstermin 01.12.2025
© Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
Titelbild: Archiv Andromeda
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Klassische Science Fiction
Theodor Hertzka
Eine Reise nach Freiland
Inhaltsverzeichnis.
Vorwort
1. Kap. Warum ich auswanderte
2. Kap. Die Reise
3. Kap. Wo Freiland liegt und was Freiland ist
4. Kap. Wer mir in Freiland die Stiefel putzte und wie es dort in den Straßen aussieht. Das Eigentum an Wohnhäusern
5. Kap. Wie ich in Freiland einen Beruf wählte und im Speisehause mein Mittagessen bezahlte
6. Kap. Das Statut einer freiländischen Erwerbsgesellschaft und die Arbeitserträge
7. Kap. Warum Freiland so viel Maschinen verwendet und woher es sie nimmt
8. Kap. Ein freiländisches Hauswesen und das freiländische Versorgungsrecht
9. Kap. Die Zentralbank das Geldwesen und das Lagerhaus. Über die Freiheit in Freiland
10. Kap. Unmöglichkeit von Krisen in Freiland. Die freiländische Rentenversicherung
11. Kap. Eine Ferienreise in Freiland. Der landwirtschaftliche Betrieb. Verteilung von
Boden und Kapital
12. Kap. Eine Gründung in Freiland
13. Kap. Die Verfassung von Freiland. Die freiländische Steuer
14. Kap. Über Geselligkeit, Liebe und Religion in Freiland
15. Kap. Über die Tüchtigkeit der gewählten Betriebsleitungen, künstlerische Produktion, Kommunismus und Anarchismus, Staatsbetrieb, allgemeine Anwendbarkeit der freiländischen Grundsätze und die Furcht vor Übervölkerung
Schlusskapitel
Biographie
Vorwort
Zunächst das Geständnis, dass dieses Büchlein eine Tendenzschrift im schlimmsten Sinne des Wortes ist. Unter dem Deckmantel der Unterhaltung und Belehrung will sie den Leser nicht bloß für eine bestimmte Meinung, sondern geradezu für bestimmte Handlungen gewinnen, sie hat es nicht bloß auf seinen Geist und sein Herz, sondern auf seine Entschlüsse und seinen Geldbeutel abgesehen.
Wohl dürften die meisten, an diese Stelle angelangt, mit überlegenem Lächeln sich sagen, der allzu gewissenhafte Autor hätte diese Warnung sparen können; die Gemüter sowie die Geldbeutel seien heutzutage viel zu gut verwahrt, als dass es noch so aufdringlicher Tendenz leichthin gelingen könnte, sich ihrer zu bemächtigen. Wenn ich hinzufüge, dass das Unternehmen, zu welchem ich tatkräftige Mitwirkung durch diese Schrift gewinnen will, nicht mehr und nicht weniger ist, als die Schaffung eines Gemeinwesens der sozialen Freiheit und Gerechtigkeit, d. i. eines solchen, welches jedermann den vollen und ganzen Ertrag der eigenen Arbeit bei unbedingter Wahrung seines freien Selbstbestimmungsrechtes gewährleisten soll, dann wird wahrscheinlich besagtes überlegene Lächeln eine leise Beimischung von Mitleid erhalten, und wenn ich vollends gestehe, dass dieses Eldorado in den Hochlanden Afrikas just unter dem Äquator geplant ist, so dürfte es wohl wenige geben, welche die Zumutung, sie könnten derart überspannte Phantasien ernsthaft nehmen, nicht als beleidigenden Zweifel in ihre Bildung, in ihren gesunden Menschenverstand, ja in ihre Zurechnungsfähigkeit auffassen würden. Der Autor möge nur ruhig sein, so höre ich sie ausrufen; Utopien dieser Art liest man, falls sie unterhaltend geschrieben sind, um sich über eine müßige Stunde hinwegzuhelfen, und damit holla!
Aber der verständige Leser irrt! Ich spreche aus Erfahrung! Dieses Büchlein ist nämlich nicht das Erste, das ich zu gleichem Zwecke geschrieben. Vor vier Jahren veröffentlichte ich „Freiland, ein soziales Zukunftsbild“, von welchem er vielleicht dunkle Kunde bereits vernommen. Nun denn, die bisher erschienenen neun deutschen und zahlreichen fremdsprachlichen Auflagen dieses Werkes verlockten tausende und abertausende von Männern und Frauen aus allen Teilen der bewohnten Erde und aus allen Ständen, vom reichsunmittelbaren Fürsten bis zum einfachen Arbeiter zu dem Entschluss, auszuführen, was in ihm geschildert ist; in achtundzwanzig Städten Europas und Amerikas haben sich Vereine zum Zwecke der freiländischen Propaganda gebildet, Gelder wurden zur Verfügung gestellt, eine Vereinszeitschrift gegründet, an der ostafrikanischen Küste sind der Gesellschaft zur Anlage von Etappenstationen geeignete Ländereien geschenkt worden und alle Vorbereitungen zu praktischer Inangriffnahme des großen Werkes sind im Zuge.
Und die Erklärung dieses seltsamen Unterfangens, die Traumgebilde eines Buches zu verwirklichen? Sie liegt darin, dass dieses Traumgebilde den Stempel höchster innerer Wahrhaftigkeit trägt, dass es buchstäblich verwirklicht werden kann, sofern sich nur eine genügende Anzahl tatkräftiger, von Mitteln nicht allzu sehr entblößter Menschen in diesem Entschluss zusammenfindet und dass damit vollbracht wäre, was Jahrtausende hindurch den edelsten Geistern unseres Geschlechts als Ziel all ihres Denkens, Kämpfens und Leidens vorgeschwebt. Der Verfasser von „Freiland“ maßt sich nicht an, weiser, scharfsinniger oder mutiger zu sein als diese großen Vorfahren, indem er zur Tat machen will, was jene bloß ersehnten; aber er zeigt, dass und warum nunmehr möglich, ja notwendig geworden, was im bisherigen Verlaufe der menschlichen Entwickelungsgeschichte unmöglich gewesen. „Freiland“, so behauptet er, ist nichts anderes, als das Schlusskapitel jenes großen Erlösungswerkes, an welchem die Menschenfreunde aller Generationen mitgearbeitet.
Für diese erlösende Tat neue Helfer zu gewinnen, das ist die ausschließliche Absicht auch des vorliegenden Büchleins. Der Leser wird darin nach Freiland geführt, als ob es schon bestände, in der Erwartung, dass die Einrichtungen, die ihm dort vor das geistige Auge treten, den Entschluss in ihm erwecken, das Seinige zu möglichst rascher und großartiger Verwirklichung dieses Gemeinwesens der Freiheit und Gerechtigkeit beizutragen. In welcher Weise diese Verwirklichung vor sich gehen soll, oder vielleicht schon vor sich geht, denn möglicher-, ja wahrscheinlicherweise sind die ersten freiländischen Pioniere bereits unterwegs, wenn die „Reise nach Freiland“ die Presse verlässt, muss in meinem oben erwähnten früheren Werk nachgelesen werden; nur so viel sei hier nochmals versichert, dass der äußere Schauplatz wie die innere Begründung der im nachfolgenden geschilderten, überaus einfachen Begebenheiten in allen Stücken der nüchternsten Wahrheit entspricht. Die Alpenlandschaften des Kenia sind tatsächlich jenes irdische Paradies, als welches sie sich hier dargestellt finden, und die Menschen, die ich handelnd und redend auftreten lasse, sie handeln und reden zwar einstweilen nur in meiner Phantasie, aber alles, was sie tun und was sie sprechen, folgt den Gesetzen der nüchternsten Notwendigkeit. Freiland ist zur Stunde, wo ich dies schreibe, noch nicht gegründet; aber wenn es gegründet sein wird, kann in ihm nichts wesentlich anderes geschehen als was die „Reise nach Freiland“ ihren Lesern erzählt.
Und zum Schluss noch eines.
Ich habe in meiner Geschichte einen Professor der Nationalökonomie als Kritiker der freiländischen Einrichtungen auftreten und seine Bemängelungen durch meine Freiländer widerlegen lassen. Es könnte nun scheinen, als ob in dieser Figur ein Popanz vorgeführt würde, der möglichst durchsichtige Irrtümer eigens zu dem Zwecke vorzubringen habe, um der freiländischen Sache zu wohlfeilen Siegen zu verhelfen; dem ist jedoch nicht so. Zwar die Person besagten Professors lebt nur in der Vorstellung des Verfassers, dagegen ist alles, was er sagt, wörtlich in den gegen „Freiland“ gerichteten gelehrten Kritiken zu lesen. In der Vorrede zu meinem erwähnten früheren Buch hatte ich nämlich in Anbetracht des Umstandes, dass Selbiges in erzählender Form ein Bild der wirklichen sozialen Zukunft zu bieten den Anspruch erhebe, die fachmännische Kritik aufgefordert, es in allen seinen Teilen der strengsten Prüfung zu unterziehen. Dieser Aufforderung wurde denn von Seiten meiner Fachgenossen in ausgiebigstem Maße entsprochen; zahllose Artikel in den großen Tagesblättern, in gelehrten Fachzeitungen und Broschüren haben sich mit „Freiland“ teils zustimmend, teils tadelnd beschäftigt, und was ich nun meinem Professor Tenax in den Mund lege, ist nichts anderes, als eine Blütenlese aus den gegnerischen Rezensionen. Dabei darf ich versichern, dass es nicht die schlechtesten, sondern die besten Argumente der Gegner sind, die sich hier behandelt finden; ich habe nichts übergangen, was irgend durch das persönliche Gewicht des Kritikers oder durch den leisesten Anschein innerer Berechtigung Anspruch auf Berücksichtigung haben mochte, und ebenso nichts aufgenommen, was nicht unter dem einen dieser beiden Gesichtspunkte Beachtung erforderte. Ich habe nichts erdichtet und nichts verschwiegen, und wenn der unbefangene Leser finden sollte, dass die Angriffe, die mein Professor Tenax gegen die freiländische Sache richtet, durchaus danach angetan sind, deren Unanfechtbarkeit erst recht in helles Licht zu setzen, so wird dies ein Erfolg sein, den ich nicht mir, sondern meinen Kritikern verdanke.
Wien, 1893
Theodor Hertzka
Erstes Kapitel
Warum ich auswanderte
Jetzt hält mich nichts mehr; mein Entschluss steht fest; ich ziehe nach Freiland!
Warum? Meine guten Freunde sagen, weil ich ein überspannter Phantast sei, ja, ich vermute, dass es, wenn ich nicht dabei bin, kürzer und einfacher heißt: „weil er ein Narr ist.“
Ob sie nicht vielleicht recht haben?
Wenn in allen Stücken anders denken, als alle anderen, närrisch sein heißt, dann bin ich ein Narr. Denn ich denke wirklich in allen, zum mindesten in allen wichtigen Stücken anders, als meine Bekannten und Freunde, deren ich, da ich reich bin, eine erstaunlich große Zahl besitze. Und sie alle halten mich für glücklich, beweisen mir täglich mit unwiderleglichen Gründen, dass ich es sei, während ich und das ist eben meine fixe Idee mich tief unglücklich fühle. Nicht etwa, dass ich den Spleen hätte; bewahre! Ich bin voll Lebensdrang und von Natur aus heiteren Gemütes; dabei jung, gesund und wie schon gesagt, reich, besitze ein angenehmes Äußere und meine Erfolge in der „Gesellschaft“ lassen so wenig zu wünschen übrig, dass ich bis vor wenigen Stunden der vielbeneidete Bräutigam eines der schönsten, gebildetsten und liebenswürdigsten Mädchen aus einer der ersten Familien unserer Stadt war.
Wenn der scharfsinnige Leser hier die Schlussfolgerung zieht, dass ich zur Stunde, wo ich dieses schreibe, nicht mehr Bräutigam dieser schönen, gebildeten und liebenswürdigen Dame aus vornehmem Hause sei, so hat er richtig geraten; wenn er aber weiter kombinieren sollte, dass vielleicht dieser Verlust mich in so weltschmerzende Stimmung versetze, so irrt er. Mein Weltschmerz trägt die Schuld, dass ich meine Braut verlor, aber der Abschied, den mir meine Braut gab, ist ganz und gar unschuldig an meinem Weltschmerz. Im Gegenteil; ich darf behaupten, dass ich mich ruhiger, hoffnungsvoller fühle, seitdem mich mein zukünftig gewesener Schwiegervater für einen unverbesserlichen Faselanten erklärte, der sich hinfort seine Tochter aus dem Kopfe schlagen möge, und diese Tochter, unter Tränen, aber deshalb nicht minder entschieden, ihm Zustimmung genickt hatte. Aber auch gegen die Auffassung muss ich mich verwahren, als ob mir meine Braut gleichgültig gewesen, es sich zwischen ihr und mir wohl gar um eine bloße Konvenienzehe gehandelt, bei welcher gesellschaftliche Stellung und Vermögen die Hauptsache, die Personen bloßes Beiwerk gewesen. Zwar auf der andern Seite darüber gab ich mich keinen Augenblick einer Täuschung hin waren meine äußeren Glücksumstände wohl stets das Ausschlaggebende; meiner Braut und ihrer ganzen Familie wäre es sicherlich nicht beigefallen, an eine Verbindung mit mir zu denken, auch wenn ich tausendfach klüger, hübscher, gelehrter wäre, als tatsächlich der Fall, dabei aber nicht genügendes Vermögen besäße; indessen gerade der Anlass des Bruches beweist, dass ihnen denn doch auch meine persönlichen Eigenschaften nicht ganz gleichgültig erschienen, denn nur um diese, nicht um meine Glücksumstände hatte es sich bei der Lösungskatastrophe gehandelt. Und was vollends meine Gefühle betrifft, so kann ich mit gutem Gewissen versichern, dass dieselben stets nur den persönlichen Tugenden und Reizen meiner Verlobten galten. Für „ewig“ hatte ich meine Liebe selber niemals gehalten; doch wer mir gestern gesagt hätte, dass ich auf dieses schönheitsstrahlende Geschöpf verzichten könnte, ohne in gelinde Verzweiflung zu verfallen, den hätte ich für einen schwarzen Verleumder erklärt. Aber Tatsache ist eben, dass mich der Bruch dieses Verlöbnisses wunderbar gleichgültig lässt, ja dass ich eine sonderbare Genugtuung und Beruhigung darob empfinde. Mir ist zu Mute, als ob ich einer Fessel ledig wäre, als ob ich meinem ureigensten Selbst wiedergegeben sei und jetzt erst tun könne und müssen, was ich längst hätte tun sollen und eigentlich, ohne mir selbst klar darüber geworden zu sein, längst gewollt.
Doch mit all dem habe ich immer noch nicht gesagt, worin mein Unglück, oder das, was ich dafürhalte, zu suchen sei. Es ist, fast schäme ich mich, es zu gestehen, das Elend anderer Leute. Ich leide, weil Menschen, die mich offenbar gar nichts angehen, hungern und frieren, in Not und Entwürdigung schmachten. Ich werde den Gedanken nicht los, dass es meine Pflicht wäre, ihnen irgendwie zu helfen, trotzdem sie durchaus keinen andern Anspruch auf mein Mitgefühl besitzen, als die Tatsache, von einem menschlichen Weibe geboren zu sein, gleich mir. Und das ist nicht etwa ein kühler, nüchterner Gedanke, der durch die Vorstellung, dass sich diesen Elenden eben nicht helfen lasse, leicht zum Schweigen zu bringen wäre, sondern ein brennendes, stürmisches Begehren, welches allen Einschläferungsversuchen standhält. Der leckerste Bissen wird mir vergällt, wenn ich, indem ich ihn zum Munde führe, zufällig daran denke, dass Mitmenschen, die durchaus für meinesgleichen zu halten ich mir nun einmal in den Kopf gesetzt habe, Mangel am Notwendigsten leiden, während ich prasse. Meine krankhafte Phantasie gaukelt mir in solchen Momenten allerlei aberwitzige Vorstellungen von hohläugigen, verschmachtenden Männern, Weibern und Kindern vor, und gesellt sich dazu noch die Einbildung, dass diese Ärmsten vielleicht gerade diejenigen sind, die den Schweiß ihres Angesichtes und das Mark ihrer Knochen daransetzen mussten, dasjenige hervorzubringen, was zu genießen ich mich anschicke, so wird mir, als röche ich diesen Schweiß, als schmecke meine Zunge das Mark, und mit dem behaglichen Genießen ist es natürlich vorbei. Ähnlich ergeht es mir mit all den guten und schönen Dingen, die ich mir kraft meines Reichtums verschaffen kann, und deren sich andere, normal veranlagte Menschen harmlos erfreuen; mir grinst aus ihnen allen die Marter um ihr Recht am Leben betrogener Mitmenschen entgegen.
Und wenn es dabei noch sein Bewenden hätte! Aber der Quälgeist in meinem Gemüte macht mich verantwortlich für die Laster und Verbrechen anderer. „Jener Dieb, den sie heute eingefangen“, so raunt er mir zu, „hätte sich niemals gegen die Gesetze vergangen, wenn ihm diese die Möglichkeit ließen, sich und die Seinen ehrlich zu ernähren; du aber bist es, der Vorteil aus diesen Gesetzen zieht. Der Raubmörder, den sie morgen henken werden, er hat seine Tat aus Not begangen; du mit den deinen, ihr schuf seine Not! Das Mädchen dort an der Straßenecke, das seinen Leib um Geld feil hält, es wäre glückliche Gattin und Mutter, hättet ihr den Mann, der sie liebte, nicht gehindert, eine Familie zu gründen!“
Und so erfolgreich waren diese unablässigen Einflüsterungen, dass der Dämon mich endlich dahin brachte, Redensarten wie: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ oder: „Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem andern zu“, buchstäblich zu nehmen und mich mit dem Gedanken ihrer Ausübung zu beschäftigen, als ob nicht jeder Gebildete wusste, dass sie nur da sind, damit empfindsame Gemüter sich an der Erhabenheit ihres Inhaltes erbauen, nicht aber, damit man danach handle. Wohin kämen wir, wollten wir unsern Nächsten wirklich lieben wie uns selbst? Wir leben im Zeitalter der Humanität und leisten an Nächstenliebe ohnehin das Menschenmögliche; aber: „wie sich selbst“, das hieße ja: „wie ein Wesen derselben Art, desselben Rechts an das Leben, wie wir, also nicht wie unsere Haustiere, die wir ausnützen, als bloße Mittel zu unseren Zwecken behandeln.“ Oder: „Andern nicht zufügen, was man nicht wolle, das einem selber geschehe!“ Kann ich wollen, dass andere mich zum Tragen ihrer Lasten gebrauchen? Sicherlich nicht. Also dürfte ich auch andere nicht zum Tragen meiner Lasten gebrauchen?
Zum Entsetzen all meiner wohlgesinnten Freunde schrecke ich selbst vor dieser äußersten Konsequenz nicht zurück. Die erprobtesten Vernunftgründe scheitern an meiner Verblendung. Das möge dem Ideale der Gerechtigkeit entsprechen, so wird mir vorgehalten,, wenn wir aber allesamt an der Last dieser Welt gleichmäßig mitzutragen hätten, dann wäre das unvermeidliche Ergebnis, dass wir allesamt hart beladene, arme Teufel blieben, was nicht bloß ein schlechter Tausch für die Wenigen wäre, die in der angenehmen Lage sind, ihre Last den Vielen aufzubürden, sondern schließlich auch für diese Vielen selbst. Denn allgemeine Armut bedeute ja Stillstand der Kultur, Barbarei; die Kultur aber sei es, was uns die Mittel zu Erleichterung der Lasten des Lebens an die Hand gebe, mit andern Worten, der ausgebeutete Arbeiter der Kulturwelt sei immer noch besser daran, als der Wilde.
Und was antworte ich auf diesen grundgelehrten, von tiefster Einsicht in den Zusammenhang aller Dinge Zeugnis ablegenden Vorhalt? Bin ich gerührt vom Opfermute jener Edlen, die sich lediglich im Interesse des Kulturfortschrittes dazu hergeben, zu genießen, was das Ergebnis der Arbeit anderer ist? Keineswegs. Ich frage mit teuflischem Hohne, wozu wir denn all die herrlichen Erfindungen der Neuzeit, auf die wir so stolz sind, gemacht hätten, wenn nicht dazu, den Elementen jene Last aufzuerlegen, die wir gestützt allein auf die eigene Kraft allerdings nicht ohne Schaden für die Kultur gerecht verteilen könnten? Ob wir den Wolken ihren Blitz, der Unterwelt ihr Feuer bloß deshalb geraubt, damit aus zahllosen Schloten möglichst dichter Kohlendampf als süßer Opferduft gen Himmel steige? Ob das vielleicht der Weihrauch sei, mit dem wir unserem Götzen „Mammon“ räucherten? Denn einen andern Zweck unseres sogenannten Fortschritts vermochte ich bisher nicht zu entdecken. Keines arbeitenden Menschen Plage sei zur Stunde durch die Riesen „Dampf“ und „Elektrizität“ erleichtert worden, ja das Elend von Millionen werde nur desto ingrimmiger und bitterer, je höher unsere Kunst wachse, Überfluss zu erzeugen. Und ob denn die Menschheit wirklich so blödsinnig geworden sei, das alles für selbstverständlich und unabänderlich zu halten, eine Gedankenlosigkeit, von welcher frühere Jahrhunderte und Jahrtausende frei gewesen. Zwar, dass Elend und Knechtschaft notwendig seien, habe man vor Zeiten ebenso geglaubt als gegenwärtig, aber man habe wenigstens gewusst, warum man das glaubte und auch recht klare Vorstellungen darüber genährt, was geschehen musste, damit Elend und Knechtschaft überwunden würden. Schon Plato und Aristoteles hätten gelehrt, dass die Knechtschaft in dem Unvermögen begründet sei, Reichtum und müssen für alle zu erzeugen. „Wenn das Weberschiffchen ohne Weber läuft und der Pflug ohne Stier sich bewegt, dann werden alle Menschen frei und gleich sein,“ erklärte Aristoteles. Und ganz im gleichen Sinne, nur viel bestimmter noch, habe sich zwei Jahrtausende nach dem großen Griechen Bacon von Verulam, der Begründer der modernen Naturwissenschaften, ausgesprochen. Er habe prophetischen Blicks die Zeit kommen sehen, wo die Elemente alle grobe aufreibende Arbeit für den Menschen verrichten würden, und als selbstverständliche Folge davon vorhergesagt, dass Knechtschaft und Elend aus der Welt verschwinden. Nun denn, diese Zeit sei gekommen, das Weberschiffchen bewege sich ohne den Weber, der Pflug ohne den Stier, die Elemente seien bereit, alle grobe aufreibende Arbeit für den Menschen zu verrichten; das Geschlecht aber, das all das erlebt und das dreimal seligzupreisen wäre, wenn es zu nützen wusste, was ihm zu teil geworden, es verschließe seine Augen gegen die einzig vernünftige Bedeutung des unermesslichen Heils, glaube noch immer der Knechtschaft zu bedürfen und verurteile sich damit selber zum Elend.
Nur freilich, wie man es anzustellen habe, um die Menschheit dieses Heils teilhaftig werden zu lassen, darüber hatte ich, trotz meines Dämons, lange Zeit keinerlei klare Vorstellung. Dass die kommunistischen und anarchistischen Weltverbesserungspläne nichts taugten, begriff ich. Die einen hätten die Erde in ein großes Zwangsarbeitshaus verwandelt, die zweiten unmittelbar der Barbarei überantwortet. Ich wollte weder die Freiheit noch die Ordnung missen, wie beide zu vereinbaren wären, wusste ich nicht, so felsenfest auch meine Überzeugung war, dass es geschehen müssen und daher geschehen werde.
Da erstand Freiland, der Weg der Freiheit und Ordnung war gefunden und mächtig drängte es mich, ihn zu betreten. Aber mein Wille war nicht stark genug, um die Bande zu zerreißen, die mich hier festhielten. Ich hätte eine alte Mutter, und als diese gestorben war, eine reizende Braut zurücklassen müssen; zu beidem fand ich nicht den Mut und nicht die Kraft. Jetzt aber bin ich frei, frei wie der Vogel in der Luft, und das ist folgendermaßen gekommen. Man erwarte hier keine hochromantische Verwickelung; alles, was sich begab, ist so alltäglich als möglich, und was für mein Verlöbnis zur trennenden Katastrophe geworden, würde die meisten in meiner Lage sehr gleichgültig gelassen haben. Doch zur Sache.
Nach all dem, was ich dem Leser schon gebeichtet, wird er es erklärlich finden, dass es meinem Geschmack nicht entsprach, als vornehmer Müßiggänger zu leben, wie mir mein Reichtum ermöglicht hätte. Nicht dass ich mir einbildete, durch welche Tätigkeit immer innerhalb des Rahmens der bestehenden Gesellschaft das Unrecht, welches deren Unterlage ist, gutmachen oder auch nur mildern zu können. Ich wollte arbeiten, ernstlich arbeiten lediglich aus dem Grunde, weil mir der Müßiggang verächtlich erschien. Ich wählte daher einen Beruf und zwar den eines Ingenieurs und bewarb mich nach beendigten Studien um eine entsprechende Stellung. Meiner Verlobten und deren Eltern war das nicht recht, denn sie meinten, dass für einen jungen Mann meines Reichtums und meines gesellschaftlichen Ranges, wenn er schon durchaus „arbeiten“ wolle, ein anderer Beruf passender gewesen wäre. Indessen, da ich auf meinen Willen bestand, ließ man mich gewähren. Aber die Anstellung verzögerte sich; es verstrichen zwei Jahre und immer noch kam das erwartete Dekret nicht. Da mengte sich der Vater meiner Braut in die Sache: Sicherlich hätte ich, als unpraktischer Idealist, der ich nun einmal sei, alles so verkehrt als möglich angefasst, da andernfalls ganz und gar unbegreiflich wäre, dass man einen Mann von meinen „Konnexionen“ so lange auf eine so bescheidene Stelle warten lasse. Darauf antwortete ich, dass meine Konnexionen mit meinem Anstellungsgesuche nichts zu tun hätten. Der Amtsvorstand, mit dem ich in der Sache verkehrte, kenne mich nicht näher, und da mein Familienname zu den häufig vorkommenden gehört, so vermute der gute Mann offenbar nicht im entferntesten, dass es der vornehme, reiche N. sei, der ihm die Ehre antun wolle, unter seiner Leitung Pläne zu zeichnen und Maschinen zu konstruieren.
Dieses Gespräch hatte vorgestern stattgefunden. Heute morgens brachte mir ein Amtsdiener mein Bestallungsdekret ins Haus. Freudig überrascht eilte ich in die Anstalt, um dem Direktor meine Dankesvisite abzustatten. Er empfing mich mit freundschaftlichen Vorwürfen darüber, dass ich gleichsam inkognito mich um ein Amt beworben und entschuldigte sich geradezu, mich so lange warten gelassen zu haben. „Hätte Ihr zukünftiger Schwiegerpapa mich nicht mit seinem Besuche beehrt“, meinte er schmunzelnd, „so wusste ich heute noch nicht, wer Sie sind.“
Mich ärgerte das nicht wenig. Ich hatte mir geschmeichelt, durch meine Zeugnisse, die Beweise meines Fleißes und meiner Kenntnisse, etwas erlangen zu können und sah mich nun durch meine „Konnexionen“ ins Amt gebracht. Allein die Sache war einmal geschehen und so machte ich denn leidlich gute Miene zum bösen Spiel. Ich verabschiedete mich unter den üblichen Höflichkeitsphrasen und hatte nur die Absicht, meinem schwiegerväterlichen Freunde einige Vorwürfe wegen seiner unerbetenen Einmischung zu machen. Allein es sollte anders kommen.
Im Begriffe fortzugehen, stieß ich im Wartezimmer des Direktors auf einen Kollegen, den ich schon wiederholt hier getroffen und der, wie ich wusste, gleichfalls auf Anstellung wartete, nur, zum Unterschied von mir, nicht seit zwei, sondern schon seit vier Jahren. Ich erzählte ihm, dass ich soeben eine Stelle erhalten hätte, und bezeichnete dieselbe auf Befragen genauer. Da verfärbte sich der Mann plötzlich und wäre, hätte ich ihn nicht rasch aufgefangen, zu Boden gesunken. Peinlicher Ahnungen voll forschte ich nach der Ursache dieses auffallenden Benehmens und erfuhr denn, dass die mir zuteil gewordene Stelle gerade diejenige sei, auf die man ihn seit Jahr und Tag vertröstete. Nun wusste ich, dass der Bedauernswerte früher einmal schon Angestellter des nämlichen Instituts gewesen, seinen Dienst auch zu voller Zufriedenheit versehen und nur deshalb entlassen worden war, weil die Abteilung, in welcher er beschäftigt gewesen, aufgelöst wurde. Dabei war der Mann verheiratet, Vater von vier Kindern und während der langen Wartezeit allgemach ins tiefste Elend geraten. Die letzte Habe war bereits gepfändet und die Familie stand unmittelbar vor dem Hungertode. Das alles erzählte er mir, mühsam die Worte hervorwürgend, und in seinen Augen flimmerte es seltsam unheimlich, wie von Gedanken an Rasiermesser, Kohlendunst oder sonstige Mittel des Selbstmordes.
Mein Entschluss war sofort gefasst. Ich ersuchte den Ärmsten, mich zu erwarten und ließ mich neuerlich beim Direktor melden. Diesem erklärte ich in kurzen, dürren Worten, was ich erfuhr, gab ihm mein Dekret zurück und forderte ihn auf, die Anstellung dem älteren, besser berechtigten Bewerber zuzuwenden. Er lachte mich aus. „Wenn Sie es nicht werden, so gibt es andere Aspiranten in Fülle, die Ihrem Schützling vorangehen. Ich selbst bedauere den armen Teufel, aber was soll ich machen? Nicht weniger als sieben Bewerber um dieselbe Stelle werden von unterschiedlichen einflussreichen Persönlichkeiten protegiert und sie ist nur aus dem Grunde bisher nicht vergeben worden, weil diese verschiedenen Einflüsse sich gegenseitig die Waage hielten. Ihre Konnexionen gehen denen aller anderen entschieden vor; dies hat dem Schwanken ein Ende gemacht. Sie blicken mich verächtlich und zornsprühend an? Ja, vermuten Sie denn, dass mir Protektionskinder lieber sind als verdiente Kollegen? Bin ich denn der Herr hier? Hänge ich nicht selber ab von jenen Einflüssen, die bei dieser Anstellung spielen? Ließe ich mir beifallen, gegen diese Gönnerschaften anzukämpfen, sie würden sehr bald mich selber hinwegfegen. Glauben Sie mir, junger Freund, mit den Wölfen muss man heulen, und wer es nicht ertragen kann, Hammer zu sein, der wird sich gar bald als Ambos finden, auf den die anderen loshämmern. Wenn Sie das nicht einsehen, taugen Sie nicht für unsere Verhältnisse, und ich kann Ihnen nur den Rat geben, uns möglichst bald den Rücken zu wenden.“
Ich erklärte dem weltklugen Geschäftsmann, dem ich im Übrigen nicht unrecht geben konnte, er möge es mit der Stelle halten, wie er wolle und könne, ich für meinen Teil verzichte endgültig auf dieselbe. Meinem Mitbewerber erzählte ich draußen, was vorgefallen und händigte ihm eine Summe ein, genügend groß, um ihn und seine Familie für längere Zeit vor Not zu bewahren, gab ihm aber den wohlgemeinten Rat mit auf den Weg, sein Bündel zu schnüren und nach Freiland auszuwandern.
Eine halbe Stunde später hatte ich eine Auseinandersetzung mit dem Vater meiner Verlobten. Ich wollte ihm seine unberufene Einmischung vorhalten; kaum aber hatte er erfahren was geschehen, als er den Spieß umkehrte und mich mit den heftigsten Vorwürfen überschüttete. Ich sei ein durchaus unzurechnungsfähiger, für den „Ernst des Lebens“ schlechthin unbrauchbarer Mensch; längst schon habe er es bereut, seine Einwilligung zur Vermählung seines Kindes mit solchem Faselanten erteilt zu haben; nunmehr aber wäre seine Langmut zu Ende; ich möge mich zum Teufel scheren und meine Menschenfreundlichkeit anderswo an den Mann bringen.
Der Engel, dem ich mich hatte verbinden wollen, war Zeuge dieser Scene. Einen Augenblick lang hoffte ich, die Erwählte meines Herzens für mich Partei nehmen zu sehen. Es geschah nicht; im Gegenteil, sie stand auf Seite des Vaters und versuchte bloß schüchtern, auf mildernde Umstände für mich zu plaidieren. Ich sei noch jung, meinte sie, eine augenblickliche Gefühlswallung habe mich wohl übermannt und man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, dass ich, durch Schaden klug geworden, hinkünftig derlei Torheiten unterlassen würde. Als ich aber erklärte, mit guten Vorbedacht gehandelt zu haben, als ich hinzufügte, ich musste mich verachten, wenn ich jemals anders handeln könnte, da kehrte sie mir geringschätzig den Rücken.
Als sie sah, dass ich mich, ohne Buße zu tun, zum Abschied anschicke, machte sie zwar noch einen Versuch, mich unter Tränen und Beschwörungen festzuhalten. Aber der Kehrreim all ihrer Bitten war immer und immer wieder, ich möge doch endlich ein „vernünftiger Mensch“ werden, aufhören, mich um fremder Leute Angelegenheiten zu kümmern. Der Zauber, der mich an das anmutige Geschöpf bis dahin gebunden, war gründlich zerstört; ich erkannte, dass es eine gemütlose Puppe gewesen, der ich gehuldigt. Was ich anfangs als Opfer meiner Überzeugungstreue angesehen, der Bruch mit ihr, das nahm, je mehr sie sprach und weinte, mehr und mehr die Gestalt einer Belohnung an. Ich sah, meine Handlungsweise hatte mich davor bewahrt, Opfer eines Irrtums zu werden, den ich bei Auswahl meiner zukünftigen Gattin begangen. Das merkte endlich der Gegenstand meiner einstigen Zärtlichkeit selber; ich erhielt unter zornigen Worten meinen Abschied.
So ist das letzte Band, das mich festhielt, gerissen. Meine Angelegenheiten hier werden in wenigen Tagen geordnet sein und dann auf nach Freiland!
Zweites Kapitel
Die Reise
Ich wählte für die Reise nach Freiland ein freiländisches Schiff. Es flößte mir zwar einiges Bedenken ein, das auf den Riesendampfern, welche dieser Staat seit einer Reihe von Jahren zwischen der ostafrikanischen Küste und den Haupthafenplätzen Europas wie Amerikas laufen lässt, keinerlei Klassenunterschiede bestehen, denn da diese Schiffe in der Regel von mehr als tausend Auswanderern benutzt werden, so hegte ich hinsichtlich der Bequemlichkeit dieser gleichförmigen Unterkunft einige Zweifel und ich war einen Augenblick lang versucht, die Seereise mit den französischen Messageries Maritimes oder mit der englischen P. & O. Company zu machen. Indessen, schließlich überwog der Wunsch, das freiländische Wesen so früh als möglich kennen zu lernen, und so meldete ich mich denn bei der nächsten freiländischen Agentur für den am 2. Mai von Triest abgehenden Dampfer „Urania“ an.
Ich hatte diese Wahl nicht zu bereuen. Wir waren unser nicht weniger als 1160 Passagiere, aber die freiländischen Schiffe sind so eingerichtet, dass alle Mitfahrenden in zwar kleinen, aber netten, bequem ausgestatteten Kabinen gesonderte Unterkunft finden. Tagsüber nehmen gewaltige, luftige Speise- und Gesellschaftssäle die Reisenden auf, für die Nacht hat jedermann und jede Familie gesonderte Schlafräume. Da insbesondere während der Fahrt durch das Rote Meer die Hitze mitunter sehr groß ist, so wird durch kräftige Ventilationsapparate, die allen Räumen des Schiffes frische Luft zuführen, für ausreichende Abkühlung gesorgt. Die Verpflegung ist einfach, aber vortrefflich, die Reinlichkeit über jedes Lob erhaben.
Die Erlebnisse der Seefahrt will ich übergehen. Am 8. Mai passierten wir den Suezkanal, am 19. desselben Monats warf die „Urania“ in der Reede von Lamu Anker.
Dieser Ort, noch vor sieben Jahren, als Freiland gegründet wurde, ein unansehnliches Arabernest, ist jetzt eine große, mit allen Behelfen des modernen Verkehrs ausgestattete Handelsstadt. Die Engländer, die hier herrschen, haben die Vorteile, die ihnen das freiländische Hinterland gewährt, trefflich auszunutzen verstanden.
Die Einwanderung nach Freiland, die mit verschwindenden Ausnahmen die Richtung über Lamu und die Tanamündung nimmt, hat im Vorjahre die Ziffer von 500.000 Seelen nahezu erreicht und ist in stetem Wachstum begriffen; der Warenhandel betrug im selben Jahre 92 Millionen Pfund Sterling in der Ausfuhr und ebenso viel in der Einfuhr. Dieser Handel ruht zwar in den Händen des freiländischen Gemeinwesens, aber die Engländer und die ganze Küstenbevölkerung haben selbstverständlich kolossale Vorteile davon, wie sich am rapiden Wachstum Lamus und dem sichtlichen Wohlstand der dortigen Bevölkerung deutlich zeigt.
Der größere Teil von uns Einwanderern stieg in Lamu ans Land, wo große, Freiland gehörige Hotels uns aufnahmen. Bloß ein kleiner Teil, nicht ganz zweihundert, bestiegen sofort in der Reede einen kleinen Dampfer, der, das Vorgebirge von Ras-Schaga umschiffend, durch die Bay von Ungama direkt in die Tanamündung einläuft. Diese direkte Einfahrt in den Strom, der auch uns später als Weg in die neue Heimat diente, ist mitunter, wenn der Wind nicht gerade günstig weht, nicht ungefährlich, denn der Tana bildet an seiner Mündung eine Barre, die früher beinahe ganz unpassierbar war und auch jetzt, nachdem Baggerungen vorgenommen worden sind, der Schifffahrt ernstliche Hindernisse bereitet. Man muss die Brandung passieren, die dabei in recht hässlicher Weise über Deck zu spülen pflegt, wird aus diesem Anlass jedenfalls gehörig hin- und hergeworfen, und das ist, insbesondere wenn man gerade eine siebzehntägige Seereise glücklich hinter sich hat, nicht jedermanns Sache.