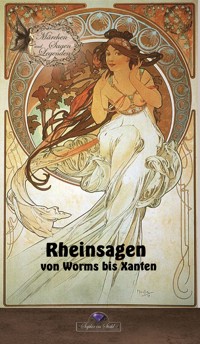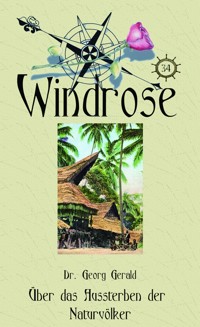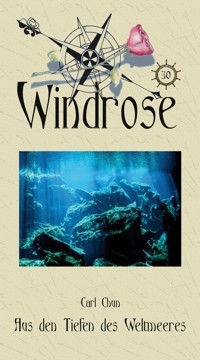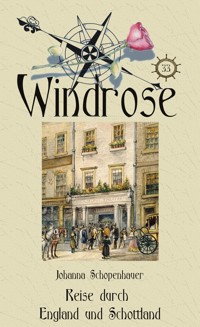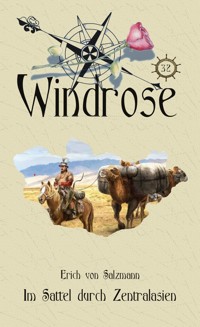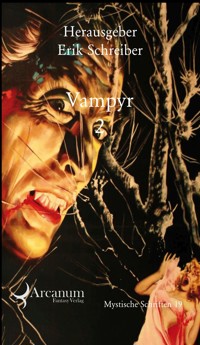
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Märchen Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
Dieses e-book beschreibt Märchen und Sagen aus dem Bereich der Vampire kennen. Gleichzeitig findet sich hier der zweite Teil der Vampyr-Erzählung: Theodor Hildebrandt - Der Vampyr oder: Die Todtenbraut (1828). Diese Sammlung zeigt sehr deutlich, dass die Vampire in anderen Ländern auch ander Gewohnheiten besitzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Der Vampyr
2
Arcanum Fantasy Verlag
Mystische Schriften 19
e-book 321
Theodor Hildebrandt - Der Vampyr oder: Die Todtenbraut (1828)
Vampir-Sagen
Erste Auflage 01.11.2024
© Arcanum Fantasy Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.arcanum-fantasy-verlag.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Vertrieb: neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Der Vampyr
2
Arcanum Fantasy Verlag
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Vampyr, oder: Die Totenbraut. Teil 2
Der Vampyr (Bosnien: Milena Preindlsberger-Mrazovic: Bosnische Volksmärchen)
Das Mädchen und der Vampir (Balkanmärchen aus Bulgarien)
Der Wampyr Griechenland
Vampyrsagen Polen
Der Vampir Rumänien
Der Vampyr Bosnien
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
heute kann ich den zweiten Teil der Erzählung: „Der Vampyr, oder: Die Totenbraut.“ präsentieren. Dank Tim von der „Bücherbar“, der mir den Text zur Verfügung stellte, erscheint heute der zweite Teil und das Ende der Erzählung. Ich bemühe mich immer alle Texte, die bei mir erscheinen vollständig zu veröffentlichen.
Neben dem zweiten Teil erscheinen zusätzlich ein paar weitere Vampirsagen. Damit möchte ich zeigen, dass Vampire durchaus unterschiedlich dargestellt werden. Nicht nur die Blutsauger aus Film und Fernsehen oder den einschlägigen Romanen.
Der Vampyr, oder: Die Totenbraut.
Ein Roman nach neugriechischen Volkssagen.
Von Theodor Hildebrand.
Zweiter Teil.
Leipzig, 1828. bei Christian Ernst Kollmann
Dreizehntes Kapitel
Der Knall der beiden Pistolenschüsse hallte durch das ganze Schloss wider, und verbreitete darin sogleich einen unbeschreiblichen Schrecken. Die Knechte auf der Meierei, von denen einige im Schlosse schliefen, waren nicht zu Bett gegangen, weil sie am andern Morgen Getreide nach Prag fahren sollten, und mit den dazu nötigen Vorbereitungen beschäftigt waren. Sie verbreiteten sich schnell durch mehrere Zimmer, während eines der Mädchen die Haustür öffnete und aus der Nachbarschaft Hilfe herbeirief.
Die Oberstin, welche vor Mattigkeit eingeschlafen war, fuhr schon bei dem ersten Pistolenschüsse empor, hielt ihn aber für ein gewöhnliches Geräusch, das ihr nur im Traume stärker vorgekommen sei. Als jedoch bald darauf der zweite Schuss erschallte, glaubte sie, dass Räuber im Schlosse wären, und dass der brave Werner im Kampfe mit ihnen begriffen sei. Nach diesem ersten Gedanken war der Zweite ihr Sohn. Sie hatte so viel Mut, schnell aufzustehen, und ohne ihre eigene Gefahr zu beachten, eilte sie in das Zimmer, wo der Gegenstand ihrer zärtlichen Sorgfalt ruhte.
Welches schreckliche Schauspiel bot sich ihren Augen dar, als sie, beim Schein des Mondes und einer spärlich brennenden Nachtlampe, zwei blutende Körper auf dem Fußboden ausgestreckt sahe, und in ihnen Werner und die Fremde erkannte. Mit einem Schrei des Entsetzens eilte sie dann nach dem Bette des Kindes, das sie in ihre Arme nahm; aber vergebens suchte sie den kleinen Wilhelm aus dem Schlafe zu wecken, in den er versunken zu sein schien: Sein Leben war entflohen. Diese schmerzliche Gewissheit vollendete Helenns Verzweiflung, und ohnmächtig fiel sie neben den beiden Leichnamen auf den Fußboden nieder.
Kurze Zeit darauf kamen die Knechte und Dienstmädchen ebenfalls in dieses Zimmer des Schreckens. Sie sahen ein Fenster offen stehen, und an demselben eine seidene Strickleiter befestigt; sie fanden Werner und Lodoiska in ihrem Blute gebadet und ohne ein Zeichen des Lebens; weiter hin erblickten sie die Oberstin, welche noch atmete, neben dem Leichnam ihres Kindes. Dieser fürchterliche Anblick musste alle Anwesenden natürlich mit Schauder erfüllen. Die Mörder konnten nicht weit sein; aber vielleicht hatten sie schon mit Hilfe der Strickleiter die Flucht ergriffen; man beeilte sich eines Teils, der Oberstin beizustehen, andern Teils, die schon angefangenen Nachsuchungen im Schlosse fortzusetzen.
Die Anzahl der zur Hilfe herbeieilenden Nachbarn wurde immer größer; aber auch die strengsten Nachforschungen blieben fruchtlos. Im Schlosse selbst fand man keine Spur von den Räubern, und bei der Durchsuchung der ganzen Gegend war man nicht glücklicher.
Gegen Morgen kam Helen wieder zu sich, und der erste Laut, den sie von sich gab, war der Name ihres teuren Kindes. Ach, der arme Wilhelm hörte sie nicht, auch er war ein Opfer dieser schrecklichen Nacht geworden; gerade da seine Genesung sicher zu sein schien, musste er seiner Krankheit erliegen.
Unter diesen Umständen langten noch zwei neue Personen im Schlosse an: nämlich ein Arzt, den man zur Untersuchung der Leichname herbeigerufen hatte, und der Oberst Lobenthal, dem es endlich gelungen war, seinen Schwager mit seiner Schwester auszusöhnen, und der darauf keine Zeit mehr verloren hatte, um in den Armen seiner Familie den Lohn für diese gute tat einzuernten. Wie weit war er entfernt, einen solchen Anblick zu erwarten, wie ihm hier bevorstand. Er hoffte, seine Wiederkehr würde allgemeine Freude im Schlosse verursachen; statt dessen ward er wie vom Blitze getroffen, als ihn der Schulze des Dorfes bei Seite nahm, und ihm die Ereignisse der Nacht auseinandersetzte.
Lobenthal war ein zärtlicher Vater, und er schämte sich nicht, seinem tiefen Schmerz freien Lauf zu lassen; dann verlangte er, seine Frau zu sehen, um seine Tränen mit den ihrigen zu vereinigen. Wir unternehmen es nicht, die Szene ihres schmerzlichen Wiedersehens zu schildern; man hatte Mühe, sie beide von dem Leichnam ihres Kindes loszureißen, den sie durchaus nicht von sich lassen wollten. Der Anblick Juliens, weit entfernt sie zu trösten und zu beruhigen, vermehrte nur noch ihren gerechten Schmerz, und man glaubte daher nichts Besseres tun zu können, als sie sich selbst zu überlassen, und von der Zeit die Milderung ihres Kummers zu erwarten.
Mitten in dem Schmerz, den ihm der Verlust seines Sohnes Wilhelm verursachte, vergaß der Oberst dennoch nicht den Verlust seines treuen Werner. So viel zusammen verlebte Jahre und mit einander bestandene Gefahren, gegenseitig erwiesene Dienstleistungen mussten ein höchst trauriges Andenken im Herzen Alfreds zurücklassen. Er bat den herbeigekommenen Wundarzt, nichts zu vernachlässigen, wodurch der brave Unteroffizier wieder ins Leben zurückgerufen werden könnte; aber es war durchaus keine Hoffnung vorhanden, denn das mörderische Eisen war mitten durch das Herz gegangen. Bei der jungen Dame fand man zwei Wunden, eine im Herzen, durch einen Dolchstoß verursacht, und eine andere in der Brust, wo eine Pistolenkugel hinein und aus dem Rücken wieder herausgefahren war; auch sie konnte nicht wieder leben, und es blieb nichts übrig, als sie und den unglücklichen Werner zu beerdigen.
Lobenthal, in der höchsten Betrübnis, verlangte nicht danach, die Leichname zu sehen. Er kehrte in das Zimmer seiner Gattin zurück, und wünschte bloß, dass Wilhelms Leichnam, der keines gewaltsamen Todes gestorben zu sein schien, bis zum folgenden Tage erhalten würde. Die beiden andern sollten Nachmittags um vier Uhr begraben werden, weßhalb Werner in seinem Zimmer, Lodoiska aber in einem Saale des untern Geschosses auf eine Bahre gelegt wurde.
Schon war der Prediger des Dorfes in seinem Ornate, und die Glocken der Kirche stimmten das Grabgeläute an, als plötzlich finstere Gewitterwolken den Himmel überzogen. Ein Donnerschlag folgte auf den andern, in Strömen floß der Regen herab, und fürchterlich kämpften zwei Sturmwinde in entgegengesetzter Richtung mit einander; ganze Säulen von Blättern, Korngarben, Staub und selbst von schwereren Gegenständen wurden durch die Luft mit fortgeführt; ja es schien, als wenn der Untergang der Welt ganz nahe bevorstände.
Mitten unter dem Heulen und Brüllen der Elemente glaubten mehrere Einwohner des Dorfes fürchterlich rauhe Stimmen zu vernehmen, und es schien ihnen, als wenn die ganze Atmosphäre mit bösen Geistern erfüllt wäre. Erst spät in der Nacht stillte sich der Aufruhr, in welchem sich die ganze Natur befand. Bis dahin war es unmöglich gewesen, an die Bestattung der beiden Leichen zu denken; man musste dieses Geschäft also bis auf den folgenden Tag verschieben, und dies war für die Bewohner des Schlosses kein geringer Gegenstand der Angst. Nur die Oberstin bekümmerte sich nicht darum; sie dachte nichts, als ihren Sohn, den sie nun nicht mehr sehen sollte, und sie schien nur deshalb noch zu leben, weil sie hoffte, bald mit dem armen Wilhelm wieder vereinigt zu werden. Alfred war gezwungen, seinen eigenen Kummer zu vergessen, um zu versuchen, ob er den ihrigen nicht lindern könne; aber vergebens: sie hörte ihn, und verstand ihn nicht, vor ihrer Seele stand nur ihr Sohn, der ihr auf ewig entrissen war.
Schon seit langer Zeit deckte tiefe, finstere Nacht den Erdball. Mehrere Bauern aus dem Dorfe, welche bei den toten wachen sollten, hatten sich in der Küche des Schlosses versammelt, wo sie bei gutem Essen und Trinken lustig und guter Dinge waren; Branntwein und Bier gingen in Flaschen und Krügen der Reihe nach herum, und man trank fleißig auf das Wohl der ehrenwerten Gesellschaft. Die fröhliche Unterhaltung stockte niemals; jedoch kam man mehrmals auf die Ereignisse der vergangenen Nacht zurück.
„Da sieht man, sagte Lisette, wie leicht es um uns Menschen geschehen ist! Wie gesund war der arme Werner noch gestern, und heute liegt er tot im Sarge.“
„Und von seiner Seele sprichst du nicht?“, sagte ein altes Weib, dessen verdächtiger Blick die Knaben und Mädchen des Dorfes in Schrecken setzte, wenn er auf ihnen ruhte; „denkst du denn, dass seine Seele jetzt in Ruhe ist? Ist er nicht ohne Abendmahl gestorben, und wird uns sein Geist in Ruhe lassen?“
„dass doch die Mutter Rieben“, sagte ein Bauerknecht, „keine Gelegenheit vorbeigehen lassen kann, unsere Fröhlichkeit zu stören, und uns in Angst zu setzen. Warum sollte der brave Werner, der uns im Leben nichts als Gutes getan hat, uns jetzt, nach seinem Tode, quälen?“
„Hat er seine Sünden bereut?“
„Wisst ihr es? Hat er euch das Gegenteil anvertraut? Übrigens hat er alle seine Pflichten erfüllt, und er war jeden Sonntag in der Kirche.“
„Aber die junge Dame, Niklas, wie mag es mit der gewesen sein? Haben wir sie je in der Kirche gesehen? Diese ist gewiss mitten in ihren Sünden gestorben, gerade als sie vielleicht noch auf ein langes Leben hoffte.“
„Wir wollen auf ihre Gesundheit trinken!“, sagte ein Müllerbursche, dessen riesenmäßige Größe und außerordentliche Stärke allgemein bewundert wurden. „Möge es ihr im Grabe gefallen, damit sie nicht wieder daraus hervorkomme.“
Bei diesen Worten hörte jedermann einen halb erstickten Seufzer. Überrascht stand fast die ganze Gesellschaft auf, und auf den meisten Gesichtern sah man alle Zeichen des Schreckens. Auch der Müllerbursche war eben nicht der Mutigste. Jetzt schlug es zwölf Uhr, und schweigend hörte man dem Schall der Glocke zu.
„Wer mag so geseufzt haben?“, fragte endlich einer aus der Gesellschaft.
„Vielleicht die junge Dame“, erwiderte die Alte; „sie hat dem Mehlwurm dort ihren Dank für seinen Wunsch abstatten wollen.“
„Lasst Eure dummen Scherze, Mutter Rieben“, sagte der Müllerbursche. „Wir wollen uns weiter um das, was geschehen ist, nicht bekümmern.“
Ein zweiter lauterer Seufzer schallte jetzt in die Ohren der ganzen Gesellschaft, die verwirrt und mit Ausrufungen des Schreckens durcheinanderstürzte.
„Heiliger Gott!“, sagte Lisette, das kommt aus dem Zimmer, wo die junge Dame liegt. Wer hat nun Mut genug, sich davon zu überzeugen?“
Keiner der Anwesenden gab eine Antwort, als sich die Stimme zum dritten Male hören ließ, und zwar so deutlich, dass gar kein Zweifel daran mehr stattfinden konnte. Jetzt jagte die Furcht die ganze Gesellschaft auseinander, und mehrere eilten zum Schlosse hinaus, während Andere den Wundarzt weckten, der die Oberstin nicht eher hatte verlassen wollen, bevor sie nicht ruhiger geworden wäre. Als dieser hörte, wovon die Rede sei, schob er anfangs die Schuld des allgemeinen Schreckens auf ihre furchtsame Einbildungskraft; bei den wiederholten Versicherungen, dass man sich nicht getäuscht habe, zögerte er jedoch nicht, in das Zimmer hinunterzugehen, aus welchem die Stimme hergekommen sein sollte. Der Oberst, welcher noch nicht schlief und den ungewöhnlichen Lärmen im Schlosse hörte, kam ebenfalls herbei; er begegnete auf der Treppe dem Arzt, der ihm unterwegs die Ursache des allgemeinen Schreckens mitteilte.
Beide zweifelten nicht, dass das Pfeifen und Sausen des Windes von den abergläubischen Dorfleuten für die angeblichen Totenseufzer gehalten worden wäre; sie setzten jedoch ihren Weg fort, und von der Menge gefolgt, gelangten sie in das von mehreren Lampen erleuchtete Zimmer, wo der Leichnam der Fremden niedergesetzt worden war.
Indem sie durch die Tür traten, wurde abermals ein Seufzer hörbar, und man konnte nun nicht mehr zweifeln, dass er von dem Sarge herkäme. Ein Teil des Gefolges nahm die Flucht, und nur die Mutigsten blieben zurück, als sie den Obersten und den Arzt zu gleicher Zeit ausrufen hörten: „Sie lebt noch, die Unglückliche! Ach, retten wir sie aus ihrer schrecklichen Lage!“
Sie eilten nun auf den Sarg zu, in welchem Lodoiska ruhte, hoben Letztere sanft in die Höhe, und trugen sie in das Zimmer, welches sie früher bewohnt hatte. Als der Arzt seine Hand auf ihr Herz legte, fühlte er, dass es wieder angefangen hatte, obgleich noch sehr schwach, zu schlagen, und voll Erstaunen über dieses außerordentliche Wunder, nahm er sich vor, alles anzuwenden, um diese von den toten Auferstandene wieder völlig herzustellen. Er bat den Obersten, den Teil des Leichentuches, womit der Kopf der jungen Schönheit verhüllt war, zurückzuschieben. Lobenthal tat es, und betrachtete neugierig die Züge der Fremden; aber wie erstaunte er, als dieses reizende Gesicht ihn überzeugte, dass er die unglückliche, leidenschaftlich liebende Lodoiska in seinen Armen hielt. Ein lauter Schrei entfuhr seinen Lippen. Einem ruhigen Zuschauer würde dadurch ohne Zweifel die Wahrheit offenbar geworden sein; aber der Arzt, ganz in seine Gedanken über diese außerordentliche Wiederbelebung vertieft, merkte kaum darauf, und von nun an suchte der Oberst seine inneren Gefühle sorgfältig zu unterdrücken.
Der Arzt forderte nun die bis hierher gefolgten Landleute auf, das Zimmer zu verlassen, und wollte mit dem weiblichen Personale, das allmählich wieder mutiger geworden war, allein bei der jungen Dame bleiben. Auch der Oberst entfernte sich, forderte aber vorher den Arzt auf, seine ganze Kunst zur Genesung der Unglücklichen anzuwenden.
„Fürchten Sie nichts, Herr Oberst, erwiderte der Arzt; mir ist selbst daran gelegen, diese wunderbare Kur zum gewünschten Ziele zu führen. Vielleicht kann die Kunst etwas dabei tun; aber glauben Sie mir, das Meiste dabei wird die Natur tun müssen; nur sie allein kann eine so wunderbare Wiederbelebung bewirken. Ich würde einen Eid darauf abgelegt haben, dass die Pistolenkugel diese junge Dame augenblicklich getötet hat, und sollte sie wirklich völlig wieder zum Leben zurückkehren, so muss unsere Kunst verzweifeln, je eine gründliche Ursache dieser Auferstehung angeben zu können.“
Langsamen Schritts entfernte sich nun der Oberst, ohne selbst zu wissen, womit seine Gedanken beschäftigt waren. Er kehrte zu seiner Frau zurück, die in einen mehr ermattenden als erquickenden Schlummer gefallen war. Wie schmerzlich sollte ihr Erwachen sein! Welche neue Trauer musste die Nachricht von der Wiederbelebung der Fremden in ihrem Herzen verursachen, da für ihren geliebten Wilhelm nicht ein ähnliches Wunderwerk geschehen war.
Vierzehntes Kapitel
Unter allen Begebenheiten, welche je das Leben des Obersten Lobenthal beunruhigt haben mochten, war ohne Zweifel die Erscheinung der jungen Lodoiska in Deutschland diejenige, welche ihn am meisten überraschen musste. Ihr energischer Charakter, den er so schlecht beurteilt hatte, ihre leidenschaftliche Liebe, wovon sie ihm durch ihre Gegenwart den auffallendsten Beweis gab, mussten in seinem Herzen Gefühle erregen, von denen er sich selbst noch nicht Rechenschaft zu geben wagte. Nicht allein, um ihm seine Treulosigkeit vorzuwerfen, konnte sie einen so weiten Weg aus ihrem Vaterlande her zurückgelegt haben; ohne Zweifel musste sie mehr haben wollen, und er zitterte, wenn er an die bevorstehenden Auftritte dachte. Von der andern Seite, durch einen seltsamen, aber so gewöhnlichen Widerspruch in dem menschlichen Herzen, fürchtete er, dem es sehr lieb gewesen sein würde, dieses Mädchen nie wieder zu sehen, dass er sie jetzt auf immer verlieren könnte, und er hätte einen großen Teil seines Vermögens hingegeben, wenn er dadurch die Gewissheit ihrer Wiederherstellung erhalten konnte. Er wünschte, wenigstens nur ein einziges Mal mit ihr zu sprechen, sagte er zu sich selbst; er wollte aus ihrem eigenen Munde hören, wie sie es angefangen habe, um bis nach Regensburg zu gelangen. So verbarg der Oberst vor sich selbst das Wiedererwachen einer höchst gefährlichen Empfindung unter dem Namen einer bloßen Neugierde; aber während er sich mit allen diesen Dingen beschäftigte, nahm er sich vor, sie tief in seinen Busen zu begraben, und nie den geringsten Anlass zu geben, wodurch Helen zur Eifersucht verleitet werden könnte. Er beschloss, sich gegen Lodoiska wie gegen eine ihm völlig Unbekannte zu benehmen, wenn sie selbst ihn nicht durch eine Unvorsichtigkeit zur Entdeckung seines Geheimnisses zwingen würde.
Durch die Sorgfalt eines dienstfertigen Nachbars und des gefühlvollen Pfarrers war die Veranstaltung getroffen worden, dass am andern Morgen schon ganz frühe, ohne alles Geräusch, die Leichname des jungen Wilhelms und Werners aus dem Schlosse entfernt und zur Erde bestattet wurden. Als daher Helen ihren Sohn noch einmal sehen wollte, geriet sie in neue Verzweiflung, dass ihr nun von ihrem Wilhelm nichts mehr übrig geblieben sei, als eine herzzerreißende Erinnerung. Beschäftigt, diesen heftigen Schmerz seiner Gattin, den er selbst teilte, durch Trostgründe zu mildern, vergaß der Oberst fast, wie nahe ihm jetzt Lodoiska sei, und erst gegen Mittag, als Wildenau, der Arzt, zu ihm kam, dachte er daran, sich nach ihrem Zustande zu erkundigen.
„Ich habe Ihnen schon gesagt, antwortete Wildenau, dass bei dieser jungen Person etwas Unerklärliches obwaltet, was ich vergebens zu ergründen suche. Noch nie war die Rückkehr ins Leben so unverhofft, als bei ihr; doch kann ich noch nicht versichern, ob sie am Leben bleiben wird, oder nicht. Ihre Wunde war ohne Zweifel tödlich, und schon vorher musste eine andere, die bis ins Herz gegangen zu sein scheint, ihrem Dasein ein Ende gemacht haben.“
„Eine andere Wunde, sagen Sie? Lieber Doktor, Sie setzen mich in Erstaunen, denn mich dünkt, als hörte ich gestern bei meiner Ankunft nur von einer einzigen, durch einen Pistolenschuss verursachten Wunde sprechen.“
„Ganz richtig, weil nur diese Wunde frisch war, und die andere schon vor langer Zeit durch ein schneidendes Werkzeug gemacht worden ist. Weit entfernt, völlig vernarbt zu sein, blutet sie vielmehr noch, und hat eine ganz eigentümliche Beschaffenheit, die meine bisherigen Kenntnisse völlig zu Schanden macht. Bei jedem andern Menschen musste sie unmittelbar den Tod nach sich ziehen, und dennoch scheint es, dass diese Dame schon lange Zeit damit gelebt hat, ohne davon gehindert worden zu sein. Wahrlich! Sie hat sich über die wunderbare Lebenskraft, die ihr von der Natur zugeteilt ist, nicht zu beklagen. Außerdem habe ich noch eine andere Sonderbarkeit bei ihr gefunden: Ihre linke Hand ist nämlich mit einem Handschuh bedeckt, der aus einer sehr dicken Haut besteht. Ich wollte ihn aufschneiden, um der Kranken völlige Freiheit der Bewegung zu verschaffen; aber als ich ihren Arm berührte, geriet er in ein beispielloses krampfhaftes Zittern, und die anfangs offene Hand Schloss sich mit solcher Kraft, dass ich nicht im Stande war, mein Vorhaben auszuführen.“
„Wunderbar! Erstaunenswürdig! Aber lassen Sie nicht ab, lieber Doktor, ich bitte Sie: Die Menschlichkeit befiehlt uns, dieser Unglücklichen uns nach Kräften anzunehmen. Übrigens kann sie allein uns die Begebenheiten der gestrigen Schreckensnacht erklären, und vielleicht erteilt sie uns Aufschlüsse, die uns in den Stand setzen, jene Bösewichter zu entdecken, deren Versuch ohne Nutzen für sie, für uns so unglücklich ausgefallen ist.“
„Ihre Ermahnungen sind ganz überflüssig, Herr Oberst. Meiner Pflicht nicht zu erwähnen, deren Erfüllung mir mein Stand vorschreibt, so kann ich Ihnen nicht verbergen, dass diese junge Dame mir die lebhafteste Teilnahme eingeflößt hat. Die seltene Vollkommenheit in allen Teilen ihres Körpers, die Schönheit ihres Gesichts haben, ich gestehe es Ihnen errötend, auf meine Sinne einen außerordentlichen Eindruck gemacht. Wenn ich sie dem Leben wiedergeben könnte, wünschte ich mehr von ihr zu erlangen, als bloße Dankbarkeit ... Aber warum erstaunen Sie so über dieses Geständnis? Sollte es Ihnen verdammungswürdig erscheinen?“
„Wem? Mir? Ei, lieber Doktor, mit welchem Rechte könnte ich es tadeln? Es scheint mir nur, dass Alles, was jetzt hier um uns vorgeht, außerordentlich ist. Sie, zum Beispiel, lieben heute eine Person, die Sie gestern noch nicht kannten, und zwar hat sie Ihr Herz in dem Augenblick erobert, wo sie noch mehr dem Tode als dem Leben angehört. Wie wird es erst werden, wenn sie mit ihren körperlichen Vorzügen noch die weit hinreißenderen des Geistes verbindet, die ihr ohne Zweifel nicht mangeln!“
„Verzeihen Sie, Herr Oberst, wenn ich Ihnen gerade heraus sage, dass Sie ziemlich leicht über einen solchen Punkt sprechen. Ich kannte diese Lustigkeit an Ihnen noch nicht.“
„Ach, nehmen Sie es nicht übel, lieber Herr Doktor; in meiner jetzigen Stimmung weiß ich kaum, was ich thue; so sehr hat mich der Schmerz übermannt, dass meine Worte der Zerrüttung meines Verstandes entsprechen. In meiner Lage, deren ganze Qual Sie nicht zu würdigen im Stande sind, mag es wohl erlaubt sein, gegen die Regeln der Höflichkeit zu fehlen, wie es wohl sonst bei mir nicht der Fall ist.“