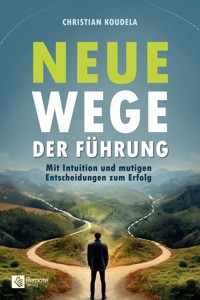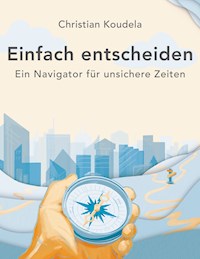
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sie sind vorbei, die Zeiten in denen wir auf Basis unserer Erfahrungen der Vergangenheit über Jahre in die Zukunft planen und entscheiden können. Laufende Veränderungen in unserem Umfeld machen dies mehr und mehr unmöglich. Allerdings sind gute und schnelle Entscheidungen wichtig für erfolgreiche Unternehmen und Führungskräfte. Denn nur so können sie in einem herausforderndem Umfeld rasch und flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Dieses Buch zeigt Ihnen, was gute Entscheidungen sind, wie diese funktionieren und wie Sie auch in turbulenten Zeiten als Entscheider sicher am Steuer Ihres Lebens bleiben. Christian Koudela berät Unternehmen zum Thema "Entscheiden in unsicheren Zeiten" und gibt Ihnen in diesem Buch anhand vieler Beispiele tiefe Einblicke, wie sie zu guten Entscheidungen kommen. Denn gute Entscheidungen haben einen wesentlichen Anteil am Erfolg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.
J. K. Rowling
Vorwort
Unsere Art in Unternehmen zu entscheiden wurde geprägt von planbaren Horizonten, einer stabilen Zukunft und Routinen, die sich über Jahre bewährt haben.
Doch der Wandel rast mit turboschnellen Fortschritten in Technologien, Umwelt und Arbeitswelten voran. Was morgen passiert, lässt sich immer schlechter vorhersagen. Im Schlepptau: Unsicherheit. Zusammenhänge und die Datenlage sind undeutlich, Informationen und Konditionen ändern sich stündlich und Risiken schnellen in unerwartete Höhen.
Mit den rapiden Veränderungen werden auch Entscheidungsprozesse komplexer. Doch die Techniken, die wir bisher dafür benutzt haben, sind zu behäbig, um das Tempo anpassen und sicher agieren zu können. Das ist wie eine Fahrt in einem alten porösen Schlauchboot, mit dem wir auf einem reißenden Fluss umherpaddeln. Wir wissen nicht, was hinter der nächsten Biegung auf uns wartet – das sichere Ufer? Hungrige Piranhas, nachdem wir gekentert sind? Oder ein tiefer Wasserfall?
Wollen wir mit Entscheidungen zukünftig auch in unsicheren Gefilden auf Erfolgskurs bleiben, brauchen wir zuverlässige Navigationsinstrumente, die wir rasch anpassen und justieren können. Die das Bewährte und die schnellen Veränderungen von heute in die Kalkulation einbeziehen und uns so zu sicheren Entscheidungen führen.
Mit ‚Einfach entscheiden. Ein Navigator für unsichere Zeiten.‘ halten Sie ein praxisnahes Handbuch zum Thema Entscheiden in Organisationen in Händen, das Ihnen neue Sichtweisen auf bewährte Strategien und Techniken liefert. Mit der Erfahrung aus einer Vielzahl von Workshops und Entscheidungscoachings bekommen Sie griffige Werkzeuge, aufgemischt mit Beispielen aus der Praxis – fertig zum Ausprobieren und Umsetzen.
Dabei helfen Arbeitsblätter und Templates, die Sie kostenlos unter folgendem Link herunterladen können:
https://entscheidungsnavigator.com/einfach-entscheiden
Entscheidungsnavigator. Berater. Trainer.
Zuvor: Lernarchitekt und Wissensmanager. Projektleiter
Immer: Lesen, Lernen, Lachen
Agile Coach. Visualisierungsjunkie. Facilitator. Trainerin. Kreativkopf.
Zuvor: Beraterin und Startup-Energiebündel.
Immer: Bereit fürs nächste Abenteuer.
Inhaltsverzeichnis
Es wird einmal
1.1 Die VUCA-Welt
1.2 Digitalisierung
1.3 Was geht in den Organisationen vor?
1.4 Bisherige Ausbildung
Aller Anfang ist entscheidend
2.1 Unterscheiden versus Entscheiden
2.2 Entscheiden versus Entscheidung
2.3 Theorien – Die ‚Schulen‘ im Entscheiden
2.4 Unsicherheit ist nötig für Entscheidungen
2.5 Entscheiden im Rahmen der Möglichkeiten
2.6 Von der Analyse zur Intuition
Was sind eigentlich gute Entscheidungen?
3.1 Qualität von rationalen Entscheidungen
Struktur hilft
4.1 FORDEC
Es beginnt bei mir
5.1 Das KAIROS-Entscheiderprofil
5.2 Die passenden Strategien
5.3 Die Angst vor Verlusten
Das Wesen der Unvollständigkeit
6.1 Die Heimat von Entscheidungen (Lebensraum von Entscheidungen)
6.2 Wie können uns diese Heimaten beim Entscheiden helfen?
6.3 Der Effectuation-Ansatz
6.4 Es kommt auf das Umfeld an
Es geht auch spielerisch
7.1 Das Gleichgewicht finden
7.2 Das Prisoners Dilemma
7.3 Was wird hier gespielt?
Gemeinsam geht vieles leichter
8.1 Vom Entweder-oder zum Sowohl-als-auch
8.2 Die sieben Stufen beim gemeinsamen Entscheiden
8.3 Die Rolle der Mit-Entscheider
8.4 Wie wir gemeinsam entscheiden
Die Analyse der Täuschung
9.1 Die Gestalt der Täuschung
9.2 Zu viel (neue) Information
9.3 Welche Bedeutung geben wir Informationen
9.4 Wenn es schnell gehen soll
9.5 Woran sollten wir uns erinnern
Entscheidungstechniken für Praktiker
10.1 Rationale Techniken
10.2 Entscheidungsregeln unter Unsicherheit
10.3 Intuitive Techniken
10.4 Kreative und innovative Techniken
Das Entscheidende ist doch …
11.1 Die Einweg-Tür
11.2 Die Zweiweg-Tür
11.3 Ein Ausblick: Entscheiden und künstliche Intelligenz
1 Es wird einmal
"Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt, der sich erinnert."
Mit diesen Worten beginnt eine der größten Geschichten, die jemals die geschrieben wurde: Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Auch wenn dieses Buch keine epischen Ausmaße annehmen wird, so finde ich diese Zeilen treffender denn je. Wir schreiben das Jahr 2021 und die Corona-Pandemie hat die Welt nach wie vor im Griff. Noch vor einem Jahr konnten sich Unternehmen nicht vorstellen, dass Home-Office in diesem Ausmaß möglich sein könnte. Ein paar Monate später arbeiten viele Menschen von zu Hause und Home-Office ist gelebte Praxis, und zwar flächendeckend. Der Bitcoin jagt von einem Rekordhoch zum nächsten und lockt als Alternative zu Gold und Fiat-Geld. 5G, die neue Mobilfunktechnologie steht in den Startlöchern und verspricht die Kommunikation zu revolutionieren ... Die Welt ist im Wandel. Wir spüren es an der Technologie. Wir spüren es in der Umwelt, wir spüren es in der Gemeinschaft. Die Veränderungen wirken auf Menschen und Organisationen und betreffen somit die gesamte Gesellschaft. Schnelllebigkeit, Fortschritt und Transformation sind uns ein steter Begleiter geworden. Welche Eigenschaften hat eine Welt, die sich immer schneller verändert? Wie lassen sich diese Prozesse beschreiben und erfassen?
1.1 Die VUCA-Welt
Bereits vor mehr als 30 Jahren, im Jahr 1987, entwickelten die beiden US-Forscher Warren Bennis und Burt Nanus den Begriff ‚VUCA‘. Wenig später übernahm das US-Army War College dieses Akronym, um Anfang der 90er Jahre den Wechsel vom am Kalten Krieg zum Spiel der freien Mächte zu beschreiben. Während der Zeit des Kalten Krieges waren die Regeln klar: Es gab zwei Großmächte, die USA und Russland, die sich gegenseitig in Schach hielten. So bedrohlich diese Situation war, so stabil war sie zugleich. Niemand wollte ‚auf den Knopf drücken‘, denn jeder wusste, das würde Konsequenzen für ihn selbst haben und dem eigenen Land enorm schaden. Die Verhältnisse waren überaus kraftvoll, aber ausbalanciert. Mit dem Ende des Kalten Krieges stand die Frage im Raum, wie es nun weiter gehen würde. Und genau zu dieser Zeit hat das US-Army War College das Akronym VUCA der beiden Forscher übernommen.
VUCA steht für:
Volatilität
Volatilität beschreibt die Dynamik des Wandels, die Geschwindigkeit, mit der Änderungen vonstattengehen. Wir leben in einer Welt, die stets in Bewegung ist und sich laufend verändert, in der große oder vermeintlich kleine Auslöser unvorhersehbare Folgen haben. Der weitere Verlauf entwickelt sich völlig unerwartet und somit unvorhersagbar. Das Erkennen ursächlicher Zusammenhänge ist aufgrund der raschen Veränderung schwierig. Teilweise sind es sehr kleine Auslöser und Geschehnisse - aktuell ein Virus - die enorme Veränderungen angestoßen haben.
Unsicherheit
Unsicherheit bezieht sich auf die Frage, die am Ende des Kalten Krieges entstand, wie es denn weiter gehen sollte. Wir wissen nicht, was im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten passieren wird. Die Vorhersehbarkeit von Ereignissen nimmt rapide ab, und der Blick in die Vergangenheit als Grundlage für die Gestaltung der Zukunft verliert an Gültigkeit. Wir haben Ideen, wir haben vielleicht Ahnungen, aber eine echte Sicherheit gibt es nicht (mehr). Langfristige Planung wird zu einer großen Herausforderung, denn die Richtung, wohin die Reise gehen soll, lässt sich nicht eindeutig definieren.
Komplexität
Im Kalten Krieg gab es lediglich zwei Großmächte. Nach dessen Ende brachten sich weitere Mitspieler in Stellung. Es waren nun mehr Spieler mit unterschiedlichen Interessen auf dem Feld, die miteinander zu interagieren begannen. Der Begriff der Globalisierung versucht, diese starke Vernetzung und das Entstehen der Abhängigkeiten zu erfassen. Heute ist unsere Welt komplexer denn je – Probleme und deren Auswirkungen sind vielschichtig. Unterschiedliche Ebenen vermischen sich und machen Zusammenhänge unübersichtlich. Reaktionen und Gegenreaktionen sind ein stark verwobenes Konstrukt. Das macht es immer schwieriger zu durchschauen, wie die Dinge miteinander vernetzt sind. Infolge kann leicht das Gefühl entstehen, den Überblick zu verlieren, und es besteht die Gefahr, in ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit abzurutschen.
Ambiguität
Ambiguität beschreibt die Mehrdeutigkeit. Es sind mehrere Varianten möglich – und nicht nur möglich, sondern auch richtig. Wir haben nicht mehr die eine Zukunft, die planend vorherzusagen ist, sondern mehrere Möglichkeiten der Zukunft, die gleichermaßen wahr und falsch sein können. Das klassische Schwarz/Weiß-Denken, richtig oder falsch, ja oder nein, gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Das Spektrum ist viel größer geworden. Aus Schwarz/Weiß ist eine vielfältige Farbpalette geworden, die damit neue Varianten ermöglicht. Auch Moralvorstellungen weichen sich auf. Jedoch nicht im Sinne von, sie werden weniger oder schlechter, sondern sie werden vielfältiger. Es gibt mehr richtige, genauer gesagt, passende Antworten auf unterschiedliche Fragen.
Kurz nach der Jahrtausendwende kam der Begriff VUCA in den Organisationen an. Diese erkannten, hoppla, da draußen tut sich etwas. Abhängig davon, wie diese Organisationen aufgestellt waren, spürten sie die gesellschaftlichen Veränderungen mehr oder weniger stark und mehr oder weniger direkt. Im Kontext der Organisationen entwickelten sich daraus unterschiedliche Reaktionen und Antworten.
Eine aus meiner Sicht sehr hilfreiche ist die Folgende:
Der Volatilität müssen wir mit einer klaren Vision begegnen. Wenn wir wissen, wo es hingehen soll, wenn wir diese Idee vor Augen haben, können wir die "Störfeuer", die durch diesen Wandel auflodern, ein Stück weit löschen. Mit diesem Bild vor Augen können wir mit ruhiger Hand Kurs halten. Mögliche Veränderungen und Abweichungen lassen sich mit laufenden Korrekturen ausgleichen und uns so unserer Vision näherkommen.
Der Uncertainty, der Unsicherheit, können wir mit Understanding, also mit Verstehen begegnen. Hier ist es wichtig, das Umfeld und die Geschehnisse zu verstehen, um aus diesem Schwarz/Weiß-Denken herauszukommen. Das Ziel ist eine breite Farbskala, aus deren Vielfältigkeit sich die Möglichkeit ergibt, unterschiedliche Lösungen zu entwickeln. Denn erst wenn wir die Situation erfassen und verstehen können, lassen sich gute Optionen entwickeln.
Im Sinne der Komplexität hilft Klarheit, wobei der Begriff bisweilen missverstanden wird. Hier geht es nicht darum, die Dinge einfacher zu machen. Es geht um die Klarheit in der eigenen Kommunikation, um Transparenz und darum, die Klarheit über die Zusammenhänge zu erlangen.
Ambiguität kann mit Agilität begegnet werden. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, über die gesamte Organisation hinweg schnell Lösungen anzuwenden. Um langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können, erfordert die Agilität ein hohes Maß an Entscheidungs- und Handlungsschnelligkeit. Dabei geht es nicht um die Einführung von agilen Frameworks wie SCRUM oder SAFe an sich, um einem Trend zu folgen und agil zu sein. Vielmehr geht es darum, die Organisation dahingehend auszurichten, schneller auf Veränderungen oder auf feine Nuancen im Markt und auf Kundenwünsche reagieren zu können.
Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 begannen viele Entscheider umzudenken und zu verstehen, dass Vorhersagbarkeit und Planbarkeit nicht mehr so gegeben sind, wie wir sie von früher kennen. VUCA ist in vielen Organisationen angekommen – als Begriff, um die aktuelle Welt, die ‚VUCA-Welt‘, zu beschreiben, aber vor allem um mögliche Antworten zu finden, wie wir in dieser Welt überleben können.
1.2 Digitalisierung
Digitalisierung im Sinne des technologischen Wandels ist ein Beschleuniger der Veränderung. Hier hilft die Frage, was im Bereich der Digitalisierung geschieht, um wie mit einer Brille auf das Umfeld, den Kontext zu schauen. An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen einen kleinen Exkurs in Richtung Digitalisierung machen und beispielhaft vier große Treiber vorstellen:
Zugänglichkeit
Der erste große Punkt ist die Zugänglichkeit. Durch die flächendeckende Anbindung haben wir nahezu von überall auf der Welt Zugang zum World Wide Web, zu Datenbanken, zu enormem Wissen. Wir können jederzeit auf so gut wie alle Informationen zugreifen und bekommen diese zudem mittels Push-Nachrichten, E-Mails, Foren und anderer Kanäle direkt zugestellt. Wir haben Zugang zu unglaublich vielen Daten. Was das wiederum mit uns macht, schauen wir uns etwas später im Text an.
Geschwindigkeit
Durch die Geschwindigkeit, mit der uns die Informationen durch Technologien wie Glasfasernetzwerke oder 5G erreichen, nehmen wir diese quasi in Echtzeit auf. Wir können uns jederzeit über das aktuelle weltweite Wetter, über die neuesten Aktienkurse, die Entwicklungen im Gesundheitssektor und vieles mehr informieren.
In Kombination mit der Zugänglichkeit haben wir in Echtzeit Zugriff auf eine unvorstellbare Menge an Informationen. Und genau dieser Umstand beeinflusst unser Entscheidungsverhalten massiv.
Partizipation und Glaubwürdigkeit
Technologie und Zugänglichkeit im Rahmen der Digitalisierung machen es möglich, dass wir ‚mitspielen‘ können. Ich als Christian habe zahllose Möglichkeiten, mich öffentlich zu äußern: Ich kann mich in Foren an Diskussionen beteiligen, kann Informationen auf News-Seiten kommentieren, einen eigenen Blog erstellen und vieles mehr. Damit dreht sich das traditionelle Modell der Informationshoheit, die redaktionelle Inhalte ausspielt. Früher gab es eine Enzyklopädie des Wissens, die guten alten Lexika-Bände: zwei Meter Wissen, in Regale verstaut und dort dem Verstauben überlassen. Durch die Partizipation schreibe ich auf einmal selbst, teile Inhalte und trage dazu bei, dass Wissen wächst.
Das ist gut, gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Qualität der Inhalte und deren Glaubwürdigkeit. Wenn ich beispielsweise verreisen möchte und mir im Internet ein Hotel suche, lese ich die Bewertungen anderer Gäste. Dabei ist es wichtig, zugleich objektiv zu bleiben, sich zu fragen, ist diese Bewertung möglicherweise gekauft oder will sich da jemand rächen. Ich muss einen Filter nutzen und die Glaubwürdigkeit dieser Bewertungen und Kommentare infrage stellen. Insgesamt haben wir viel mehr Informationen als früher noch schneller zur Verfügung. Und weil wir diese selbst mitgestalten, müssen wir auch laufend hinterfragen: Was stimmt jetzt? Bei unterschiedlichen Angaben: Was gilt? Das heißt, unser Blick auf die Welt und das, was wir von der Welt sehen, ist in hohem Maße herausfordernder geworden. Die Treiber der Digitalisierung haben einen hohen Anteil an dem, WAS sich in der Welt ändert und WIE sich die Welt verändert.
Und das sind jene Faktoren, die sich im äußeren Umfeld von Organisationen wandeln. Auch innerhalb der Organisationen gibt es starke Veränderungen hinsichtlich der Art und Weise, wie man damit umgeht.
1.3 Was geht in den Organisationen vor?
Etwas überspitzt formuliert, gab es früher einen Meister, der seine Lehrlinge unterwies. Oder in den alten Stammesgesellschaften gab es einen Anführer, dessen Anweisungen nicht infrage gestellt wurden. Aus organisatorischer Sicht lässt sich das gut übertragen: Es handelt sich um kleine Organisationen mit einer klaren Führung. Im Laufe der Zeit sind die Gesellschaften so stark gewachsen, dass sie von einer Person an der Spitze allein nicht mehr überschaut werden konnten. Es entwickelten sich erste hierarchische Strukturen mit Führungskräften, die ihre Bereiche leiteten. Weiteres Wachstum machte dann weitere Führungsebenen erforderlich. Bis zur Jahrtausendwende herrschte ein starker Trend zu diesen hierarchischen Organisationsformen vor.
Die Gesellschaft außerhalb der Organisationen veränderte sich in dieser Zeit jedoch sehr stark. Menschen können mitreden, mitgestalten, dürfen und sollen ihre eigene Meinung vertreten. Dieser Wandel ging auch auf die Organisationen über.
Strukturen begannen sich aufzulösen und es gab immer weniger dieser ganz klaren Hierarchien. Vielleicht gibt es sie noch im Organigramm, aber vielmehr entstehen Netzwerke und direkte Beziehungen zwischen einzelnen Abteilungen, Menschen, Mitarbeitern und Entscheidern. Alle Beteiligten innerhalb einer Organisation sind viel stärker untereinander verbunden. Und weil sie stärker verbunden sind, werden auch Organisationen als solche komplexer. Es gibt viel mehr Verbindungen, manchmal kennen wir sie, manchmal können wir sie nur vermuten. So mutiert die klassische Aufbauorganisation zu einem komplexen Organismus. Beispielsweise bekommt man bei Projekten über den "Flurfunk" mit, was in einer anderen Abteilung gerade passiert, wie Projekte laufen. Experten gelangen dadurch in einen direkten Austausch. Dieses Stehen am Wasserspender, am Kaffeeautomaten und das Sich-Austauschen schafft zusätzlich zu den bestehenden Strukturen – die Führungskraft verteilt Aufgaben an das Team – vielfältige Querverbindungen.
All das, was ‚da draußen‘ in der Welt passiert, spiegelt sich auch innerhalb der Organisationen wider und stellt einen gewaltigen Wandel dar. So finden sich die Trends aus der Digitalisierung in den Organisationen: Zugang zu Informationen, Geschwindigkeit, Partizipation (oder zumindest der Wunsch danach) und Glaubwürdigkeit. In der Art und Weise, wie wir Organisation verstehen, und wie Organisationen nach innen und nach außen agieren, ist dieser Umbruch zu spüren.
1.4 Bisherige Ausbildung
Wenn wir uns die bisherige Ausbildung an Universitäten, diversen Lehrgängen und klassischen Führungskräftetrainings ansehen, zeigt sich folgendes Bild: Wir haben gelernt, mit der Vergangenheit zu arbeiten. Wir bilden beispielsweise die Zahlen der letzten Quartale in Bilanzen ab (so weit so gut und notwendig). Allerdings ziehen wir aus der Historie Schlüsse für die Zukunft. Gleichzeitig wissen wir, dass ab dem Zeitpunkt, zu dem die Bilanz oder der Geschäftsbericht fertig ist, schon wieder einige Monate vergangen sind. Das alte Geschäftsjahr ist längst abgeschlossen und es hat sich inzwischen viel verändert. Um die Zukunft vorzuplanen, wurden wir wie folgt ausgebildet (auch ich an der Universität, in der Betriebswirtschafts- und Managementlehre): Entwickle eine Vision, brich diese herunter auf ein Drei- bis Fünfjahresziel, dann auf Ziele für das kommende Jahr. Wir haben gelernt, weit in die Zukunft zu blicken und zu planen, immer unter der Voraussetzung, dass unsere Annahmen über die Zukunft fixiert sind. Wir sind bisher von der Hypothese ausgegangen, dass das Umfeld stabil ist. Und genau dieses Nach-vorne-Schauen, dieses langfristige Vorausplanen ist brüchig und in dieser Form nicht mehr anwendbar.
Für unser Entscheiden heißt das, dass wir früher – und dieses Früher ist noch gar nicht so lange her – mit einem linearen Verständnis an strategische Entscheidungen herangegangen sind. Ganz im Sinne von: Wir können uns unterschiedliche Varianten errechnen und die beste davon auswählen, immer unter der Annahme einer gewissermaßen stabilen und vorhersehbaren Zukunft.
Zugriff auf Erfahrungen
Wenn wir entscheiden, greifen wir in der Regel auf Erfahrungen zurück, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Kennen wir bereits eine ähnliche Situation, haben wir schon einmal vor einer vergleichbaren Herausforderung gestanden, und wie haben wir damals gehandelt? Soziologische Aspekte spielen ebenso mit:
Wie sind wir erzogen worden?
Wie haben wir unsere Ausbildung wahrgenommen?
Wie erfolgreich haben wir gelernt, auf Fehler beziehungsweise Erfolge zu achten?
Wenn wir das österreichische oder das deutsche Schulsystem betrachten, liegt der Fokus eher auf dem Aufzeigen von Fehlern als auf dem Lernen aus Erfolgen. Wir werden für Fehler bestraft und weniger für Gelungenes belohnt. Aus diesem erlernten Verhalten heraus liegt es nur nahe, Fehler vermeiden zu wollen. Was wiederum die Vermutung nahelegt, dass wir bei Entscheidungen eher das Risiko scheuen und auf Sicherheit spielen. Für jede unserer Entscheidungen sind unsere Erfahrungen, wie wir zu entscheiden gelernt haben und die daraus entstandenen mentalen Modelle sehr wichtig. Unsere Vergangenheit mit all ihren Erfahrungen und Erlebnissen prägt die Art und Weise, wie wir heute entscheiden. Nach der bisherigen Ausführung zu Veränderungen, Treibern und dem Wandel stellt sich eine entscheidende Frage:
Passt das Von-gestern auf morgen?
Wenn wir nun wissen, wie schnell sich die Welt ändert, stellt sich die Frage, ob das überhaupt noch zusammenpasst. Ist die Art und Weise, wie wir bisher entschieden haben und was wir über das Entscheiden gelernt haben, noch zeitgemäß? Wie bekommen wir den Spagat hin zwischen Gelerntem und Bewährtem und den schnellen Veränderungen von heute? Wie schaffen wir es, flexibel zu werden? Wie bekommen wir neue Perspektiven? Wie können wir dieses In-die-Zukunft-Schauen übersetzen?
Dazu gibt es eine schöne Metapher, die ich gerne als Beispiel verwende: Bis jetzt fuhren wir mit Tempo 80 auf einer geraden, breiten Straße. Allerdings sind wir bisher so gefahren, dass wir den Blick auf den Rückspiegel gerichtet hatten. Auch wenn wir nach vorne gefahren sind, haben wir uns stets an der Vergangenheit orientiert. Wie waren die Zahlen im letzten Quartal, im letzten Jahr? Wie waren die Umsätze? Was hat sich in der Vergangenheit bewährt? Das kann gutgehen, solange die Straße kerzengerade ist. Das ist sie aber nicht mehr. Wir bewegen uns heute mit größerem Tempo von der geradlinigen Straße weg und brettern mit Tempo 130 über einen gewundenen Feldweg. Wir können nicht mehr unsere ganze Aufmerksamkeit dem Rückspiegel widmen. Wir müssen zumindest die Seiten und das Umfeld im Blick behalten, besser noch, nach vorne sehen und uns an der Zukunft orientieren. Und wahrscheinlich sollten wir auch das Tempo reduzieren. Das Wichtigste ist aber, den alten Blick nach hinten in die Vergangenheit, nach vorne in die Zukunft zu richten.
Albert Einstein sagte:
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind.“
Diese Aussage ist jetzt wichtiger denn je. Die Welt in der Zukunft wird noch weniger vorhersehbar sein, als wir bisher erleben konnten oder erwartet haben. Umso wichtiger wird der Fokus auf die Zukunft, um gut gerüstet zu sein, für was auch immer vor uns liegt.
2 Aller Anfang ist entscheidend
In meinen Workshops bitte ich die Teilnehmer zunächst um eine grobe Abschätzung, wie viele Entscheidungen jeder von uns am Tag trifft. In der Regel schwanken die Rückmeldungen zwischen 100 und 150, Mutige liegen irgendwo bei 1.000.
Mittlerweile gibt es belastbare Zahlen, die im Schnitt auf 20.000 Entscheidungen pro Tag hindeuten. Entscheiden beginnt schon beim Aufwachen, wenn der Wecker klingelt: Drücke ich noch einmal auf Snooze oder stehe ich gleich auf? Was ziehe ich an? Esse ich noch etwas? Koche ich mir einen Kaffee oder kaufe ich einen unterwegs? Wenn wir zum Beispiel in einem Café sind: Wird es ein kleiner Kaffee? Ein großer Kaffee? Ein Espresso? Auch hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, zwischen denen wir uns entscheiden müssen. Oder auf dem Weg zur Arbeit: Nehme ich das Auto? Fahre ich mit dem Zug? Welche Route? Wo kann ich parken? Das ist nur ein Bruchteil all jener Entscheidungen, von denen wir nur die wenigsten bewusst treffen. Bewusst entscheiden bedeutet, sich Zeit für die Entscheidung zu nehmen, darüber nachzudenken.
Entscheiden umfasst das mehr oder weniger bewusste Auswählen aus unterschiedlichen Alternativen. Dieses Ent-Scheiden, das Ausscheiden anderer Möglichkeiten, ist das Urwesen, worum es beim Entscheiden geht.
Sind wir uns einer Entscheidung bewusst und entscheiden uns, indem wir uns die Situation durch den Kopf gehen lassen, Möglichkeiten überlegen und die Auswirkungen durchdenken, sprechen wir von Verstandes-Entscheidungen bzw. rationalen Entscheidungen. Manchmal entscheidet unser "Bauchgefühl". Wir sprechen dann von emotionalen, feinstofflichen Entscheidungen, die oft schwer begründbar sind, und trotzdem bewusst gefällt werden können. Bewusst zu entscheiden, muss nicht immer rational sein. Wir können auch ganz bewusst in uns hinein hören. Die Redewendung „Tu, was dir dein Herz sagt", „Hör auf dein Bauchgefühl“ spricht die emotionale Seite, das Gefühl in uns an.
Die erste grobe Unterscheidung betrifft die emotionalen Entscheidungen aus Intuition und Emotion gegenüber den rationalen Entscheidungen, den Vernunft- oder Verstandesentscheidungen. Verstandesentscheidungen lassen sich gut mit einem analytischen Zugang und "Rechenmodellen" abbilden. Auf diese Modelle komme ich im Textverlauf noch einmal zurück. Dem gegenüber stehen die Heuristiken. Das sind Abkürzungen, die wir auf Basis unserer bewussten und unbewussten Erfahrungen nehmen. Erfahrungen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, und entsprechend schlussfolgern wir daraus. Das sind zumeist recht praktikable Ansätze, die sich bewährt haben und in vergleichbaren Situationen ähnlich gute Ergebnisse liefern. Heuristiken können bewusst oder unbewusst zum Einsatz kommen.
Je unbewusster eine Entscheidung ist, desto anfälliger ist sie gegenüber Einflüssen von außen. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir entscheiden, merken wir wahrscheinlich weniger, wenn wir in eine Richtung geschubst, vielleicht sogar manipuliert werden. Fairerweise muss an dieser Stelle gesagt werden, dass wir auch bei bewussten Entscheidungen nicht immer frei von Beeinflussungen durch innere und äußere Faktoren sind.
2.1 Unterscheiden versus Entscheiden
Wenn wir sagen, eine Entscheidung ist eine Wahl aus unterschiedlichen Alternativen, müssen wir im ersten Schritt erkennen können, dass wir mehrere Alternativen zur Verfügung haben. Dann erst können wir entscheiden, welche Wahl wir treffen.
Dazu eine kurze Geschichte: Wenn wir an den Strand gehen und dort Muscheln finden, können wir zum Beispiel zwischen großen und kleinen Muscheln unterscheiden. Angenommen ein Freund hat uns gebeten, ihm eine schöne Muschel vom Strand mitzubringen. Am Strand müssen wir nun eine Muschel auswählen und entscheiden, welche ist schön, groß oder klein genug, weniger schön, passend in der Farbe etc.
Entscheiden ist also ein zweistufiger Prozess: Zuerst muss ich in der Lage sein, Möglichkeiten anhand eines Kriteriums oder mehrerer Kriterien zu unterscheiden, um dann die finale Auswahl zu treffen.
2.2 Entscheiden versus Entscheidung
An dieser Stelle zeige ich eine im weiteren Verlauf wichtige Differenzierung der Begrifflichkeiten auf: Wir unterscheiden zwischen dem Entscheiden und der Entscheidung. Das Entscheiden ist der Prozess des Auswählens, während die Entscheidung dieser singuläre Moment ist, in dem die Wahl getroffen wird. Diese sprachliche Genauigkeit ist wichtig für die Unterscheidung zwischen dem speziellen Moment der Entscheidung an sich und dem Gesamtprozess des Entscheidens.
Das Entscheiden ist also das Vorbereiten zur eigentlichen Wahl, das Abwägen der Möglichkeiten. Solange wir noch nicht wissen, welche Möglichkeit wir auswählen werden, bewegen wir uns noch in der Unsicherheit, wie es weiter gehen soll. Alle Möglichkeiten sind zu diesem Zeitpunkt noch offen. Ist die Entscheidung erst einmal getroffen, tauschen wir diesen Möglichkeitsraum, diese Unsicherheit wie es weiter geht, gegen das Risiko. Denn nach der Entscheidung haben wir uns für eine Möglichkeit, den einen Weg, entschieden und werden infolge mit dem Risiko konfrontiert, ob die Wahl gut war oder nicht.
2.3 Theorien – Die ‚Schulen‘ im Entscheiden
Wann immer es um das Thema Entscheiden geht, treffen in der Literatur und unter den Beratern drei große Ansätze, man könnte fast schon sagen, drei unterschiedliche Philosophien aufeinander.
Die präskriptive Entscheidungstheorie
Der erste Ansatz ist die sogenannte präskriptive Entscheidungstheorie. Dieser nimmt für sich in Anspruch, präskriptiv, also vorschreibend bzw. festlegend zu sein.
Entscheidungen können vorausberechnet werden. Mit diesem Ansatz ist der Entscheider in der Lage, über mathematische Modelle - vor allem mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung - das bestmögliche Ergebnis zu errechnen. Die vorliegende Auswahl an Möglichkeiten kann der Entscheider mit Gewichtungen versehen, bewerten und Wahrscheinlichkeiten festlegen. Die Parameter werden in eine Tabellenkalkulation eingeben und am Ende wird die ideale Option berechnet.
Die präskriptive Entscheidungstheorie hat aus meiner Sicht eine wichtige Daseinsberechtigung. Die Frage ist allerdings, wie dogmatisch der Anwender daran glaubt. Der Zugang hilft, Dinge zu bewerten und zu gewichten. Allerdings treffen wir durch die Auswahl der Gewichtungen, durch das Abbilden in einer Tabellenkalkulation bereits beim Erstellen und Berechnen wichtige Entscheidungen.