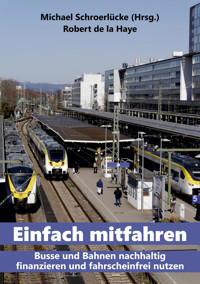
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland hat sich international und national verpflichtet, bestimmte Klima- und Umweltziele zu erreichen und es besteht eine verfassungsrechtliche Pflicht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Der ÖPNV kann dazu einen erheblichen Beitrag leisten, wenn er qualitativ und quantitativ ausgebaut wird und so Mobilität für alle garantiert. Dazu muss die Finanzierung des ÖPNV auf eine solidere Grundlage gestellt werden. Es ist nicht genau bekannt, wie viel Geld tatsächlich für den öffentlichen Nahverkehr jährlich ausgegeben werden muss. Selbst der Bundesrechnungshof weiß das nicht und kritisiert die mittlerweile völlig unübersichtliche Finanzierung aus Steuermitteln sehr deutlich. Der Verband der Verkehrsunternehmen hat als eine der wenigen Messlatten für unser Projekt die Zahl von knapp 16 Milliarden Euro veröffentlicht, die durch Ticketverkäufe im Jahr 2018 erwirtschaftet wurden. Dies ist das Jahr mit den höchsten Ticketeinnahmen für den öffentlichen Nahverkehr. Danach ging es mit den Fahrgastzahlen aufgrund der pandemischen Entwicklung stark bergab, sodass ein Rettungsschirm gebildet wurde, der die Mindereinnahmen ausgleichen sollte. Schreibt man die Fahrgastzahlen von 2019 mit Berücksichtigung der Fahrpreiserhöhungen zwischen 2020 und 2023 fort, lägen die Fahrgeldeinnahmen zwischenzeitlich bei circa 17 bis 18 Milliarden Euro. Dabei ignorieren wir die Folgen des Pandemieknicks auf die Fahrgeldeinnahmen und auch die anschließenden Mindereinnahmen durch das Deutschlandticket. Wir haben diese Voraussetzungen als Berechnungsrundlage für unsere Überlegungen gewählt, ob ein solidarisch finanzierter Nahverkehr die Ticketeinnahmen ersetzen und solide finanziert werden kann. Um es vorwegzusagen: Es lohnt sich weiterzulesen, denn wir werden aufzeigen, dass nicht nur die Ticketeinnahmen durch eine solidarische Finanzierung ersetzt werden können. Es bleiben je nach Beitragshöhe weitere Finanzmittel, um den ÖPNV weiter auszubauen oder die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen mitfinanzieren zu können. Vor Ihnen liegt kein wissenschaftliches Buch. Wir geben aber Hinweise auf Gutachten und Stellungnahmen juristischer und verkehrswissenschaftlicher Natur oder greifen auf Zeitungsberichte oder deren Online-Angebote sowie auf Informationen zum öffentlichen Nahverkehr aus dem Internet zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Schroerlücke (Hrsg.) Robert de la Haye
Einfach mitfahren
Busse und Bahnen nachhaltig finanzieren und fahrscheinfrei nutzen
© 2025 Michael Schroerlücke (Hrsg.)
Satz & Umschlag: Erik Kinting
Verlag:
Michael Schroerlücke
Lorenweg 48
53347 Alfter
Druck und Distribution:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Softcover
978-3-384-55487-1
Hardcover
978-3-384-55488-8
E-Book
978-3-384-55489-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Alle Grafiken sind selbst erstellt auf Basis der angegebenen Datenquelle. Ausnahmen sind entsprechend gekennzeichnet.
Bildmaterial stammt aus privaten Sammlungen der Autoren, wenn keine andere Quelle angegeben ist.
Aktualisierungen zu Inhalten dieses Buches finden Sie unter: https://dialog-gesundheit-klima.de/einfach-mitfahren
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Was uns motiviert
Was ist eigentlich ÖPNV?
Vorurteile und Fakten: Unzufriedenheit mit dem ÖPNV
Warum wir einen guten ÖPNV brauchen
Nachholbedarf bei der Infrastruktur – Erweiterungsbedarf beim Angebot
Kosten von Infrastrukturaufbau und Angebotsverdichtung
Vom Schaffner zur App
Die „neue Leichtigkeit“ für Fahrgäste
Mindereinnahmen und Finanzierungsstreit als Folge des Deutschlandtickets
Geringere Einnahmen – aber hoher Investitionsbedarf
Erwartungen an den ÖPNV als Daseinsvorsorge
Ausbau- und Modernisierungspakt für den ÖPNV als Lösung?
Besserer ÖPNV wichtiger denn je!
Den ÖPNV attraktiver machen: verlässlich finanziert, sozial, klimafreundlich und effektiv
Ticketlos fahren – durch Beiträge finanziert
Planungssicherheit durch nachhaltige Finanzierung
Gesetzliche Grundlage der Beitragserhebung
Organisation des Beitragseinzugs
Aufteilung der Einnahmen an die Verkehrsunternehmen (Zuscheidungsverfahren)
Vor- und Nachteile eines beitragsfinanzierten Nahverkehrs
Argumente und kritische Fragen zur Beitragsfinanzierung
ÖPNV-Beitrag trotz Personalmangel
Wie sinnvoll ist ein „kostenloser“ Nahverkehr?
Kostenlos oder beitragsfinanziert?
Achtung! Sie befinden sich hinter der Warnschranke!
Gesetzliche Voraussetzungen für einen ÖPNV-Beitrag
Ein Länderstaatsvertrag als Basis für einen deutschlandweiten ÖPNV-Beitrag
Weitere Überlegungen zur Aufteilung der Einnahmen (Zuscheidungsverfahren)
Gründe für ein Gesetz zum ÖPNV-Beitrag
Sicherstellung der Qualität und Wirtschaftlichkeit des ÖPNV
Die richtige Reihenfolge einhalten: Bedarf ermitteln, Geld beschaffen, ausbauen
Die Steuerfinanzierung als Teil des ÖPNV-Finanztopfs
Erhalt der Steuermittel und Transparenz
Dank
Verzeichnis der verwendeten Quellen
Autoren
Einfach mitfahren
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Autoren
Einfach mitfahren
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Vorwort
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
wir wollen Sie verführen: verführen, eine Idee weiter zu verfolgen und mitzumachen. Wir möchten den öffentlichen Personennahverkehr nachhaltig finanzieren und für alle bezahlbar machen. Das Ideal wäre: „Fahren mit Bus und Bahn ohne Fahrschein“. Diese Idee ist nicht neu, aber vor dem Hintergrund der Diskussion um das 9-Euro-Ticket und das Deutschlandticket sehr aktuell. Wir möchten Sie an unseren Erfahrungen und Gedanken teilhaben lassen und am besten wäre es, wenn viele mitmachen und die Idee unterstützen. Dafür wollen wir Argumente liefern.
Vor Ihnen liegt kein wissenschaftliches Buch. Wir haben es auch für die interessierten Laien geschrieben. Im ersten Teil werden die Vorteile einer solidarischen Finanzierung des Nahverkehrs zusammengestellt und unser Modell einer Finanzierung verständlich erklärt. Wir begründen – auch aus historischer Sicht – unser Vorhaben und setzen uns mit Gegenargumenten auseinander. Dabei greifen wir auch auf Berichte in der Presse und andere Online-Angebote zurück.
Für diejenigen, die sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen, haben wir das Beitragsmodell im zweiten Teil vertiefend erläutert und geben Hinweise auf weitere Gutachten, Berichte und Stellungnahmen. Wir legen unsere Berechnungsgrundlagen dar und befassen uns auch mit Möglichkeiten der praktischen Umsetzung.
Was uns motiviert
An einem Abend im Jahr 2009 hatte Robert in einer Fernsehsendung von einem Zwölfjährigen erfahren, dessen Lebensraum sich auf drei Quadratkilometer beschränkte, weil sich die Eltern weder Auto noch Bus leisten konnten. „Und da habe ich zum ersten Mal den Gedanken gehabt, gegen diesen Missstand etwas zu unternehmen. Armen Menschen wird eine Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehrt, weil sie nicht die Möglichkeit haben, Bus und Bahn zu nutzen.“
Michael ist als Kind gerne mit dem Bus oder der Straßenbahn gefahren, meist mit seinem Großvater. Sie mussten mit Kleingeld bezahlen, sich aber keine Gedanken darüber machen, welcher Fahrschein zu lösen war. Der Fahrschein konnte einfach beim Fahrer gekauft werden, ganz ohne Tarifkenntnisse. Das änderte sich jedoch mit der Einführung von Fahrkartenautomaten und Fahrscheinentwertern. 2020 faszinierte ihn Roberts Idee einer solidarischen Finanzierung und fahrscheinfreien Nutzung von Bus und Bahn nicht zuletzt, weil die Eigenverantwortung beim Lösen der Fahrkarte und die immer unübersichtlichen Tarife ein erhebliches Zugangshemmnis zum ÖPNV darstellten.
Als 2022 das 9-Euro-Ticket als ÖPNV-Alternative zum Tankrabatt kam, fand nicht nur Michael die „neue Freiheit“, immer und überall einfach einzusteigen, super. Allerdings war klar, dass das 9-Euro-Ticket nicht länger als drei Monate finanziert wird. Der Nachfolger, das Deutschlandticket, führte zu erheblichen Mindereinnahmen bei den Verkehrsbetrieben.
Umso mehr waren wir motiviert, ein System zu entwickeln, das allen Bürgerinnen und Bürgern ein fahrscheinfreies Fahren ermöglicht und gleichzeitig die Einnahmen der Verkehrsbetriebe erhöht und verstetigt.
Was ist eigentlich ÖPNV?
In diesem Buch wird viel vom ÖPNV die Rede sein. Daher können wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Erklärung, was eigentlich ÖPNV ist, und einige grundlegende Hinweise nicht ersparen. Es geht aber nicht so dröge weiter – versprochen!
Bislang haben wir immer von Bus und Bahn gesprochen. Damit war der gesamte öffentliche Personennahverkehr, abgekürzt ÖPNV, gemeint.
Definition ÖPNV
Wenn wir uns Fahrpläne von Bussen und Bahnen ansehen, erkennen wir, dass sie auf bestimmten festgelegten Routen, auch Linien genannt, fahren und es Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten in Form von Haltestellen gibt. Nach Regionalisierungsgesetz § 2 ist Öffentlicher Personennahverkehr „die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt“.1
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist also der Sammelbegriff für Angebote im Nahverkehr, die nach einem regelmäßigen Fahrplan verkehren und die alle nutzen können. Im Sinne einer staatlichen Daseinsvorsorge sollen Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr für die Bevölkerung sichergestellt werden. Zum ÖPNV gehören Regionalexpress, Regionalbahn, S- und U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Hochbahn, Bürgerbus und vergleichbare Verkehrsmittel im öffentlichen Nahverkehr. So wird zum Beispiel in Bonn eine Seilbahn geplant, die in den ÖPNV integriert werden soll.
Der Verkehr mit Taxen ist Öffentlicher Personennahverkehr, wenn er die Verkehrsnachfrage zur Beseitigung einer räumlichen oder zeitlichen Unterversorgung befriedigt, zum Beispiel als Taxibus oder Anruf-Sammel-Taxi.
Nicht zum ÖPNV gehören die Fernverkehrszüge beispielsweise der Deutschen Bahn, also alle ICE und IC-Züge. Für den Fernverkehr gelten andere Tarife als für den Nahverkehr, weshalb die Finanzierung des Fernverkehrs nicht Bestandteil unserer Überlegungen zur Finanzierung des ÖPNV ist.
Zuständigkeiten
Der ÖPNV teilt sich in zwei Teilbereiche auf: Der eine Bereich findet auf der Schiene statt (schienengebunden) und der andere Bereich auf der Straße (straßengebunden). Für diese Bereiche gibt es organisatorisch jeweils eine eigene Zuständigkeit.
Für den öffentlichen straßengebundenen Personennahverkehr, kurz ÖSPV genannt, sind die Kommunen und Kreise Aufgabenträger. Zum ÖSPV gehört der Nahverkehr mit Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, auch wenn Straßenbahnen und U-Bahnen nicht immer straßengebunden sind.
Zum Schienenpersonennahverkehr, abgekürzt SPNV, gehören die S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge und ähnliche Angebote des schienengebundenen Nahverkehrs.
Die Aufgabenträger des SPNV sind in den ÖPNV-Gesetzen der Länder festgelegt und je nach Bundesland verschieden. In einigen Bundesländern sind die Kommunen und Kreise Aufgabenträger. Sie haben in ihrem Bundesland Zweckverbände oder Anstalten öffentlichen Rechts gegründet, die Zugleistungen planen, ausschreiben, bestellen und bezahlen. Andere Bundesländer haben zu diesem Zweck eine Landesnahverkehrsgesellschaft gegründet, die Zugleistungen plant, ausschreibt, bestellt und bezahlt. In NRW sind laut ÖPNV-Gesetz die Kommunen und Kreise Aufgabenträger des SPNV. Dort ist beispielsweise go.Rheinland als Zweckverband für die Organisation des SPNV im Bereich des Aachener Verkehrsverbundes und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg zuständig, im Ruhrgebiet übernimmt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr diese Aufgabe, im Münsterland, Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen und dem Sauerland der Zweckverband Westfalen Lippe.
In Bayern liegt die Aufgabenträgerschaft beim Land und die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) plant, bestellt und bezahlt im Auftrag des Landes den Schienenpersonennahverkehr in Bayern. Ähnlich funktioniert es auch in den meisten anderen Bundesländern.
Finanzierung
Der Öffentliche Personennahverkehr wird zunächst über Fahrgeldeinnahmen finanziert. Tatsächlich decken die Einnahmen durch den Fahrtkartenverkauf die für den Betrieb und Erhalt des ÖPNV notwendigen Finanzmittel nicht. Deshalb beteiligen sich Bund, Länder und auch die Kommunen an der Finanzierung des ÖPNV – mit Steuergeldern. Man geht davon aus, dass Steuergelder etwa die Hälfte der Ausgaben für den ÖPNV abdecken müssen.
Während im SPNV die Regionalisierungsmittel des Bundes genutzt werden, finanzieren den Betrieb des ÖSPV in der Regel die Kommunen und Kreise. Zur Förderung des ÖPNV stehen außerdem Landesmittel sowie Bundesmittel zur Verfügung, die zum Teil durch die Länder verwaltet werden. Selbst Fachleute haben kaum einen Durchblick über die verschiedenen Förderungen und weil die Förderregelungen so verworren sind wie Spaghetti auf einem Teller, wird auch von einer Spaghetti-Finanzierung gesprochen.
1 Bundesamt für Justiz – Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes – Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz – RegG) § 2 Begriffsbestimmungen Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/regg/__2.html (zuletzt abgerufen am 5.2.2025)
Vorurteile und Fakten: Unzufriedenheit mit dem ÖPNV
Der öffentliche Personennahverkehr hat in den vergangenen Jahren in der politischen Diskussion an Bedeutung gewonnen. Allerdings hat die ab den 2020er Jahren stark zunehmende Unzuverlässigkeit, insbesondere im Bereich des SPNV, also bei „der Bahn“, zu erheblichen Frustrationen bei den Fahrgästen geführt. Die Gründe für die Unzuverlässigkeit sind vielfältig:
Probleme mit Fahrzeugen, insbesondere in der Einführungsphase neuer Fahrzeugserien, führen zu Notfahrplänen mit Ersatzfahrzeugen. Durch zahlreiche Baustellen im Netz kann die Infrastruktur nur eingeschränkt genutzt werden. Häufig wird der Fahrplan eingeschränkt oder Züge durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Fahrgäste müssen umsteigen und Fahrzeitverlängerungen in Kauf nehmen. Für Verspätungen und Ausfälle sorgen immer häufiger krankheits- und streikbedingte Ausfälle des viel zu knappen Personals. Aber alles Lamentieren hilft nichts: Das Gleisnetz muss saniert werden und das Personalproblem gelöst, solange gehen die Reisenden durch das „Tal der Tränen“. Wenn wir mit Pendlerinnen und Pendlern oder anderen den ÖPNV häufig nutzenden Personen gesprochen haben, haben wir oft gehört, dass das Fahrtenangebot nach Fahrplan gar nicht schlecht ist. Es müsste nur zuverlässiger gefahren werden.
In den Medien wird berichtet, dass das ÖPNV-Angebot – auch in Städten – verbessert werden muss. Sprechen wir hingegen mit Menschen, die den ÖPNV regelmäßig nutzen, fällt die Kritik am Angebot gar nicht immer so schlecht aus. Im Bereich der Städte herrscht Zufriedenheit mit dem Angebot der „Öffis“, wenn entsprechend zuverlässig gefahren wird. Allerdings leben in Deutschland mehr als die Hälfte der Menschen in den ländlichen Räumen. Dort gibt es zwar einen regelmäßigen und verdichteten Linienverkehr auf Hauptachsen, es fehlt aber ein fein verästeltes System wie im städtischen Bereich.
Auf ein Auto kann daher auf dem Land in der Regel nicht verzichtet werden. Deshalb fühlen sich Menschen im ländlichen Raum zurückgesetzt, wenn es zum Beispiel um Themen wie das Deutschlandticket geht. Dies ist über die Steuern natürlich auch von der Landbevölkerung, die nichts von dem Ticket hat, mitfinanziert. Daher sollte die Feinerschließung auf dem Land zügig auf den Weg gebracht werden. On-Demand-Verkehre und Rufbussysteme können schwach ausgelastete Bereiche effizienter bedienen. Vorhandene Modellprojekte mit verschiedenartigen Taxi-Bus-Systemen oder On-Demand-Verkehren zeigen auf, was möglich ist. Sie zeigen aber auch einen erheblichen Finanzierungsbedarf auf. Vor dem Hintergrund der finanziellen Notlage der Kommunen ist deren Finanzierung ein kaum denkbares Unterfangen: Nach der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände betrug das Defizit im Jahr 2023 rund 6,4 Milliarden Euro und wird in den Folgejahren auf jährlich nahezu 10 Milliarden Euro anwachsen.2 Kein Wunder, dass nicht nur die ÖPNV-Nutzerinnen und - Nutzer, sondern auch die Kommunen als Aufgabenträger mit der Situation unzufrieden sind. Jedoch geht es den Aufgabenträgern im Wesentlichen um die zunehmenden Einnahmeausfälle und die dadurch bedrohte Angebotsqualität beim ÖPNV.
Die Kommunen haben von Anfang an gesagt, dass sie die finanziellen Lasten und Risiken des Deutschlandtickets nicht übernehmen können. Mit dem Deutschlandticket ist jetzt aber eine Situation entstanden, bei der die Finanzierung des Ausbaus und der Stärkung an die hinterste Stelle tritt, zumal noch nicht einmal der Betrieb des ÖPNV gesichert ist. Es spricht daher einiges dafür, vor Einführung von steuerfinanzierten Projekten wie dem Deutschlandticket über deren Finanzierung zu sprechen, die den Ausbau einschließt. Dies wurde vergessen und das Deutschlandticket entpuppt sich immer mehr zu einer finanzpolitisch nicht durchdachten Posse.
Unter dem Zufriedenheitsaspekt stellen sich weitere Fragen: Kann der ÖPNV so attraktiv sein wie das Auto? Dies wird wohl nie der Fall sein. Wenn der Bus halbstündlich fahren sollte, aber ausfällt und die Wartezeit dann eine Stunde beträgt, ist es mit der guten Stimmung schnell vorbei. In der Hitze des Sommers wie auch in der Kälte des Winters stellt sich die Frage, wer sich das antun sollte, wenn die Fahrtzeit mit dem Auto 20 Minuten beträgt, mit dem Bus im schlechtesten Fall eineinhalb Stunden. Natürlich kann die Nutzung des privaten PKW´s auch praktische Gründe haben, wenn man zum Beispiel große oder schwere Gegenstände transportieren muss. Die möchte man nicht zu den Haltestellen und durch Bahnhöfe schleppen. Allerdings kommen auch immer mehr Kunden mit dem Fahrrad in die Stadt und können nicht beliebig große Einkäufe transportieren. Daher geht der Einzelhandel immer mehr dazu über, Einkäufe auch zuzusenden.
Bus und Bahn zu fahren ist dafür in anderer Hinsicht vorteilhafter als Autofahren. Wir können die Landschaft betrachten, schlafen, uns mit Menschen unterhalten, lesen, dösend von der Arbeit erholen oder Arbeit erledigen, und wenn dann noch die Klimaanlage funktioniert …
Auch unabhängig von persönlichen Vorlieben gibt sehr viele Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Und allein deshalb ist es nicht nur ein Gebot der Solidarität, einen guten ÖPNV vorzuhalten. Ein gutes Nahverkehrsangebot gewährleistet Mobilität und Teilhabe am öffentlichen Leben auch für diejenigen, die nicht mit dem Auto fahren können oder wollen. Dementsprechend zählt der ÖPNV zu den staatlichen Leistungen der Daseinsvorsorge, wie beispielsweise Energie- und Wasserversorgung auch.
2 vgl.: Deutscher Städtetag: Pressemeldung des Deutschen Städtetages Kommunale Haushalte geraten in Schieflage vom 18.07.2023 Abrufbar unter:
https://www.staedtetag.de/presse/pressemeldungen/2023/ prognose-kommunalfinanzen-kommunale-haushalte-in-schieflage (zuletzt abgerufen am 5.2.2025)
Warum wir einen guten ÖPNV brauchen
Deutschlands Verpflichtung zum Erreichen der Klimaziele
Die Klimapolitik der Bundesrepublik Deutschland ist eingebettet in internationale Verpflichtungen, die – wenn man sich rechtstreu verhalten will – für jede Bundesregierung gelten.
Es gibt eine Vielzahl von internationalen Umweltabkommen und Organisationen, die sich mit Aspekten des Klimaschutzes befassen. Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen – kurz Klimarahmenkonvention – hat zum Ziel, eine gefährliche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems zu verhindern, die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern. Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention, das die Umsetzung der Konvention begleitet, hat seinen Sitz seit 1996 in Bonn und wacht darüber, dass alle Vertragspartner jährlich nationale Treibhausgasbilanzen erstellen. Die Klimarahmenkonvention wurde am 9. Mai 1992 in New York City verabschiedet und im selben Jahr auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro von zunächst 154 Staaten unterschrieben. Inzwischen gibt es 198 Vertragspartner. Sie treffen sich jährlich zu den UNKlimakonferenzen (auch „Weltklimagipfel“ genannt), auf denen um konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz gerungen wird. Entscheidungen müssen im Konsens getroffen werden, jedes Mitglied kann Entscheidungen blockieren.3
Insbesondere das Pariser Abkommen von 2015 hat einen Meilenstein in der globalen Klimapolitik gesetzt. Das Abkommen wurde von fast allen Staaten der Welt ratifiziert und verfolgt das Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius über vorindustriellen Werten zu begrenzen. Es sollen Anstrengungen unternommen werden, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
Das Pariser Abkommen legt verschiedene Verpflichtungen fest, einschließlich der Festlegung nationaler Emissionsziele und der Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Entwicklungsländer, und schafft ein transparentes Überwachungs- und Berichtssystem, um sicherzustellen, dass die Parteien ihre Verpflichtungen einhalten. Das Abkommen basiert auf den Prinzipien der gemeinsamen Verantwortung, differenzierten Verpflichtungen und Respektierung der jeweiligen Kapazitäten der Länder. Diese Prinzipien erkennen an, dass entwickelte Länder wie Deutschland historisch mehr zur Klimaerwärmung beigetragen haben und daher eine größere Verantwortung tragen.
Der Klimawandel bedroht nicht nur die Umwelt, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität, die soziale Gerechtigkeit und letztendlich das Überleben der menschlichen Zivilisation. Angesichts dieser Bedrohung spielt das internationale Recht eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels, während das deutsche Recht auf nationaler Ebene eine wichtige Ergänzung dazu darstellt.4
Deutsches Recht zum Klimaschutz
Auf nationaler Ebene hat Deutschland ebenfalls eine entscheidende Rolle im globalen Klimaschutz übernommen. Das deutsche Rechtssystem hat eine breite Palette von Vorschriften und Gesetzen entwickelt, die darauf abzielen, die Emissionen zu reduzieren und erneuerbare Energien zu fördern. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist ein Schlüsselinstrument, das die Einspeisung erneuerbarer Energien ins Stromnetz reguliert und Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien bietet.
2019 beschloss die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz. Es sah vor, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % unter den Vergleichswert des Jahres 1990 zu reduzieren. Ein wesentlicher Teil betrifft die Ressortzuständigkeit. Für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges wurde eine jährlich sinkende Jahresemissionsgrenze festgelegt, für deren Einhaltung das dem Sektor zugeordnete Bundesministerium verantwortlich ist. Wird die Jahresemissionsgrenze überschritten, muss das verantwortliche Ministerium aus eigenem Budget Emissionsrechte zukaufen.5 Nach dem Klimaschutzgesetz 2019 hat der Sektor Verkehr von 2020 bis 2030 die Jahresemissionsmenge von 150 auf 95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren.
Die Einhaltung der Klimaziele und die Planung notwendiger Maßnahmen hat Verfassungsrang:
Das Bundesverfassungsgericht fordert, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden.6
Gegen das Klimaschutzgesetz haben insbesondere junge Leute Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Die Regelungen gingen ihnen nicht weit genug. Das Bundesverfassungsgericht erklärte im März 2021 einige Regelungen des Klimaschutzgesetzes mit den Grundrechten für unvereinbar. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 die Fortschreibung der Minderungsziele über das Jahr 2031 hinaus zu regeln. Zur Begründung hieß es, das Gesetz verschiebe hohe Lasten, Emissionen zu mindern, unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Dies gehe zu Lasten der jüngeren Generation, die sich dann um so mehr einschränken müsse, um die Lebensgrundlagen zu erhalten und mit immer dringenderen und kurzfristigeren Maßnahmen die Erwärmung zu begrenzen. Es dürfe nicht einer Generation das Recht zugestanden werden, große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn dadurch die nachfolgenden Generationen hohe Freiheitseinbußen durch hohe Reduktionslasten verkraften müssen. Der Gesetzgeber habe deshalb Vorkehrungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern.7
Mit dem geänderten Klimaschutzgesetz unter CDU/CSU und SPD wurden die für den Zeitraum bis 2030 bisher bestehenden Ziele verschärft, vor allem für die Sektoren Industrie und Energiewirtschaft. Einer von dort genannten sechs Sektoren betrifft den „Verkehr“. Dieser Sektor hat von 2020 bis 2030 die Jahresemissionsmenge von 150 auf nunmehr 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren. Die Frist zum Erreichen der Klimaneutralität wurde von 2050 auf 2045 vorgezogen.
Ziele im Verkehrsbereich verfehlt
Die Sektoren Gebäude und Verkehr haben die jährlichen Ziele in den Jahren 2021 und 2022 verfehlt. Auch im Jahr 2023 sah es laut Umweltbundesamt nicht wesentlich besser aus. „Im Jahr 2023 war der Verkehrssektor für rund 146 Millionen Tonnen Treibhausgase (berechnet als CO2-Äquivalente; kurz: CO2-Äq.) verantwortlich und trug damit rund 22 % zu den Treibhausgasemissionen Deutschlands bei. Dieser Anteil an den Gesamtemissionen ist gegenüber 1990 um neun Prozentpunkte gestiegen. Mit nur 10,9 % Minderung gegenüber 1990 hat der Verkehr seine Emissionen dabei – verglichen mit anderen Sektoren – deutlich weniger verringert.“8
Das Klimaschutzgesetz (KSG) sieht die Errichtung eines Expertenrats für Klimafragen vor, der aus fünf sachverständigen Personen verschiedener Disziplinen besteht. Die Mitglieder werden von der Bundesregierung für die Dauer von fünf Jahren benannt. Frauen und Männer sollen gleichberechtigt vertreten sein, Mitglieder können einmal erneut benannt werden. Der Expertenrat prüft die vom Umweltbundesamt vorgelegten Emissionsdaten und legt der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag eine Risikobewertung der veröffentlichten Daten vor.





























