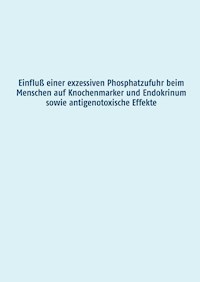
Einfluß einer exzessiven Phosphatzufuhr beim Menschen auf Knochenmarker und Endokrinum sowie antigenotoxische Effekte E-Book
Manuela Grimm
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die in letzter Zeit immer wieder auftretenden Diskussionen zum nicht gedeckten Calciumbedarf und einer den Bedarf übersteigenden Zufuhr an Phosphor machen Studien zur Erfassung der möglichen Folgen für den menschlichen Organismus erforderlich. Starke industrielle Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln, hoher Konsum proteinreicher Nahrungsmittel und gesteigerter Verzehr von Fast-Food- Produkten, bei sinkender Aufnahme von Milchprodukten sind die Ursachen für Calciummangel und Phosphorüberschuß in der Nahrung. Gelangte man früher durch Übertragung der Ergebnisse von Tierversuchen noch zu der Ansicht, dass Phosphormengen bis zu 6 g/Tag vom Menschen vertragen werden, hat man die maximal tolerierbare Menge heute bei 4 g P/Tag festgelegt (MONSEN 2000, ANONYM 1997). Langfristige exzessive Calcium/Phosphat-Imbalancen sollen schon im Kindesalter das Entstehen von Rachitis begünstigen. Allerdings scheint nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Notwendigkeit zu bestehen, phosphorhaltige Lebensmittel zu meiden, um Störungen des Knochenmetabolismus vorzubeugen (ANONYM 2000). Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich unterschiedliche Phosphoraufnahmen, die sich zwischen der zur Bedarfsdeckung empfohlenen Zufuhr und der maximal tolerierbaren Menge bewegen, auf den menschlichen Stoffwechsel auswirken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung, Übersicht und Zielstellung
1.1 Übersicht
1.2 Zielstellung
2 Material und Methoden
2.1 Auswirkungen von Phosphorsupplementen
2.1.1 Studienüberblick
2.1.2 Probanden
2.1.3 Diäten
2.2 Auswirkungen steigender Calcium- und Phosphorzulagen
2.2.1 Studienüberblick
2.2.2 Probanden
2.2.3 Diäten
2.3 Probenmanagement
2.3.1 Prüfparameter
2.3.2 Probenentnahme und -vorbereitung
2.4 Methoden der Laboruntersuchungen
2.4.1 Nährstoffe
2.4.2 Physikalischer Brennwert
2.4.3 Mengen- und Spurenelemente
2.4.4 1,25-Dihydroxycholecalciferol
2.4.5 Calcitonin
2.4.6 Osteocalcin
2.4.7 Parathormon
2.4.8 Glucose
2.4.9 Harnstoff
2.4.10 Creatinin
2.4.11 pH-Wert in Stuhl und Urin
2.4.12 Fettsäurenmuster im Stuhl
2.4.13 Flüchtige Fettsäuren im Stuhl
2.4.14 Immunologische Parameter im Blut
2.4.15 Genotoxische Untersuchungen
2.4.16 Ionisiertes Calcium im Faeceswasser
2.4.17 Pyridinolin und Deoxypyridinolin
2.4.18 α-1-Microglobulin, β-2-Microglobulin und Microalbumin
2.5 Nährstoffbilanzen
2.6 Statistische Auswertung
3 Ergebnisse und Diskussion
3.1 Supplemente
3.2 Nährstoffaufnahme
3.3 Nährstoffausscheidung
3.4 Nährstoffbilanzen
3.5 Serum
3.5.1 Mengen- und Spurenelemente im Serum
3.5.2 Glucose, Harnstoff und Creatinin
3.5.3 Endokrine Parameter
3.5.4 Immunologische Parameter
3.6 Stuhl
3.6.1 pH-Wert des Stuhles
3.6.2 pH-Wert und der Gehalt an flüchtigen Fettsäuren im Stuhl
3.6.3 Fettsäurenmuster im Stuhl
3.7 Faeceswasser
3.7.1 Nachweis von DNA-Schäden mit der Einzelzellmikrogelelektrophorese (Comet-Assay)
3.7.2 Calcium und Phosphat im Faeceswasser
3.8 Urin
3.8.1 pH-Wert des Urins
3.8.2 Pyridinolin und Deoxypyridinolin
3.8.3 Microalbumin, α-1-Microglobulin und γ-2-Microglobulin
4 Vergleichende Diskussion der drei Interventionsstudien
4.1 Einfluß von Phosphorzulagen auf die Serumkomzentrationen von Phosphor
4.2 Einfluß von Phosphorzulagen auf den Knochenstoffwechsel
4.3 Einfluß von Phosphorzulagen auf das Endocrinum
4.4 Korrelationen zwischen Phosphor- und Calciumaufnahmen und – ausscheidungen
5 Schlußfolgerungen
6 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Danksagung
Selbständigkeitserklärung
Lebenslauf
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Durchschnittswerte der Gehalte an Phosphaten in den einzelnen Lebensmitteln und Zusatzstoffen (Auswahl)
Tabelle 2: Empfohlene Zufuhr für Calcium und Phosphor in mg/d
Tabelle 3: Häufige oder in Einzelfällen beobachtete Auswirkungen einer inadäquaten Phosphorzufuhr
Tabelle 4: Übersicht zu den Interventionsstudien
Tabelle 5: Studiendesign – Studie 1 und Studie 2
Tabelle 6: Basisdaten der Probanden zu Beginn der Studien
Tabelle 7: Beispiel für die Zusammenstellung von 9 Tagesmenüs mit einem Energiegehalt von 2500 bzw. 3500 kcal – 1. bis 5. Tag
Tabelle 8: Beispiel für die Zusammenstellung von 9 Tagesmenüs mit einem Energiegehalt von 2500 bzw. 3500 kcal – 6. bis 9. Tag
Tabelle 10: Basisdaten zu Beginn der Studie
Tabelle 11: Probennahmezeitpunkte während der drei Studien
Tabelle 12: In den drei Studien analysierte Parameter und deren Bestimmungsmethoden – Teil 1
Tabelle 13: In den drei Studien analysierte Parameter und deren Bestim mungsmethoden – Teil 2
Tabelle 14: Geräteparameter zur Bestimmung der Mengen- und Spurenelemente (ICP-OES)
Tabelle 15: Geräteparameter zur Bestimmung von Cu, Zn und Mn (ICP-MS)
Tabelle 16: Angewandte Wellenlängen und zugehörige Ordnungen
Tabelle 17: Geräteparameter zur Bestimmung der langkettigen Fettsäuren (GC)
Tabelle 18: Geräteparameter zur Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren (GC)
Tabelle 19: Erfaßte immunologische Parameter und deren Referenzbereiche
Tabelle 20: Gehalte an Phosphor, Calcium und Natrium der verwendeten Supplemente (Studien 1 bis 3)
Tabelle 21: pH-Wert im Orangensaft
Tabelle 22: Trockensubstanzaufnahme in Gramm und Energieaufnahme in Kilokalorien bezogen auf das Körpergewicht bzw. in Prozent...
Tabelle 23: Mittlere Nährstoffaufnahme pro Person und Tag
Tabelle 24: Ausgewählte Aufnahmedaten für Calcium und Phosphor in der BRD und den USA
Tabelle 25: Renale Phosphorausscheidung unter differierenden Zulagen
Tabelle 26: Mittlere fäkale Ausscheidung pro Person und Tag
Tabelle 27: Mittlere renale Ausscheidung pro Person und Tag
Tabelle 28: Ca : P-Verhältnisse und scheinbare P-Absorption (S1 – S3)
Tabelle 29: Stickstoffaufnahme, -ausscheidung und Bilanz (S1 und S2)
Tabelle 30: Mineralstoffaufnahme, -ausscheidung und Bilanzen der Zulageperioden in den drei Studien
Tabelle 31: Mineralstoffaufnahme, -ausscheidung und Bilanzen der Zula geperioden in den drei Studien
Tabelle 32: Mengen- und Spurenelemente im Serum (Studie 3)
Tabelle 33: Mengen- und Spurenelemente im Serum (Studien 1 und 2)
Tabelle 34: Glucose, Harnstoff und Creatinin im Serum (S1 und S2)
Tabelle 35: 1,25-(OH)2D3, Parathormon, Osteocalcin und Calcitonin im Serum der Männer und Frauen (S1 und S2)
Tabelle 38: pH-Wert und prozentuale Anteile der flüchtigen Fettsäuren im Stuhl
Tabelle 39: Fettsäurenmuster im Stuhl in % der gesamten Fettsäurenmethylester (Studien 1 und 2)
Tabelle 40: Genotoxizität und Zytotoxizität im Faeceswasser
Tabelle 42: Calcium und Phosphat im Faeceswasser
Tabelle 43: pH-Wert im Urin
Tabelle 44: Creatinin und Pyridinium-Crosslinks im Urin (S1 und S2)
Tabelle 45: Microalbumin und ß-2-Microglobulin im Urin (S1 und S2)
Tabelle 46: Studien zu den Auswirkungen einer Phosphorsupplementation auf endokrine Parameter
Tabelle 47: Prozentuale Verteilung der Phosphorausscheidung auf Urin und Faeces
Tabelle 48: Prozentuale Verteilung der Calciumausscheidung auf Urin und Faeces
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Polyphosphat
Abbildung 2: Regulation des Calcium- und Phosphathaushaltes durch PTH, Calcitonin und Vitamin D3
Abbildung 3: Am Knochenmetabolismus beteiligte biochemische Marker
Abbildung 5: Prozentualer Anteil der einzelnen Lebensmittel/-gruppen an der Calcium- und der Phosphoraufnahme (Beispiel: Proband 21)
Abbildung 8: Phosphor- und Calciummetabolismus (mg/d)
Abbildung 9: Monozyten-Anzahl pro μl Blut
Abbildung 10: CD69
Abbildung 11: CD8
Abbildung 12: CD54
Abbildung 13: CD32
Abbildung 14: CD19+CD32+
Abbildung 15: CD95
Abbildung 16: CD4+CD95+
Abbildung 17: Phagotest
Abbildung 18: Oxidativer Burst
Abbildung 19: CD3+CD69+
Abbildung 20: DNA-Strukturen von Kolonzellen im Comet-Assay
Abbildung 21: Pyd und DPyd
Abbildung 22: Typisches Chromatogramm der Bestimmung von Pyd und DPyd im Urin
Abkürzungsverzeichnis
Frauen
Männer
1,25-(OH)
2
D
3
1,25-Dihydroxycholecalciferol
BMI
Body Mass Index
CD
cluster of differentiation
DGE
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Dpyd
Deoxypyridinolin
FACS
Fluorescence-activated Cell-Sorter
Fc
kristallisierbares Antikörperfragment
GC
Gaschromatographie
HPLC
Hochdruckflüssigchromatographie
ICAM
interzelluläres Adhäsionsmolekül
ICP-MS
Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
ICP-OES
Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
IgG
Immunglobulin G
IRMA
Immunoradiometrischer Assay
MHC
major histocompatibility complex
MW
Mittelwert
PTH
Parathormon
Pyd
Pyridinolin
RIA
Radioimmunoassay
S
Studie
1 Einleitung, Übersicht und Zielstellung
”Calcium ist die Achse, um die alles Leben rotiert und Phosphat liefert die Energie, um diese Achse zu drehen”. (TALMAGE 1995)
Die in letzter Zeit immer wieder auftretenden Diskussionen zum nicht gedeckten Calciumbedarf und einer den Bedarf übersteigenden Zufuhr an Phosphor machen Studien zur Erfassung der möglichen Folgen für den menschlichen Organismus erforderlich. Starke industrielle Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln, hoher Konsum proteinreicher Nahrungsmittel und gesteigerter Verzehr von Fast-Food-Produkten, bei sinkender Aufnahme von Milchprodukten sind die Ursachen für Calciummangel und Phosphorüberschuß in der Nahrung. Gelangte man früher durch Übertragung der Ergebnisse von Tierversuchen noch zu der Ansicht, daß Phosphormengen bis zu 6 g/Tag vom Menschen vertragen werden, hat man die maximal tolerierbare Menge heute bei 4 g P/Tag festgelegt (MONSEN 2000, ANONYM 1997). Langfristige exzessive Calcium/Phosphat-Imbalancen, sollen schon im Kindesalter das Entstehen von Rachitis begünstigen. Allerdings scheint nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Notwendigkeit zu bestehen, phosphorhaltige Lebensmittel zu meiden, um Störungen des Knochenmetabolismus vorzubeugen (ANONYM 2000). Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich unterschiedliche Phosphoraufnahmen, die sich zwischen der zur Bedarfsdeckung empfohlenen Zufuhr und der maximal tolerierbaren Menge bewegen, auf den menschlichen Stoffwechsel auswirken.
1.1 Übersicht
Phosphat ist zusammen mit Calcium der Hauptbestandteil des anorganischen Skelettanteiles. Im menschlichen Organismus sind 6,5 - 11 g Phosphor je Kilogramm Körpergewicht enthalten (ALOIA et al. 1984, DIEM 1979). Davon finden sich 85 % in den Knochen und die restlichen 15 % in den übrigen Geweben (DIEM 1979). Im Blut beträgt die Gesamtkonzentration an Phosphat 13 mmol/l (40 mg/dl), meist als Phospholipide der Erythrozyten, in den Lipoproteinen des Plasmas und 1 mmol/l (3,1 mg/dl) als anorganisches Phosphat. In Form von Phosphorsäureestern – als Bausteine von Nukleinsäuren und als Bestandteile von Phospholipiden und phosphorylierten Verbindungen – kommt der Phosphor in allen Organen und als Hydroxylapatit in allen kalkhaltigen Geweben vor. Phosphate sind für alle Lebensprozesse essentiell. Für die Bereitstellung und den Umsatz von Energie ist Adenosintriphosphat (ATP) die wichtigste Verbindung (FELDHEIM 1992). Im Muskelgewebe ist vor allem Kreatinphosphat, die phosphorylierte Form des Kreatins, neben ATP der wichtigste schnell verfügbare Energielieferant. Auch verschiedene aktive Vitamine liegen phosphoryliert vor, beispielsweise das Riboflavinphosphat, die Koenzymform des Vitamins B2 (ELMADFA & LEITZMANN 1990).
Phosphor ist einer der im Spektrum der Lebensmittel am weitesten verbreiteten Nährstoffe. Anorganische Phosphate kommen als natürliche Inhaltsstoffe v. a. in proteinreichen Lebensmitteln vor. Wesentliche Mengen werden mit Fleisch und Fleischwaren (24 %), Brot (14 %) und Käse (9 %) aufgenommen (Tabelle 1) (KASPER 1996).
Neben seinem natürlichen Gehalt in Lebensmitteln werden Phosphatkomponenten, wie Polyphosphate, den Lebensmitteln beim Verarbeiten zugesetzt (CALVO & HEATH 1988, CALVO & PARK 1996). Solche Nahrungsmittel sind zum Beispiel gefrorenes Fleisch, Schinken, behandelter Käse, Instantsuppen, Desserts, Soßen und kohlensäurehaltige Getränke. Phosphate dienen als pH-Regulatoren, Emulgatoren und Säurestabilisatoren, um Nährstoffverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu unterbinden.
Tabelle 1: Durchschnittswerte der Gehalte an Phosphaten in den einzelnen Lebensmitteln und Zusatzstoffen (Auswahl) (KOCH et al. 1996)
Mehrwertige Kationen, die z. B. für die Wasserhärte verantwortlich sind (Calcium und Magnesium) oder prooxidativ wirken (Eisen und Kupfer), sind durch Alkaliphosphate gut ausfällbar. Im Gegensatz zu Mono- und Diphosphaten, die weitgehend inerte Verbindungen darstellen, reagieren längerkettige Polyphosphate (Abbildung 1) mit mehrwertigen Kationen und bilden in Lösungen Komplexe. Weiterhin wirken Phosphate z. B. hemmend vor allem auf grampositive Mikroorganismen und verbessern die Rieselfähigkeit pulverförmiger meist hygroskopischer Lebensmittel. Durch Mineralstoffanreicherung von diätetischen Produkten, Kindernahrung und anderen Lebensmitteln werden besonders Calcium-, Magnesium- und Eisenphosphate physiologisch wirksam (KOCH et al. 1996).
Abbildung 1: Polyphosphat
Entsprechend neuen Zufuhrempfehlungen für Calcium und Phosphor der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist eine Zufuhr von 1000 mg Calcium für 19- bis 50-jährige ausreichend. Für Phosphor werden 700 mg pro Tag empfohlen (Tabelle 2) (DGE 2000).
Tabelle 2: Empfohlene Zufuhr für Calcium und Phosphor in mg/d (DGE 2000)
Ein nutritiver Phosphormangel ist infolge der reichlichen Zufuhr mit der Nahrung nicht bekannt, da praktisch alle Lebensmittel Phosphor enthalten. Dennoch kann, beispielsweise durch enterale oder parenterale Ernährung sowie durch phosphatbindende, aluminiumhaltige Antazida, Malabsorption oder Vitamin D-Mangel ein Phosphormangel auftreten, der sich in einer Hypophosphatämie manifestiert (WILZ et al. 1979, BUSHE 1986, DALE et al. 1986, KNOCHEL 1977). Chronische, moderate Hypophosphatämie kann zu Osteomalazie oder Rachitis führen. Die Symptome einer akute Hypophosphatämie (< 0,5 mmol/l) sind Skelett- und Kardiomyopathien, gefolgt von einer Rhabdomyolyse (Auflösung der quergestreiften Muskulatur) bis hin zur hämolytischen Anämie (BRINGHURST 1989) (Tabelle 3).
Als Folgen einer kurzzeitigen exzessiven Phosphoraufnahme können zeitweilig Magen- und Darmbeschwerden mit Übersäuerung, Blähungen und Durchfall auftreten (FELDHEIM 1981, BELL et al. 1977). Extrem hohe Gehalte im Blut mit einem Anstieg des anorganischen Phosphors in der Extrazellularflüssigkeit wurden nach Infusionen (HERBERT et al. 1966), phosphorhaltigen Diäten und oralen Phosphatsupplementationen oder aufgrund einer unzureichenden renalen Phosphorausscheidung bzw. durch eine hohe tubuläre Reabsorptionsrate (z. B. bei Hypoparathyreoidismus) beobachtet (NUSYNOWITZ et al. 1976). Eine Hyperphosphatämie wirkt sich in erster Linie auf das endokrine System aus, speziell die calcitrophischen Hormone PTH, Calcitonin und 1,25-Dihydroxycholecalciferol, und es kommt zu einem Abfall der Calciumkonzentration im Serum (CALVO 1993, CALVO et al. 1988 und 1990, ARNAUD & SANCHEZ 1990, REISS et al. 1970). Auf die genauen Wirkmechanismen der einzelnen Hormone soll später eingegangen werden. An dieser Stelle sei nur auf Abbildung 2 verwiesen.
Abbildung 2: Regulation des Calcium- und Phosphathaushaltes durch PTH, Calcitonin und Vitamin D3 (THEWS et al. 1991)
Das Absinken der Konzentration von Calcium unter dem Einfluß des Parathomons führt zu Knochenabbau und Skelettläsionen sowie Osteodystrophie und Tetanie (Tabelle 3; BRINGHURST 1989).
Tabelle 3: Häufige oder in Einzelfällen beobachtete Auswirkungen einer inadäquaten Phosphorzufuhr
Der Mechanismus der Phosphorabsorption besteht aus dem carriervermittelten (wahrscheinlich aktiven) Transport und dem linearen konzentrationsabhängigen Diffusionsprozeß. Die Phosphorabsorption ist auch bei stark schwankender Phosphoraufnahme praktisch konstant, was darauf hindeutet, daß die Absorption primär über passive konzentrationsabhängige Prozesse erfolgt (ANONYM 1997, ANDERSON 1991). Dabei kann die transzelluläre Phosphorabsorption durch 1,25-(OH)2D3 verbessert werden (CHEN et al. 1974, CRAMER 1961). Phosphor wird größtenteils als anorganisches Phosphat absorbiert. Zusätzlich hydrolysiert alkalische Phosphatase phosphorylierte Aminosäuren und Phosphonukleotide am Bürstensaum der Enterozyten und setzt auf diese Weise primär organisch gebundenes Phosphat frei (NORDIN 1976). Die Bioverfügbarkeit von Phosphor als anorganisches Phosphat (H2PO4- und HPO42-) ist hoch. Bei einem Nahrungsphosphorgehalt von täglich 4 - 30 mg/kg Frischsubstanz beträgt die Nettoabsorption von Phosphor 60 - 65 % der Aufnahme (LEMANN 1996, NORDIN 1989, STANBURY 1971) und liegt damit um das 2 - 3fache über der Nettoabsorption des Calciums mit 20 - 30 % (YANAGAWA et al. 1994). Die einzige Ausnahme bilden verschiedene Nahrungsphosphorzusätze, einschließlich Polyphosphate und Pyrophosphate, die im Gastrointestinaltrakt schlecht absorbiert werden (ANDERSON 1991). Die Ausscheidung des endogenen Phosphors geschieht hauptsächlich durch die Niere. Anorganisches Serumphosphat wird im Glomerulus (90 % des gesamten Phosphors im Blut) gefiltert und im proximalen Tubulus reabsorbiert (ca. 80 - 90 % des gefilterten Phosphors). Ein Großteil (ca. 60 - 75 %) dieser Reabsorption geschieht im proximalen Tubulus, aber auch im distalen und/oder corticalen Sammelkanal (BALES & DREZNER 1992). Beim Menschen ist die tubuläre Phosphorreabsorption charakterisiert durch ein Transportmaximum (TmP) (BALES & DREZNER 1992). Das TmP variiert indirekt mit der Konzentration des PTHs. Darüber hinaus steuert das PTH die renale Clearance anorganischen Phosphates. Übersteigt die gefilterte Menge das TmP, wird die renale Phosphorausscheidung an die Plasmakonzentration des Phosphors angepaßt (LEMANN 1996, NORDIN 1989, BIJVOET 1969). Im Gesunden entspricht der Phosphorgehalt im Urin in etwa dem absorbierten Nahrungsphosphor. Ermittelt wird die Phosphorabsorption im Menschen üblicherweise mittels Bilanzmethoden (YANAGAWA et al. 1994). Dabei wird die Differenz zwischen Phosphoraufnahme und fäkaler Phosphorausscheidung als Nettoabsorption bezeichnet.
Da der Phosphor ebenso wie das Calcium zum größten Teil im Skelett eingelagert ist, überrascht es nicht, daß langfristige Calcium/Phosphat-Imbalancen (Ca/PO4-Quotient < 0,25) osteoporotische Prozesse begünstigen (LUKERT et al. 1987, YANO et al. 1985, TYLAVSKY & ANDERSON 1988). Eine Untersuchung an 127 amerikanischen Kindern im Alter von 8 - 16 Jahren ergab, daß sich besonders der Konsum von Colagetränken durch deren hohen Gehalt an Phosphorsäure ungünstig auf die Knochengesundheit auswirkte. Je mehr Cola die Kinder tranken, desto häufiger kam es zu Knochenbrüchen (WHYSHAK et al. 1989). Auch Karies, offene Zahnhälse und Zahnausfall wurden beobachtet (JOHANSSON et al. 1997). Dabei scheinen diese Symptome eher eine Konsequenz niedriger Calciumaufnahmen und weniger durch das Phosphor per se hervorgerufen zu sein (ANONYM 1997). Eine Erhöhung der Calciumaufnahme sowie sportliche Aktivität erwiesen sich als präventiv (ZORBAS et al. 2000, WHYSHAK et al. 1989). Die Veränderungen im Knochenmetabolismus können anhand der Analyse von Knochenmarkern nachgewiesen werden (Abbildung 3). Die Pyridinium-Crosslinks Pyd und Dpyd





























