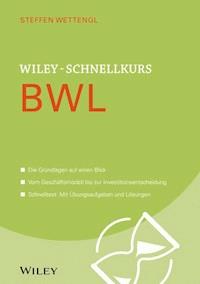17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Müssen Sie eine Einführungsveranstaltung in die Betriebswirtschaftslehre besuchen? Kommen Sie bei den vielen Begriffen und Ansätzen manchmal etwas durcheinander? Dann ist dieses Buch das richtige für Sie. Steffen Wettengl unterrichtet seit über 10 Jahren BWL und führt Sie so verständlich wie möglich in dieses Thema ein. Er erklärt, was Betriebe überhaupt sind, welche Ziele sie verfolgen und wie sie sich organisieren. Er erläutert, was Sie über Innovationsmanagement, Marketing, Beschaffung, Logistik und Produktionsmanagement wissen sollten. Den Abschluss dieses kompakten und schlüssigen Buchs bilden das externe und das interne Rechnungswesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d‐nb.de abrufbar.
1. Auflage 2018
© 2018 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Umschlaggestaltung: Torge Stoffers Graphik-Design, LeipzigCoverfoto: Olexiy/fotoliaKorrektur: Claudia Lötschert
ISBN Print: 978‐3‐527‐53046‐5ePub: 978-3-527-81952-2Mobi: 978-3-527-81953-9
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Einführung
Teil I: Basiswissen über Betriebe und Unternehmen:
1 Betriebe und Unternehmen
1.1 Merkmale von Betrieben
1.2 Arten von Betrieben und Unternehmen
1.3 Betriebe und ihre Umwelt
1.4 Branchenentwicklung als Lebenszyklus
1.5 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
2 Leitbildelemente, Strategien, Geschäftsmodelle
2.1 Elemente der normativen Unternehmensführung
2.2 Unternehmensstrategien
2.3 Geschäftsmodelle
2.4 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
3 Rechtsformen von Unternehmen
3.1 Rechtsbegriffe und Rechtsformen
3.2 Einzelunternehmen und Personengesellschaften
3.3 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
3.4 Verschachtelte Rechtsformen
3.5 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
4 Unternehmensverbindungen
4.1 Unternehmensverbindungen in Konzernen und Kooperationen
4.2 Übernahme von Unternehmen
4.3 Gründung neuer Konzernunternehmen
4.4 Kooperationen zwischen Unternehmen
4.5 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
Teil II: Managementaufgaben:
5 Planung und Kontrolle
5.1 Planung und Kontrolle im Führungsprozess
5.2 Prozess der strategischen Planung und Kontrolle
5.3 Instrumente der strategischen Planung und Kontrolle
5.4 Operativ‐mittelfristige Planung und Kontrolle
5.5 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
6 Organisation
6.1 Grundlagen der Organisation
6.2 Organisation nach Verrichtungen und nach Objekten
6.3 Komplexe Organisationsstrukturen
6.4 Organisation von Geschäftsprozessen
6.5 Organisatorische Integration
6.6 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
7 Mitarbeiterführung und Personalmanagement
7.1 Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter
7.2 Mitarbeiter in Gruppen
7.3 Führungskräfte und Führungsstile
7.4 Rahmenbedingungen von Führungsbeziehungen
7.5 Personelle Veränderungs‐ und Entwicklungsmaßnahmen
7.6 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
Teil III: Betriebliche Kernaufgaben:
8 Innovationsmanagement
8.1 Innovationen und Innovationsmanagement
8.2 Technologiewechsel als Phasenprozesse
8.3 Marktchancen neuer Technologien erkennen
8.4 Timingstrategien und Schutzrechte im Innovationswettbewerb
8.5 Organisation von F&E‐Aktivitäten
8.6 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
9 Produktions‐ und Beschaffungsmanagement
9.1 Ziele und Gestaltungsfaktoren
9.2 Typen von Produktionssystemen
9.3 Kostenbeeinflussung durch Gestaltung des Produktionsprogramms
9.4 Organisation der Leistungserstellung
9.5 Technikeinsatz bei der Leistungserstellung
9.6 Beschaffungsmanagement
9.7 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
10 Marketing
10.1 Kunden im Zentrum von Marketingaktivitäten
10.2 Markenstrategien
10.3 Programm‐ und Produktpolitik
10.4 Preispolitik
10.5 Vertriebspolitik
10.6 Kommunikationspolitik
10.7 Marktforschung
10.8 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
Teil IV: Rechnungswesen und Finanzwirtschaft:
11 Grundlagen des Rechnungswesens
11.1 Teilgebiete des Rechnungswesens
11.2 Wichtige Rechengrößen
11.3 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
12 Externes Rechnungswesen
12.1 Grundlagen der HGB‐Rechnungslegung
12.2 Bilanz
12.3 Gewinn‐ und Verlustrechnung
12.4 Konsolidierter Konzernabschluss
12.5 International Financial Reporting Standards
12.6 Bilanzanalyse
12.7 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
13 Kosten‐ und Leistungsrechnung
13.1 Kostenkategorien
13.2 Vollkostenrechnung im dreistufigen Kostenrechnungssystem
13.3 Kostenrechnung mit Deckungsbeiträgen
13.4 Break‐Even‐Analyse
13.5 Plankostenrechnung
13.6 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
14 Investitionsplanung
14.1 Investitionen
14.2 Statische Methoden der Investitionsrechnung
14.3 Dynamische Methoden der Investitionsrechnung
14.4 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
15 Finanzierung und Finanzplanung
15.1 Finanzierungsziele und ‐maßnahmen
15.2 Formen der Außenfinanzierung
15.3 Formen der Innenfinanzierung
15.4 Finanzanalyse
15.5 Finanzplanung
15.6 Wissensfragen ▪ Übungsaufgaben ▪ Literatur
16 Lösungen der Übungsaufgaben
16.1 Zu Kapitel 1: Betriebe und Unternehmen
16.2 Zu Kapitel 2: Leitbildelemente, Strategien, Geschäftsmodelle
16.3 Zu Kapitel 3: Rechtsformen
16.4 Zu Kapitel 4: Unternehmensverbindungen
16.5 Zu Kapitel 5: Planung und Kontrolle
16.6 Zu Kapitel 6: Organisation
16.7 Zu Kapitel 7: Mitarbeiterführung und Personalmanagement
16.8 Zu Kapitel 8: Innovationsmanagement
16.9 Zu Kapitel 9: Produktions‐ und Beschaffungsmanagement
16.10 Zu Kapitel 10: Marketing
16.11 Zu Kapitel 11: Grundlagen des Rechnungswesens
16.12 Zu Kapitel 12: Externes Rechnungswesen
16.13 Zu Kapitel 13: Kosten‐ und Leistungsrechnung
16.14 Zu Kapitel 14: Investitionsplanung
16.15 Zu Kapitel 15: Finanzierung und Finanzplanung
Abkürzungen
Glossar
Literatur
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1 Häufige Merkmale des Konsumgüter‐ und des Industriegütergeschäfts
Tabelle 1.2 Kennzahlen unterschiedlicher Wirtschaftszweige in Deutschland, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Tabelle 1.3 Kapitaleinsatz je Erwerbstätigen (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Tabelle 1.4 Kennzahlen zum Vergleich von Betrieben
Tabelle 1.5 Deutsche Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Tabelle 1.6 Typische Merkmale der Entstehungs‐, Wachstums‐ und Reifephase von Industrien
Tabelle 1.7 Informationen für den Unternehmensvergleich
Kapitel 2
Tabelle 2.1 Beispiel einer Nutzwertanalyse zur Standortbewertung
Kapitel 3
Tabelle 3.1 Statistische Daten zu ausgewählten Rechtsformen deutscher Unternehmen, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Tabelle 3.2 Unternehmerische Mitbestimmung im Aufsichtsrat (AR)
Tabelle 3.3 Vor‐ und Nachteile einer GmbH gegenüber einer AG
Kapitel 4
Tabelle 4.1 Formen von Konzernen
Kapitel 5
Tabelle 5.1 Ebenen der Unternehmensplanung
Tabelle 5.2 Formen des Benchmarking
Tabelle 5.3 Planungsdaten zu vier strategischen Geschäftsfeldern
Kapitel 6
Tabelle 6.1 Vor‐ und Nachteile einer divisionalen Organisation (vgl. Schreyögg 2008, S. 120)
Tabelle 6.2 Ausgewählte Möglichkeiten zur Veränderung von Geschäftsprozessen
Kapitel 7
Tabelle 7.1 Theorie‐X‐ und Theorie‐Y‐Menschenbild von McGregor (vgl. Schirmer/Woydt 2016, S. 72 f.)
Tabelle 7.2 Vor‐ und Nachteile einer starken Arbeitsteilung (vgl. Pfeiffer/Dörrie/Stoll 1977, S. 65 ff.)
Kapitel 8
Tabelle 8.1 Vergleich inkrementeller und radikaler Innovationen
Tabelle 8.2 Ausgewählte Schutzrechte in Deutschland (Quelle: DPMA)
Kapitel 9
Tabelle 9.1 Standortvorteile im Vergleich
Tabelle 9.2 Arbeitskosten in der Industrie in ausgewählten Ländern, Stand: 2015 (Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft)
Tabelle 9.3 Ausgewählte Vorteile von Fremdbezug und Eigenfertigung
Kapitel 10
Tabelle 10.1 Segmente des Markts für Modelleisenbahnen
Tabelle 10.2 Ausgewählte Wirkungen von Marken auf der Anbieter‐ und Kundenseite
Kapitel 11
Tabelle 11.1 Bereiche des Rechnungswesens
Tabelle 11.2 Geschäftsvorfälle und ihre Wirkungen auf Vermögensgrößen
Kapitel 12
Tabelle 12.1 IFRS und HGB in Deutschland (vgl. Coenenberg/Haller/Schultze 2016, S. 14)
Tabelle 12.2 Umsatzerlöse der Segmente des Deutsche‐Telekom‐Konzerns (Geschäftsjahr 2015, in Millionen Euro)
Tabelle 12.3 Unterschiede zwischen HGB und IFRS
Tabelle 12.4 Beispiel für den Leverage‐Effekt
Kapitel 13
Tabelle 13.1 Kalkulation für zwei Pralinenmischungen
Tabelle 13.2 Erlöse und Kosten eines Fahrradherstellers
Kapitel 14
Tabelle 14.1 Beispiel einer Kostenvergleichsrechnung
Tabelle 14.2 Beispiel einer integrierten Gewinn‐ und Rentabilitätsvergleichsrechnung
Tabelle 14.3 Vollständiger Finanzplan (VoFi) für eine Beispielinvestition
Tabelle 14.4 Unvollständige Kostenvergleichsrechnung
Tabelle 14.5 Ein‐ und Auszahlungen bei einer Investition (Übungsaufgabe)
Tabelle 14.6 Zahlungsreihe einer Investition (Übungsaufgabe)
Kapitel 15
Tabelle 15.1 Außerbörsliches Beteiligungskapital (Private Equity)
Tabelle 15.2 Beispiele für Unternehmensanleihen
Tabelle 15.3 Ratingskalen führender Ratingagenturen
Tabelle 15.4 Bewertung eines kreditfinanzierten Kaufs (Beispiel)
Tabelle 15.5 Bewertung einer Leasingfinanzierung (Beispiel)
Tabelle 15.6 Beispiel für den Kapazitätserweiterungseffekt
Tabelle 15.7 Beispiel eines Finanzplans
Tabelle 15.8 Insolvenzen nach Unternehmensalter 2016 (Quelle: Creditreform Wirtschaftsforschung)
Kapitel 16
Tabelle 16.1 Industrie‐ und Dienstleistungsunternehmen im Vergleich, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Tabelle 16.2 Geschäftsvorfälle und ihre Wirkungen auf Vermögensgrößen
Tabelle 16.3 Kostenvergleichsrechnung
Tabelle 16.4 Vollständiger Finanzplan für eine Investition
Tabelle 16.5 Bewertung eines kreditfinanzierten Kaufs
Tabelle 16.6 Bewertung einer Leasingfinanzierung
Tabelle 16.7 Beispiel für den Kapazitätserweiterungseffekt
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1 Elementare Produktionsfaktoren in Betrieben
Abbildung 1.2 Leistungserstellungs‐ und Finanzbereich eines Betriebs
Abbildung 1.3 Merkmale von Unternehmen und öffentlichen Betrieben
Abbildung 1.4 Arten von Wirtschaftsgütern
Abbildung 1.5 Allgemeine und marktliche Unternehmensumwelt
Abbildung 1.6 Ausgewählte Einflussfaktoren aus marktlichen Umfeldern
Abbildung 1.7 Industrielebenszyklus
Kapitel 2
Abbildung 2.1 Ebenen der Unternehmensführung
Abbildung 2.2 Arten von Unternehmenszielen im Zielsystem
Abbildung 2.3 Ansoffs Produkt‐Markt‐Matrix mit Wachstumsstrategien (Quelle: Ansoff 1956, S. 114, ergänzt)
Abbildung 2.4 Ausgewählte Einflussfaktoren auf die Standortwahl
Abbildung 2.5 Gestaltungsmöglichkeiten der Internationalisierungsstrategie
Abbildung 2.6 Business Model Canvas zur Darstellung von Geschäftsmodellen (in Anlehnung an Osterwalder/Pigneur 2010 und Schallmo 2013, S. 52)
Abbildung 2.7 Treiber der Digitalen Transformation (Quellen: Roland Berger Strategy Consultants/BDI 2015 und Schallmo 2016, S. 32)
Abbildung 2.8 Produktspektrum beim Long Tail‐Geschäftsmodell
Kapitel 3
Abbildung 3.1 Ausgewählte Rechtsformen von Unternehmen (vgl. Klunzinger 2012, S. 1, 4)
Abbildung 3.2 Auswirkungen der Rechtsform eines Unternehmens
Abbildung 3.3 Organe einer Aktiengesellschaft und ihre Aufgaben
Abbildung 3.4 Aufsichtsrat und Vorstand der BMW AG, Stand: Ende 2015
Abbildung 3.5 Organe einer GmbH und ihre Aufgaben
Abbildung 3.6 Beispiel einer »klassischen« GmbH & Co. KG
Abbildung 3.7 Beziehungen zwischen Eigentümern und Organen einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (vgl. Wöhe/Döring/Brösel 2016, S. 223)
Abbildung 3.8 Vorstand und Aufsichtsrat der fiktiven Industrie AG (Achtung! Abbildung enthält Fehler)
Kapitel 4
Abbildung 4.1 Strategische Netzwerkgestaltung
Abbildung 4.2 Unternehmensverbindungen zwischen »Markt« und »Hierarchie«
Abbildung 4.3 Beteiligungsformen und wichtige Kontrollschwellen
Abbildung 4.4 Personelle Verflechtungen zwischen verbundenen Unternehmen
Abbildung 4.5 Ausschnitt des Volkswagen‐Konzerns, Stand: Ende 2016
Abbildung 4.6 Phasen einer Unternehmensübernahme
Abbildung 4.7 Formen kooperativer Unternehmensverbindungen
Abbildung 4.8 Fiktiver Drive‐Konzern (Achtung! Abbildung enthält Fehler)
Kapitel 5
Abbildung 5.1 Allgemeiner Management‐ und Führungsprozess
Abbildung 5.2 Strategische Planung und Kontrolle
Abbildung 5.3 Szenarien als mögliche Zukunftsentwicklungen
Abbildung 5.4 BCG‐Portfolio (Marktwachstums‐Marktanteils‐Portfolio)
Abbildung 5.5 Perspektiven des Balanced‐Scorecard‐Konzepts (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 9, Hungenberg 2014, S. 310)
Abbildung 5.6 Typische Elemente der Jahresplanung
Abbildung 5.7 Abstimmungsrichtungen im Budgetierungsprozess
Kapitel 6
Abbildung 6.1 Beispiel eines Organigramms
Abbildung 6.2 Funktionale Organisation der Porsche AG mit sechs Funktionen
Abbildung 6.3 Einseitige Kommunikation zwischen Funktionalbereichen (vgl. Ehrlenspiel et al. 2014, S. 31)
Abbildung 6.4 Beispiele einer Organisation nach Objekten
Abbildung 6.5 Organisation des Entwicklungsbereichs eines Industrieunternehmens (Beispiel)
Abbildung 6.6 Beispiel einer zweidimensionalen Matrixorganisation
Abbildung 6.7 Divisionale Organisation der Bosch‐Gruppe (Stand: Ende 2016)
Abbildung 6.8 Beispiel eines Geschäftsprozesses (vgl. Gadatsch 2017, S. 5)
Abbildung 6.9 Instrumente der organisatorischen Integration
Abbildung 6.10 Integration durch eine übergeordnete Stelle oder Selbstabstimmung (Beispiel)
Kapitel 7
Abbildung 7.1 Mitarbeiterführung als Einflussprozess
Abbildung 7.2 Zwei‐Faktoren‐Theorie von Frederick Herzberg (vgl. Lieber 2011, S. 32)
Abbildung 7.3 Führungstheorien und ‐konzepte im Überblick (Quelle: Lieber 2011, S. 101, leicht verändert)
Abbildung 7.4 Erweiterung des Handlungsspielraums
Abbildung 7.5 Personalfreisetzung
Teil III
Abbildung 8.1 Michael Porters Wertkette betrieblicher Funktionen (Porter 1985, S. 37)
Kapitel 8
Abbildung 8.1 Phasen des Innovationsmanagements
Abbildung 8.2 S‐Kurven‐Konzept (in Anlehnung an: Foster 1986, S. 119)
Abbildung 8.3 Technologiewechsel als disruptive Innovation (in Anlehnung an: Christensen 1997, S. XVI)
Abbildung 8.4 Rogers Modell der Adoption einer neuen Technologie (in Anlehnung an: Rogers 2003, S. 281)
Abbildung 8.5 Technischer Fortschritt und weltweite Diffusion von ESP‐Systemen (Quelle: Bosch)
Abbildung 8.6 Relevante Technologien zum Autorisieren zugangsberechtigter Personen (Quelle: Pfeiffer et al. 1997, S. 168).
Abbildung 8.7 Organisationsformen für Innovationsprojekte
Abbildung 8.8 Organisationsformen internationaler F&E‐Aktivitäten (Quelle: Gassmann 1997, S. 34)
Kapitel 9
Abbildung 9.1 Gestaltungsfaktoren des Produktions‐ und Beschaffungsmanagements
Abbildung 9.2 Produktionssysteme mit unterschiedlichen Entkopplungspunkten (EP)
Abbildung 9.3 Kennzeichen der kundenindividuellen Massenproduktion (vgl. Reichwald/Piller 2009, S. 227)
Abbildung 9.4 Kostenentstehung und Kostenbeeinflussung (leicht verändert nach: Ehrlenspiel et al. 2017, S. 15)
Abbildung 9.5 Kostenvorteile durch Mengen‐ und Verfahrensdegression
Abbildung 9.6 Erfahrungskurven‐Konzept
Abbildung 9.7 Kalkulation mit dem Erfahrungskurven‐Konzept
Abbildung 9.8 Gestaltung von Produktionsnetzwerken (vgl. Friedli/Thomas/Mundt 2013, S. 92)
Abbildung 9.9 Organisationstypen der Produktion
Abbildung 9.10 Mögliche Funktionen technischer Systeme
Abbildung 9.11 Vom mechanischen Webstuhl zur Smart Factory (Quelle: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz)
Abbildung 9.12 Fertigungstiefe und Lieferantenbasis (Quelle: Fraunhofer‐Institut für System‐ und Innovationsforschung)
Kapitel 10
Abbildung 10.1 Customer Journey mit Kontaktpunkten
Abbildung 10.2 Markenarchitektur von BMW (Stand: Mitte 2017)
Abbildung 10.3 Gestaltung des Produktprogramms auf verschiedenen Ebenen
Abbildung 10.4 Produktlebenszyklus und produktpolitische Maßnahmen
Abbildung 10.5 Preis‐Absatz‐Funktionen
Abbildung 10.6 Ermittlung des optimalen Preises
Abbildung 10.7 Preisstrategien
Abbildung 10.8 Bereiche der Vertriebspolitik
Abbildung 10.9 Vertriebssysteme
Abbildung 10.10 Einflussfaktoren auf die Vertriebsform
Abbildung 10.11 Sender‐Empfänger‐Modell der Kommunikationspolitik
Abbildung 10.12 Tägliche Nutzungsdauer tagesaktueller Medien in Minuten, Personen ab 14 Jahren (Quelle: ARD/ZDF)
Abbildung 10.13 Elemente einer crossmedialen Kommunikationspolitik
Abbildung 10.14 Ausgewählte Werbeträger und ‐formen
Abbildung 10.15 Methoden der Datenerhebung
Abbildung 10.16 Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen der Alphabet/Google‐Gruppe
Abbildung 10.17 Preis‐Absatz‐Funktion und Kalkulation
Kapitel 11
Abbildung 11.1 Wichtige Vermögens‐ und Rechengrößen des Rechnungswesens
Abbildung 11.2 Aufwendungen und Kosten
Abbildung 11.3 Erträge und Leistungen (Erlöse)
Abbildung 11.4 Auswirkungen von Geschäftsvorfällen auf Rechengrößen (Beispiel)
Abbildung 11.5 Geschäftsvorfälle rund um die Herstellung von Winkelschleifern
Kapitel 12
Abbildung 12.1 Lagebericht und Teile des Jahresabschlusses
Abbildung 12.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung (GoB)
Abbildung 12.3 Aufbau der Bilanz mit wesentlichen Bilanzpositionen (nach HGB)
Abbildung 12.4 Entstehung von Goodwill bei einer Übernahme
Abbildung 12.5 Plan‐ und außerplanmäßige Abschreibungen bei einer Maschine
Abbildung 12.6 Bilanz der FC Bayern München AG
Abbildung 12.7 Teilergebnisse in der Gewinn‐ und Verlustrechnung
Abbildung 12.8 Aufbau der Gewinn‐ und Verlustrechnung (nach HGB)
Abbildung 12.9 Gesamtkosten‐ und Umsatzkostenverfahren führen zum selben Jahresergebnis
Abbildung 12.10 Gewinn‐ und Verlustrechnung der FC Bayern München AG
Abbildung 12.11 Ausgewählte Informationen aus dem Jahresabschluss der Alpha GmbH
Abbildung 12.12 Kennzahlen zur Geschäftstätigkeit
Abbildung 12.13 Working‐Capital‐Kennzahlen im Zusammenhang
Abbildung 12.14 Kennzahlen zur Rentabilität
Abbildung 12.15 Eigenkapitalrendite einer Geldanlage
Abbildung 12.16 Ausgewählte Informationen aus dem Jahresabschluss der Delta AG
Kapitel 13
Abbildung 13.1 Kostenverläufe
Abbildung 13.2 Gesamtkosten und Durchschnittskosten
Abbildung 13.3 Betriebsergebnisrechnung auf Basis einer dreistufigen Kostenrechnung
Abbildung 13.4 Kostenarten im Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie und Arten kalkulatorischer Kosten
Abbildung 13.5 Beispiel für kalkulatorische und bilanzielle Abschreibungen
Abbildung 13.6 Beispiel eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB)
Abbildung 13.7 Gemeinkostenzuschlagssätze im Beispielunternehmen
Abbildung 13.8 Beispiel für die Kalkulation der Selbstkosten mit Zuschlagssätzen
Abbildung 13.9 Beispiel einer Betriebsergebnisrechnung (in Millionen Euro)
Abbildung 13.10 Beispiel einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung (in Millionen Euro)
Abbildung 13.11 Grafische Break‐Even‐Analysen
Abbildung 13.12 Flexible Plankostenrechnung mit Beispiel
Abbildung 13.13 Unvollständiger Betriebsabrechnungsbogen
Kapitel 14
Abbildung 14.1 Statische Amortisationsrechnung
Abbildung 14.2 Barwert und Endwert
Abbildung 14.3 Barwert einer Einzahlungsreihe (in Euro)
Abbildung 14.4 Beispiel Kapitalwertmethode
Abbildung 14.5 Einfluss des Kalkulationszinssatzes auf den Kapitalwert (Kapitalwertfunktion)
Kapitel 15
Abbildung 15.1 Bilanzielle Auswirkungen finanzierungsrelevanter Vorgänge (vgl. Bieg/Kußmaul/Waschbusch 2016, S. 15)
Abbildung 15.2 Maßnahmen zur Außen‐ und Innenfinanzierung
Abbildung 15.3 Märkte und Segmente der Deutschen Börse
Abbildung 15.4 Beispiel eines Lieferantenkredits
Abbildung 15.5 Formen des Crowdfundings
Abbildung 15.6 Factoring‐Beispiel
Abbildung 15.7 Komponenten der Kapitalflussrechnung
Abbildung 15.8 Kapitalflussrechnungen der FC Bayern München AG
Abbildung 15.9 Liquiditätsgrade
Abbildung 15.10 Weitere Finanzkennzahlen
Abbildung 15.11 »Tal des Todes« zwischen Gründungs‐ und Wachstumsphase
Abbildung 15.12 Lösungsrahmen
Kapitel 16
Abbildung 16.1 Produkt‐Markt‐Matrix mit Beispielen
Abbildung 16.2 Unternehmensverbindungen im strategischen Netzwerk von ASML und seinen Partnern
Abbildung 16.3 BCG‐Portfolio mit vier strategischen Geschäftsfeldern (SGF)
Abbildung 16.4 Ausgewählte BSC‐Kennzahlen in einem Autohaus
Abbildung 16.5 Divisionale Organisation des fiktiven EAS‐Konzerns
Abbildung 16.6 Automatisierte Fahrzeugsteuerung als disruptive Innovation
Abbildung 16.7 Stückkostenrückgang
Abbildung 16.8 Preis‐Absatz‐Funktion und Kalkulation
Abbildung 16.9 Zahlungsströme bei einem cash‐positiven laufenden Betrieb
Abbildung 16.10 Jahresabschluss der Schokomaxx AG
Abbildung 16.11 Kalkulation der Selbstkosten eines neuen Produkts
Abbildung 16.12 Betriebsabrechnungsbogen
Abbildung 16.13 Grafische Break‐Even‐Analyse mit zwei Fertigungskonzepten
Abbildung 16.14 Ermittlung des Kapitalwerts
Abbildung 16.15 Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
3
4
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
442
443
444
445
446
447
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
461
462
463
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
E1
Einführung
Seit Langem ist Betriebswirtschaftslehre der in Deutschland am stärksten nachgefragte Studiengang. Trotzdem gibt es oft Kritik. Die Inhalte vieler Vorlesungen und Seminare seien realitätsfern, oft zu mathematisch und insgesamt kaum zukunftstauglich. Außerdem bemängeln Studierende die häufig langatmige und schwer verständliche Sprache betriebswirtschaftlicher Texte. Beim Schreiben hatte ich das Ziel, dass Ihr Urteil über dieses Buch anders ausfällt.
Die Zielgruppe dieses Buchs sind Leser, die eine fundierte und gut verständliche Darstellung grundlegender BWL‐Inhalte suchen. Dazu zählen BWLer, Studierende mit einem Anteil BWL im Studium wie Wirtschaftsingenieure, aber auch Nicht‐Betriebswirte, die für ihren Berufsalltag ein solides BWL‐Fundament gebrauchen können oder im Lauf ihres Ingenieur‐, Mathematik‐ oder Jurastudiums an BWL‐Vorlesungen teilnehmen.
Aufbau dieses Buchs
Dieses Buch ist in vier Teile gegliedert: Teil 1 liefert Informationen über Betriebe und Unternehmen sowie ihre Strategien und Geschäftsmodelle. Zu den Grundlagen gehören auch die Themengebiete Rechtsformen und Unternehmensverbindungen. In Teil 2 erfahren Sie mehr über die wesentlichen Managementaufgaben: Planen, Entscheiden, Kontrollieren, Organisieren und Führen von Mitarbeitern. Teil 3 macht Sie mit den Kernfunktionen eines Unternehmens vertraut: Leistungen erstellen und vermarkten, Innovationen vorbereiten. Zum Schluss darf ein umfassender Blick ins betriebliche Rechnungs‐ und Finanzwesen nicht fehlen (Teil 4).
In diesem Buch gibt es wiederkehrende Elemente:
Alle Kapitel beginnen mit einer kurzen Vorschau auf die wichtigsten Inhalte
(»In diesem Kapitel …«)
und enden mit einer halb‐ bis ganzseitigen Zusammenfassung der Kerninhalte
(»Auf einen Blick«)
.
In Kästchen werden
zahlreiche Beispiele
erläutert, um die Theoriebausteine zu veranschaulichen. Es gibt auch Texteinschübe mit Tipps und Hinweisen
(»Tipp«)
oder einer kleinen Zusatzgeschichte
(»Zusatzinformation«)
.
Die
großen grauen Kästen
kennzeichnen weiterführende Erläuterungen und Fallstudien. Diese Abschnitte runden die Inhalte des Haupttexts ab, können aber von eiligen Lesern übersprungen werden.
Mit
Wissensfragen und Übungsaufgaben
können Sie nach jedem Kapitel Ihr Wissen und inhaltliches Verständnis testen. Ausführliche
Lösungshinweise
finden Sie nach dem letzten Kapitel.
Wenn Ihnen ein einzelner Begriff unklar ist, hilft vielleicht ein Blick in das Glossar. Dort werden rund 100 Fachbegriffe aus der BWL‐Welt kurz erläutert.
Aus Gründen der Lesbarkeit habe ich auf die gleichzeitige Verwendung von männlichen und weiblichen Bezeichnungen und auf Kombinationen wie Kund(inn)en oder ManagerInnen verzichtet. An vielen Stellen finden Sie die männliche Form. Gemeint sind immer beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung.
Extraportion BWL
Haben Sie einen Fehler entdeckt oder möchten Sie eine Frage stellen? Bitte schreiben Sie Ihre Hinweise an: [email protected].
Sie sind auch herzlich eingeladen, meinen Blog »Updates« zu besuchen. Auf wettengl.info erscheinen Postings mit einer Mischung aus aktuellen Beispielen und Theoriebausteinen. Die Themen kommen vor allem aus der allgemeinen BWL und den Bereichen Marketing und Innovationsmanagement.
Dank und Widmung
Meiner Familie danke ich sehr herzlich für die aufmunternd‐freundliche Atmosphäre, in der ich zwischen Anfang 2016 und Ende 2017 regelmäßig an diesem Buch arbeiten konnte.
Gewidmet ist dieses Buch Dr.‐Ing. Martin Steppler (1969‐2013).
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen.
Steffen Wettengl, Ulm
Teil I:Basiswissen über Betriebe und Unternehmen
Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) ist eine praxisorientierte Wissenschaft, die sich mit Betrieben befasst. Im 1. Kapitel geht es darum, was ein Betrieb ist und was in Betrieben und um sie herum passiert. Durch die Kombination von Produktionsfaktoren entstehen in Betrieben Wirtschaftsgüter. Betriebe lassen sich anhand ihrer Größe, der von ihnen produzierten Leistungen und weiterer Merkmale genauer beschreiben. In marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen gehören die meisten Betriebe privaten Eigentümern. Man spricht von Unternehmen.
Wirtschaftliches Handeln geschieht in Unternehmen auf mehreren Ebenen. Die Grundsatzentscheidungen fallen an der Unternehmensspitze und betreffen das Leitbild, Strategien und Geschäftsmodelle. Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit Entscheidungen über die langfristige Entwicklungsrichtung eines Unternehmens.
Die Rechtsform gibt einem Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, zum Beispiel als Aktiengesellschaft oder GmbH. Zur Auswahl stehen sehr unterschiedliche Alternativen. Die Wahl der Rechtsform hat erhebliche Auswirkungen. Betroffen sind beispielsweise die Gründungsvoraussetzungen, die Schuldenhaftung der Eigentümer und die Besteuerung der Unternehmensgewinne. Das 3. Kapitel liefert Informationen über die Merkmale, die Vor‐ und die Nachteile wichtiger Unternehmensrechtsformen.
Unternehmen knüpfen Verbindungen zu anderen Unternehmen. Ein Konzern ist eine Gruppe von Unternehmen, die zwar rechtlich selbstständig sind, aber unter der Leitung einer Muttergesellschaft stehen. Unternehmen können auch durch kooperative Beziehungen mit anderen Marktakteuren verbunden sein, zum Beispiel mit Lieferanten oder Händlern. Unternehmensverbindungen in Konzernen und Kooperationen sind Thema des 4. Kapitels.
1Betriebe und Unternehmen
In diesem Kapitel erfahren Sie mehr …
über die Merkmale von Betrieben und von Unternehmen
über Produktionsfaktoren und wirtschaftliches Handeln
über die Besonderheiten von Dienstleistungen, Sachgütern und Leistungsbündeln
über die marktliche und die allgemeine Umwelt von Betrieben
über die typischen Etappen, in denen sich Märkte entwickeln
In der Betriebswirtschaftslehre geht es um Betriebe und wirtschaftliches Verhalten. Im ersten Kapitel dieses Buchs erfahren Sie, was ein Betrieb ist und was ihn kennzeichnet.
1.1 Merkmale von Betrieben
Ein Betrieb ist ein sozio‐technisches System, in dem Produktionsfaktoren zielgerichtet kombiniert werden. Die Mitarbeiter nutzen Betriebsmittel, um Sachgüter zu erzeugen und abzusetzen oder Dienstleistungen zu erbringen.
Die drei wesentlichen allgemeinen Kennzeichen eines Betriebs sind:
In Betrieben werden
Produktionsfaktoren
kombiniert. Die drei elementaren Produktionsfaktoren sind (a) menschliche Arbeit, (b) Betriebsmittel und (c) laufender – materieller und energetischer – Input. Ihr Einsatz wird durch den sogenannten dispositiven Faktor gelenkt (dispositiv = anordnend).
Betriebe müssen Einzahlungsüberschüsse bzw. mindestens ein
finanzielles Gleichgewicht
erreichen (Einzahlungen ≥ Auszahlungen).
In Betrieben wird das
wirtschaftliche Prinzip,
das auch ökonomisches Prinzip genannt wird, angewendet. Man versucht entweder den Aufwand zu minimieren (Minimalprinzip) oder das Ergebnis zu maximieren (Maximalprinzip).
Diese drei Merkmale werden in den folgenden Abschnitten erläutert.
1.1.1 Produktionsfaktoren in Betrieben
In einem Betrieb werden drei Produktionsfaktoren eingesetzt, die auch als Elementarfaktoren bezeichnet werden. Abbildung 1.1 enthält zwei Fotos, die jeweils eine alltägliche Situation in einem Industrie‐ und einem Dienstleistungsbetrieb zeigen. In beiden Fällen sind die drei Produktionsfaktoren zu erkennen:
Abbildung 1.1 Elementare Produktionsfaktoren in Betrieben
Mitarbeiter und Führungspersonen
leisten
menschliche Arbeit
. Die beiden Arbeiter auf dem linken Foto sind im Leipziger Werk des Autoherstellers BMW damit beschäftigt, das Dachteil auf der Karosserie eines i3‐Elektrofahrzeugs zu montieren. Die Dame auf dem zweiten Foto arbeitet in einer Apotheke.
Maschinen, Werkzeuge, Computer etc
. werden über einen längeren Zeitraum als
Betriebsmittel
eingesetzt. Sie geben im Zuge der Produktion von Sachgütern und der Realisierung von Dienstleistungen ihr jeweiliges Leistungspotenzial ab. BMW investierte für die Betriebsmittel der i3‐Fertigung in Leipzig rund 400 Millionen Euro. Zu den Betriebsmitteln in der Apotheke zählen die Möbel, das Kassensystem und die Alarmanlage.
Für die Leistungserstellung brauchen Betriebe außerdem noch einen
laufenden Input
. Betriebe beziehen von ihren Lieferanten
Rohstoffe
und
Bauteile
, die verbraucht oder verbaut werden. Der laufende Input einer Apotheke besteht vor allem in Medikamenten und Heilmitteln. Außerdem ist in Betrieben
Energie
erforderlich, zum Beispiel für den Einsatz von Elektrowerkzeugen. Für den laufenden Input gibt es auch die Bezeichnung
Werkstoffe
.
Die beiden Produktionsfaktoren menschliche Arbeit und Betriebsmittel sind Potenzialfaktoren. Durch Personal und Betriebsmittel wird eine Obergrenze für das Leistungsvermögen eines Betriebs festlegt. Diese Obergrenze nennt man Kapazität. Die beiden Potenzialfaktoren reichen für die Leistungserstellung nicht aus. Der laufende Input kommt als Verbrauchsfaktor hinzu.
In Abbildung 1.2 werden die drei beschriebenen elementaren Produktionsfaktoren in einen größeren Zusammenhang eingeordnet. Die Leistungserstellung ist auf die Sachgüter und Dienstleistungen gerichtet, die von Kunden nachgefragt werden. Eine zweite »Sphäre« der Unternehmenstätigkeit bildet der Finanzbereich mit den Geldströmen, die dem Unternehmen zufließen bzw. zu seinen Lasten abfließen.
Abbildung 1.2 Leistungserstellungs‐ und Finanzbereich eines Betriebs
Der Einsatz der drei elementaren Produktionsfaktoren wird in einem Betrieb mehr oder weniger organisiert bzw. gesteuert. Diese Organisations‐ und Lenkungsaktivitäten stellen einen weiteren Produktionsfaktor dar, den dispositiven Faktor (vgl. Gutenberg 1958, S. 23). In der Realität begegnet uns dieser dispositive Faktor in Form von Management‐ und Führungsaktivitäten.
Allgemein beschrieben, wird in Betrieben Input (Produktionsfaktoren) in Output (Wirtschaftsgüter) transformiert. Durch die Kombination der Produktionsfaktoren entstehen Wirtschaftsgüter, die ein Betrieb auf seinen Absatzmärkten anbietet. Nach der Art der Güter, die sie erzeugen, werden Betriebe in zwei große Gruppen eingeteilt: Sachleistungsbetriebe stellen Sachgüter her, Dienstleistungsbetriebe erbringen Dienstleistungen. Im Abschnitt 1.2.2 schauen wir uns diese Unterscheidung noch genauer an.
1.1.2 Finanzielles Gleichgewicht
Abbildung 1.2 veranschaulicht einerseits die Leistungserstellung in einem Betrieb. Inputfaktoren werden in Output transformiert. Andererseits ist der Finanzbereich des Betriebs Teil der Darstellung. Einzahlungen (gestrichelte Pfeile) fließen dem Betrieb zu, Auszahlungen (gepunktete Pfeile) fließen ab.
Eine einfache Bedingung für die Existenz eines Betriebs ist das finanzielle Gleichgewicht. Damit ein Betrieb zahlungsfähig ist, müssen die erzielten Einzahlungen mindestens die anfallenden Auszahlungen decken. Nur wenn gilt: Einzahlungen ≥ Auszahlungen ist ein Betrieb nicht zahlungsunfähig bzw. nicht insolvent. Besser als ein Gleichgewicht ist natürlich ein finanzielles Übergewicht der Einzahlungen.
Gleich in der Gründungsphase ist die Sicherung der Zahlungsfähigkeit eine kritische Herausforderung. Vorleistungen wie die Entwicklung eines neuen Produkts und der Aufbau von Produktions‐ und Verkaufskapazitäten führen zu Auszahlungen. In der Startphase lassen sich aber meist noch keine oder nur geringe Einzahlungen durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen erzielen. Die Auszahlungen durch den Einsatz der Produktionsfaktoren sind fällig, bevor Einzahlungen von Kunden eingehen.
Die Gründungsfinanzierung muss deshalb durch Startkapital erfolgen, das von den Eigentümern (Eigenfinanzierung) und von Gläubigern (Fremdfinanzierung) bereitgestellt wird. Zwischen den Gläubigern – das sind zum Beispiel Banken und Lieferanten – und dem Betrieb bestehen dann Schuldverhältnisse. Der Betrieb ist in der Rolle des Schuldners. Die Gläubiger sind berechtigt, zu bestimmten Zeitpunkten geschuldete (Geld‐)Leistungen zu fordern, zum Beispiel die sofortige Bezahlung einer Rechnung für gelieferte Teile oder die Rückzahlung eines Bankkredits in drei Jahren.
Einzahlungen von Eigentümern und Gläubigern und gelegentlich dem Staat (Stichwort: Subventionen) sind Formen der Außenfinanzierung. Wenn die Leistungserstellung erfolgreich angelaufen ist, entstehen Zahlungsüberschüsse, durch die sich ein Betrieb auch »von innen« finanzieren kann (Innenfinanzierung). Die Planung ausreichender Einzahlungen ist Gegenstand der betrieblichen Finanz‐ bzw. Liquiditätsplanung.
1.1.3 Wirtschaftliches Prinzip
Ein drittes allgemeines Kennzeichen von Betrieben ist die Anwendung des wirtschaftlichen bzw. ökonomischen Prinzips. Damit ist gemeint, dass die eingesetzten Produktionsfaktorenmöglichst vorteilhaft in Wirtschaftsgüter umgewandelt werden. Wirtschaftliches Handeln kann je nach Problemstellung eher eine Maximierungs‐ oder eine Minimierungsaufgabe bedeuten:
Maximum‐ oder Maximalprinzip:
Erzeuge aus einem gegebenen Input von Produktionsfaktoren einen möglichst großen Output! Nutze die vorhandene Kapazität möglichst wirkungsvoll!
Minimum‐ oder Minimalprinzip:
Erzeuge mit einem möglichst kleinen Input einen angestrebten Output von Wirtschaftsgütern! Achte auf den sparsamen Einsatz der Produktionsfaktoren!
Im Grunde steht hinter dem Wirtschaftlichkeitsprinzip »die Forderung, keine Produktionsfaktoren zu verschwenden« (Schmalen/Pechtl 2013, S. 10). Die Produktivität beschreibt das Verhältnis von Output‐ zu Inputmengen. Eine hohe Produktivität ist das Zeichen für eine gelungene Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und eine hohe Effizienz der betrieblichen Prozesse.
BEISPIEL
Ein Handelsbetrieb baut einen Lieferservice für Lebensmittel auf. Wie lassen sich die aktuellen Bestellungen aus verschiedenen Stadtteilen mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz erfüllen (Minimalprinzip)? Ein Gestaltungsfaktor ist die Routenplanung, durch die sich der Kraftstoffverbrauch und die erforderlichen Arbeitsstunden der Ausfahrer begrenzen lassen. Langfristig könnten Drohnen oder automatisierte Lieferfahrzeuge eine Chance bieten, die Effizienz der Dienstleistung zu verbessern.
Eine andere Fragestellung betrifft das Leistungspotenzial von Personal und Betriebsmitteln: Könnten mit der vorhandenen Kapazität auch größere Mengen ausgeliefert und eine größere Kundenanzahl beliefert werden (Maximalprinzip)?
1.2 Arten von Betrieben und Unternehmen
Betriebe unterscheiden sich in Bezug auf die Art der erstellten Wirtschaftsgüter, die Bedeutung eingesetzter Produktionsfaktoren und die Größe. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den verschiedenen Typen von Betrieben. Es geht los mit der Erläuterung, was private Betriebe (= Unternehmen) von öffentlichen Betrieben unterscheidet.
1.2.1 Unternehmen und öffentliche Betriebe
In marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen, zum Beispiel in Deutschland, gibt es in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse zwei Grundtypen von Betrieben: private und öffentliche. Im Zentrum des Interesses von Betriebswirten stehen private Betriebe. Sie werdenUnternehmen genannt und haben drei spezielle Eigenschaften, die sie von den öffentlichen Betrieben unterscheiden (Abbildung 1.3):
Abbildung 1.3 Merkmale von Unternehmen und öffentlichen Betrieben
Privateigentum:
Unternehmen gehören einem begrenzten Kreis privater Eigentümer. Bei einer Aktiengesellschaft sind dies zum Beispiel die Aktionäre, bei einer Einzelunternehmung ist es der Unternehmer.
Gewinnmaximierung:
Für Unternehmen wird als Normalfall angenommen, dass die Eigentümer und Führungspersonen vor allem eine Maximierung der Unternehmensgewinne anstreben.
Selbstbestimmung:
Im Rahmen gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen haben Entscheider in Unternehmen eine hohe Entscheidungsautonomie. Sie können zum Beispiel beschließen, bestimmte Geschäftsfelder aufzugeben oder den Einstieg in ganz neue Märkte zu wagen.
BEISPIEL
Im Aktienregister der Siemens AG sind rund 690.000 Aktionäre eingetragen, ein sehr großer, aber begrenzter Eigentümerkreis (Privateigentum). Mitte 2013 wurde Joe Kaeser Vorstandschef. Unter dem Titel »Vision 2020« startete er 2014 ein Programm, um »die Profitabilitätslücke zu den Wettbewerbern« zu schließen (Gewinnmaximierung). Inhalt des Programms sind zum Beispiel Organisationsmaßnahmen, die zu Personaleinsparungen führen sollen, sowie strategische Investitions‐ und Desinvestitionsentscheidungen. Dazu zählen der Kauf des Windkraftanlagenbauers Gamesa und der Verkauf der Leuchtmitteltochter Osram (Entscheidungsautonomie). Fazit: Die Siemens AG ist ein Unternehmen.
Öffentliche Betriebe gehören dagegen Gebietskörperschaften. In Deutschland sind das der Bund, die 16 Bundesländer, Städte und Gemeinden. Die öffentlichen Betriebe befinden sich in Gemeineigentum. Sie erbringen beispielsweise Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur (Nahverkehr, Wasserversorgung, Entsorgung) und Bildung. Sie erfüllen öffentliche Aufgaben. Häufig ist eine Gewinnerzielung nicht realistisch bzw. politisch nicht gewollt. Nicht Gewinnmaximierung, sondern gesellschaftlicher Nutzen bzw. das Gemeinwohl stehen im Vordergrund. Volkswirte sprechen bei Maßnahmen mit positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten von einer Wohlfahrtssteigerung.
Beispiele für öffentliche Betriebe sind staatliche Schulen und Hochschulen, Museen und Theater. ARD und ZDF sind öffentlich‐rechtliche Rundfunkanstalten. Stadtwerke sind meist kommunale öffentliche Betriebe.
BEISPIEL
Die Grenzen zwischen Unternehmen und öffentlichen Betrieben sind nicht in allen Fällen ganz eindeutig und auch nicht immer dauerhaft. Die Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften und Unternehmen findet verstärkt im Rahmen öffentlich‐privater Partnerschaften statt, für die auch der englische Begriff Public Private Partnerships (PPP) gebräuchlich ist. Zur Verwirklichung langfristiger Projekte werden dann oft Zweckgesellschaften gegründet, an denen sowohl öffentliche als auch private Partner beteiligt sind. Ein Beispiel ist die autobahnplus A8 GmbH zum Ausbau der Autobahn A8 zwischen Augsburg und München.
Die Deutsche Bundespost war in der Bundesrepublik Deutschland der staatseigene Post‐ und Telekommunikationsbetrieb. Sie wurde ab 1989 schrittweise privatisiert. Aus ihr hervorgegangen sind die Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG und Deutsche Postbank AG.
Ein Land ohne Unternehmen
Unternehmen und Unternehmertum spielen für den Wohlstand einer Volkswirtschaft eine entscheidende Rolle. Dies wird besonders deutlich, wenn man auf den wirtschaftlichen Misserfolg planwirtschaftlich‐kommunistischer Systeme schaut. Den Betrieben in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde ein zentraler Volkswirtschaftsplan vorgegeben, in dem für fünf Jahre das Produktionsprogramm und die einzusetzenden Ressourcen festgelegt waren. Das vorrangige Ziel der DDR‐Betriebe war die mengenmäßige Planerfüllung, ohne dass Nachfrage, Kundennutzen oder Qualität eine maßgebliche Rolle spielten. Es gab in der DDR kein Privateigentum an Produktionsmitteln. Der Begriff des volkseigenen Betriebs (VEB) zeigte dies an. Mit diesen Festlegungen wurden die Weichen auf das wirtschaftliche Abstellgleis gestellt. Es fehlten die Anreize und die Möglichkeit, auf eigene Rechnung kundenfreundliche Innovationen anzubieten.
In diesem Buch stehen private Betriebe im Vordergrund. Deshalb ist in den folgenden Abschnitten und Kapiteln häufiger von Unternehmen als von Betrieben die Rede.
1.2.2 Art der erstellten Wirtschaftsgüter
Der Output eines Betriebs besteht aus Wirtschaftsgütern. Diese sind entweder materiell oder immateriell (Abbildung 1.4). Materielle Güter bzw. Sachgüter lassen sich danach unterscheiden, wer sie nachfragt: Industriegüter werden von anderen Betrieben nachgefragt, Konsumgüter von Privatpersonen. Zu den immateriellen Gütern werden Dienstleistungen, Informationen und Rechte gezählt.
Abbildung 1.4 Arten von Wirtschaftsgütern
1.2.2.1 Industrie‐ und Konsumgüter
Als Sachgüter bezeichnet man künstlich hergestellte Objekte mit einer technischen Funktion, die für bestimmte Zwecke eingesetzt werden (vgl. Volz 1997, S. 32).
Nach der Art der Kunden werden im Bereich der Sachgüter zwei Arten unterschieden: Wenn Sachgüter von anderen Betrieben nachgefragt werden, spricht man von Industrie‐ oder B2B‐Gütern (B2B, BtB = Business‐to‐Business). Käufer von Konsum‐ oder B2C‐Gütern sind dagegen private Haushalte und Einzelpersonen (B2C, BtC = Business‐to‐Consumer).
Beide Sachgütergruppen werden zusätzlich in Bezug auf die Verwendungsdauer der Produkte unterteilt: Investitions‐ und Gebrauchsgüter sind langlebig und dienen der mehrfachen Verwendung entweder als Betriebsmittel (Investitionsgüter) oder als Gebrauchsgegenstand in privaten Haushalten (Gebrauchsgüter). Produktions‐ und Verbrauchsgüter werden im Zuge einer einmaligen bzw. kurzlebigen Verwendung aufgebraucht. Produktionsgüter gehen während der Produktion in andere Sachgüter ein, Verbrauchsgüter werden von Privatpersonen genutzt.
BEISPIEL
Zeit für eine Tasse Kaffee? Die Kaffeemaschine ist wie die anderen Elektrogeräte in Ihrer Küche ein Gebrauchsgut. Kaffeepulver, Filtertüten und Milch sind Verbrauchsgüter. Weitere Beispiele für Konsumgüter sind TV‐Geräte, Möbel und Kleidungsstücke (Gebrauchsgüter) sowie Kosmetika und Blumenerde (Verbrauchsgüter).
Lokomotiven, Gepäckförderanlagen und Computerserver sind Industriegüter mit einer mehrjährigen Nutzungsdauer (Investitionsgüter). Als Produktionsgüter werden zum Beispiel Elektronikbauteile in Smartphones und Kunststoffkomponenten in Autos eingebaut sowie Papier in Copyshops verbraucht.
Manche Sachgüter können gleichermaßen Industrie‐ und Konsumgut sein. Ein Tabletcomputer kann als Gebrauchsgut von einem Privatkunden gekauft werden, aber auch als Investitionsgut von einem Industrieunternehmen, das zum Beispiel Lagermitarbeiter mit den Geräten ausstattet. Ein Auto kann als Gebrauchsgut von einem Privatkunden gekauft werden, aber auch als Investitionsgut von einem Mietwagenanbieter.
Das Konsumgüter‐ und das Industriegütergeschäft weisen jeweils Merkmale auf, die dem typischen B2C‐ gegenüber dem B2B‐Geschäft einen unterschiedlichen Charakter geben (Tabelle 1.1). Viele Arten von Konsumgütern werden von einer großen Zahl Kunden nachgefragt, zum Beispiel die Fast Moving Consumer Goods des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte sowie Putz‐ und Reinigungsmittel. Handelsbetriebe spielen bei Konsumgütern eine wichtige Rolle. Sie bilden das Bindeglied zwischen Produzenten und Endkunden.
Häufige Merkmale Konsumgütergeschäft (B2C)
Häufige Merkmale Industriegütergeschäft (B2B)
große Zahl möglicher Kunden (anonymer Markt)
geringere Zahl möglicher Kunden
Werbung über Massenmedien (zum Beispiel Fernsehen, Zeitungen)
persönliche Kommunikation zwischen eigenen Vertriebsmitarbeitern und Kunden
In der Regel spielt zwischen Produzenten und Endkunden der Handel eine große Rolle.
oft Direktvertrieb ohne Einschaltung von Händlern
häufig Informationsnachteile bei den Kunden
Anbieter und Kunde beim Beurteilen der Produkte weitgehend ebenbürtig
individuelle, familiäre, teilweise irrationale Kaufentscheidungen
formalisierte, kollektive, in der Regel rationale Kaufentscheidungen
Tabelle 1.1 Häufige Merkmale des Konsumgüter‐ und des Industriegütergeschäfts
Ein weiterer Aspekt betrifft das Wissen auf der Käuferseite. Private Endkunden haben zum Beispiel über die Funktionsweise komplexer Technikprodukte nur begrenztes Wissen. Industriegüter werden professionell eingekauft. Die Mitarbeiter der Einkaufsabteilungen von Unternehmen sind den Anbietern beim Beurteilen der Produktqualität weitgehend ebenbürtig.
Um für Konsumgüter zu werben, nutzen die Hersteller oft Massenmedien und zielen auf emotionale Wirkungen bei den Endkunden. Beim Verkauf von Industriegütern spielt dagegen die persönliche Kommunikation eine entscheidende Rolle für den Verkaufserfolg.
Wenn ein Produkt sowohl als Industrie‐ als auch als Konsumgut angeboten wird, sollte der Produzent seine Verkaufsaktivitäten organisatorisch teilen, damit getrennte Vertriebsabteilungen gezielt auf die Anforderungen der Privat‐ und der Unternehmenskunden eingehen können.
1.2.2.2 Dienstleistungen
Dienstleistungen können in Handlungen bestehen, zum Beispiel dem Reinigen eines Büros oder dem Reparieren eines Sachguts, aber auch im Bereitstellen von Betriebsmitteln oder Informationen. Handelsunternehmen bilden eine große Gruppe unter den Dienstleistungsbetrieben. Wegen ihrer Verschiedenartigkeit ist es im Grunde unmöglich, den Begriff Dienstleistungen zugleich prägnant und allgemeingültig zu definieren.
Dienstleistungen unterscheiden sich in Bezug auf das Maß, in dem sie an bestimmte Personen, Sachen, Orte und Zeiten gebunden sind. Eine personengebundene Dienstleistung wird für einen bestimmten Leistungsempfänger erbracht, zum Beispiel von einer Ärztin, die einen Patienten behandelt, oder von einem Friseur, der einer Kundin die Haare schneidet. Die Reinigung eines Großraumbüros und die Lieferung von tiefgefrorenen Lebensmitteln sind an Orte gebunden. Sachgebundene Dienstleistungen, zum Beispiel Autoreparaturen, sind an bestimmte Gegenstände gekoppelt. Eine zeitgebundene Dienstleistung findet zu einem vorgegebenen Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums statt (Beispiel: Beförderung im ÖPNV mit einer Tageskarte an einem bestimmten Tag).
Typische personengebundene Dienstleistungen weisen besondere Merkmale auf. Die entsprechenden Dienstleistungsbetriebe, zum Beispiel Nahverkehrsbetriebe und Krankenhäuser, müssen sich darauf einstellen:
Diese Arten von Dienstleistungen
werden gleichzeitig produziert und konsumiert
(Uno‐actu‐Prinzip). Sie sind deshalb nicht lager‐ und nicht transportfähig. Während einer Opernaufführung »produzieren« Orchester und Ensemble Musik und Gesang, das Publikum »konsumiert«. Einen Haarschnitt kann eine Friseurin nicht auf Vorrat produzieren, sondern erst dann, wenn der Kunde den Friseursalon besucht. Nachfrageschwankungen lassen sich deshalb schwerer ausgleichen als bei vielen Sachleistungen.
Die Käufer können personengebundene Dienstleistungen, die uno actu erbracht und empfangen werden, im Voraus weder anfassen noch fühlen, hören oder probieren. Die Leistungen sind
intangibel
, nicht anfassbar.
Der
Empfänger
einer personengebundenen Dienstleistung
muss sich an der Leistungserbringung beteiligen,
sich selbst beispielsweise vom Zahnarzt behandeln lassen. Man spricht von der erforderlichen
Integration eines externen Faktors
. Bei einer Beratungsdienstleistung durch einen Unternehmensberater muss der Auftraggeber zunächst Informationen über die Abläufe und Strukturen in seinem Betrieb beisteuern.
Personengebundene Dienstleistungen müssen häufig stärker auf individuelle Kundenbedürfnisse und ‐besonderheiten ausgerichtet werden als Sachgüter. Das eingesetzte Personal hat dann relativ große Bedeutung im Vergleich zu den Betriebsmitteln, und es kann zu größeren Qualitätsschwankungen kommen als zum Beispiel bei der stärker automatisierten Produktion von Sachgütern.
Durch die rasanten Entwicklungen in der Informationstechnologie (Stichwort: Internet) ist es verstärkt möglich, Ort und Zeitpunkt der Produktion von Dienstleistungen vom Konsum durch die Leistungsempfänger zu entkoppeln. So erobern beispielsweise Onlineshops Marktanteile zulasten stationärer Handelsbetriebe, und Finanzdienstleistungen werden immer häufiger über das Internet abgewickelt.
BEISPIEL
Präsenzunterricht und Vorlesungen sind die traditionellen Formen der Wissensvermittlung in Schulen und Hochschulen. Die Unterrichtseinheiten finden zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten statt und setzen die Anwesenheit der Lernenden voraus. Der klassische Frontalunterricht ist durch das Kommunikationsverhalten des Lehrenden geprägt. Der Digitalisierungstrend und die nahezu allgegenwärtige Verfügbarkeit von Onlineinformationen schaffen Möglichkeiten, die Dienstleistung Wissensvermittlung räumlich und zeitlich stärker zu entkoppeln. Massive Open Online Courses, kurz: MOOCs, sind Onlinekurse, die von Hochschulen für große Teilnehmerzahlen angeboten werden.
1.2.2.3 Leistungsbündel aus Sachgütern und Dienstleistungen
Ein kombiniertes Angebot von Sachgütern und ergänzenden Dienstleistungen ist ein Leistungsbündel. Häufig wird auch von hybriden Leistungsbündeln gesprochen, um zu betonen, dass auf diese Weise verschiedenartige Wirtschaftsgüter zusammengefügt werden. Im Vergleich zu getrennt angebotenen Sachgütern und Dienstleistungen sollen Leistungsbündel vorhandene Kundenbedarfe nach ganzheitlichen Problemlösungen besser decken.
Produkt‐ und Serviceleistungen aus einer Hand bieten die Chance, die Bindung der Kunden an das integrierende Unternehmen zu erhöhen. In der Regel sind die ergänzenden Dienstleistungen während der Nutzungsphase deutlich profitabler als ein reiner Sachgutverkauf. Gleichzeitig wächst die Komplexität der Leistungserstellung, wenn ein Unternehmen als Systemanbieter oder ‐integrator Produkt‐ und Dienstleistungskomponenten zu einem Leistungsbündel verknüpfen möchte.
BEISPIEL
In der Automobilindustrie gibt es inzwischen mehrere Beispiele für Hersteller von Produktionsanlagen, die mit eigenen Mitarbeitern in den Fabriken ihrer Kunden Produktionsprozesse übernehmen. Eisenmann ist auf den Bau von Lackier‐ und Förderanlagen spezialisiert. In den 1990er‐Jahren hat das Unternehmen begonnen, den Autoherstellern im Rahmen von Betreibermodellen anzubieten, Karosserien zu lackieren und Förderprozesse zu übernehmen. Die Vereinbarung von Eisenmann und Ford sieht vor, dass Eisenmann von Ford je Fahrzeug bezahlt wird, wenn es das Kölner Ford‐Werk verlässt (Pay on Production).
Der britische Triebwerkehersteller Rolls Royce bietet Fluglinien ein »Total Care«, früher: »Power by the Hour«, genanntes Preis‐ und Servicemodell an. Rolls Royce liefert nicht nur das Triebwerk an den Flugzeughersteller. Rolls‐Royce‐Mitarbeiter überwachen, warten und reparieren die Triebwerke während der jahrzehntelangen Einsatzdauer. Die Fluglinien bezahlen nach geflogenen Stunden.
1.2.2.4 Branchen und Wirtschaftssektoren
Die Gesamtheit von Betrieben, die gleiche oder ähnliche Sachgüter herstellen bzw. Dienstleistungen erbringen, wird als Branche oder Wirtschaftszweig bezeichnet. So wird zum Beispiel von der Automobilbranche, der Pharmabranche oder der Hotelbranche gesprochen. Das Statistische Bundesamt ermittelt regelmäßig Daten zur Bedeutung einzelner Wirtschaftszweige in Deutschland (Tabelle 1.2).
Wirtschaftszweig
Anzahl der Unternehmen
Anzahl der Beschäftigten
Umsatzerlöse in Mrd. Euro
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden
2.207
52.109
14
Verarbeitendes Gewerbe
241.804
6.889.283
2.055
Energie‐ und Wasserversorgung
80.101
481.463
585
Baugewerbe
389.749
1.620.814
259
Dienstleistungen (Handel, Gastronomie, Logistik, Kommunikation, Gesundheitswesen …)
2.755.178
19.769.407
3.419
Insgesamt
3.469.039
28.813.076
6.332
Tabelle 1.2 Kennzahlen unterschiedlicher Wirtschaftszweige in Deutschland, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
1.2.3 Bedeutung von Produktionsfaktoren
Bei der Leistungserstellung in Betrieben werden Produktionsfaktoren kombiniert. Einzelne Produktionsfaktoren können eine besonders große Bedeutung haben:
(1) In arbeitsintensiven Betrieben steht die menschliche Arbeitsleistung im Vordergrund. Dort bilden die Personalkosten einen großen Teil der Gesamtkosten. Dies ist in vielen Handwerksbetrieben der Fall und auch bei der Produktion individueller Produkte in kleiner Stückzahl, zum Beispiel in einer Maßschneiderei.
Für arbeitsintensive Betriebe stellt sich die betriebswirtschaftliche Frage, ob Arbeitsprozesse durch einen verstärkten Technikeinsatz kostengünstiger gestaltet werden können (Stichwort: Automatisierung). Außerdem führen die hohen Personalkosten einer arbeitsintensiven Produktion regelmäßig zu Überlegungen, ob sich eine Verlagerung in Länder mit deutlich niedrigeren Arbeitskosten lohnen könnte.
Als wissensintensiv werden solche Betriebe bezeichnet, in denen der Anteil derjenigen Mitarbeiter relativ groß ist, die mit Aufgaben wie Forschung, Entwicklung und Planung befasst sind. Fachliches und methodisches Expertenwissen sowie Kreativität haben dann besondere Bedeutung, und der Anteil der Beschäftigten mit einem Hochschulabschluss ist in der Regel überdurchschnittlich hoch. Entwicklungsdienstleister, Bildungseinrichtungen und Unternehmensberatungen sind Beispiele wissensintensiver Betriebe.
(2) Kapital‐ bzw. anlagenintensive Betriebe sind durch den Einsatz von viel Technik gekennzeichnet. Dementsprechend hoch sind die Kosten für den Produktionsfaktor Betriebsmittel. Beispiele sind Fabriken für die Produktion von Mikrochips, Erdölraffinerien und Stahlwerke. Die Massenproduktion standardisierter Bauteile und Produkte ist meist hoch automatisiert und findet in kapitalintensiven Betrieben statt.
Die großen Investitionen in die Betriebsmittel führen in kapitalintensiven Betrieben zu hohen Fixkosten, also zu Kostenblöcken, die sich kurzfristig nicht reduzieren lassen. Deshalb ist die hohe Auslastung der technischen Kapazitäten besonders wichtig. Um sie sicherzustellen, ist zum Beispiel auf eine hohe Versorgungssicherheit mit Material zu achten. Eine weitere Maßnahme: Das maschinenbedienende Personal arbeitet in drei Schichten, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten.
Zusatzinformation
In allen Wirtschaftsbereichen ist in den vergangenen Jahrzehnten der Kapitaleinsatz gestiegen. Das Statistische Bundesamt ermittelt regelmäßig den Wert der eingesetzten Betriebsmittel je Erwerbstätigen (Tabelle 1.3). Landwirtschaftliche Betriebe waren früher durch eine hohe Arbeitsintensität gekennzeichnet. Heute dominiert der Einsatz leistungsfähiger Maschinen und Anlagen.
1993
2013
Land‐ und Forstwirtschaft, Fischerei
237.500 Euro
493.700 Euro
Produzierendes Gewerbe (Industrie) ohne Baugewerbe
185.900 Euro
300.400 Euro
Baugewerbe
27.100 Euro
38.700 Euro
Handel, Gastgewerbe, Verkehr (Dienstleistungen)
70.400 Euro
121.600 Euro
Tabelle 1.3 Kapitaleinsatz je Erwerbstätigen (Quelle: Statistisches Bundesamt)
(3) In materialintensiven Betrieben hat der laufende Input besondere Bedeutung. Der Anteil der Materialkosten an den Gesamtkosten ist hoch. Sägewerke und Nahrungsmittelhersteller verarbeiten einen großen ständigen Input von Rohstoffen. Gut laufende Handelsbetriebe haben einen hohen Durchsatz der von ihnen weiterverkauften Waren (zum Beispiel Lebensmitteldiscounter). Das betriebswirtschaftliche Augenmerk liegt bei den materialintensiven Betrieben auf der Gestaltung der Beschaffungsaktivitäten und Einkaufspreise sowie der Optimierung logistischer Prozesse (Transportieren, Lagern).
(4) Energieintensive Betriebe, zum Beispiel Papierproduzenten, Aluminiumschmelzen und Walzwerke, verbrauchen viel Energie. Sie sind typischerweise auch sehr kapitalintensiv. Steigende Energiekosten und verschärfte Umweltstandards stellen energieintensive Betriebe vor erhebliche Herausforderungen.
1.2.4 Größe von Betrieben
Die Zahl der Mitarbeiter und die Höhe der Umsatzerlöse (kurz: »Umsatz«) sind die zwei gängigsten Kennzahlen, um die Größe von Betrieben und Unternehmen zu beschreiben (Tabelle 1.4).
Anwendbarkeit
Vor‐ und Nachteile
Anzahl der Mitarbeiter
generell
+ leicht zu erfassen
– Grad der Technisierung unberücksichtigt
Umsatzerlöse (Verkaufsmenge · Verkaufspreis)
generell
+ leicht zu erfassen
– Leistungstiefe nicht erkennbar
– konjunktur‐ und preisabhängig
Wertschöpfung (Umsatzerlöse – Materialaufwand)
generell
+ leicht zu erfassen
+ Leistungstiefe erkennbar
– konjunktur‐ und preisabhängig
Technische Kapazität
bei technisch vergleichbarer Leistung
– technisch vergleichbare Leistung erforderlich
Kundenzahl
bei vergleichbarer Leistung
– vergleichbare Leistung erforderlich
Marktkapitalisierung (Börsenkurs · Aktienanzahl)
bei börsennotierten Kapitalgesellschaften
– sehr eingeschränkt anwendbar
– beschreibt Unternehmenswert, nicht ‐größe
– Börsenkurs als Einflussfaktor
Tabelle 1.4 Kennzahlen zum Vergleich von Betrieben
Die Anzahl der Mitarbeiter lässt sich leicht erfassen. In der Lohnbuchhaltung sollte man den Kreis der Lohn‐ und Gehaltsempfänger genau kennen. Die Kennzahl kann für alle Arten von Unternehmen erfasst werden, allerdings ist der Technisierungsgrad nicht erkennbar. In einem kapitalintensiven Betrieb mit einer stark automatisierten Produktion kann auch mit wenigen Mitarbeitern eine große wirtschaftliche Leistung erbracht werden.
2015 gab es in Deutschland insgesamt 3.469.039 Unternehmen (Tabelle 1.5). Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass fast 90 Prozent dieser Unternehmen Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten waren. Rund 14.200 Unternehmen hatten hingegen 250 und mehr Beschäftigte. In solchen Großunternehmen arbeiteten 45 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dies waren fast 13 Millionen Personen.
Wirtschaftszweig
Anzahl der Unternehmen
0 bis 9 Mitarbeiter (Kleinstunternehmen)
10 bis 49 Mitarbeiter (kleine Unternehmen)
50 bis 249 Mitarbeiter (mittlere Unternehmen)
250 und mehr Mitarbeiter (große Unternehmen)
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden
2.207
1.593
477
117
20
Verarbeitendes Gewerbe
241.804
178.229
43.799
15.569
4.207
Energie‐ und Wasserversorgung
80.101
75.339
3.157
1.273
332
Baugewerbe
389.749
351.417
35.007
3.081
244
Dienstleistungen (Handel, Gastronomie, Logistik, Kommunikation, Gesundheitswesen …)
2.755.178
2.506.714
198.330
40.720
9.414
Insgesamt
3.469.039
3.113.292 (89,8 %)
280.770 (8,1 %)
60.760 (1,7 %)
14.217 (0,4 %)
Tabelle 1.5 Deutsche Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen, Stand: 2015 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Umsatzerlöse beschreiben den Wert der verkauften Produkte bzw. erbrachten Dienstleistungen. Für ein Erzeugnis ergeben sich die Umsatzerlöse aus der Verkaufsmenge und dem Verkaufspreis. Auch diese Kennzahl ist mithilfe der Buchhaltung leicht zu erfassen. Es lässt sich allerdings nicht erkennen, wie groß die Leistungs‐ oder Wertschöpfungstiefe ist, der eigene Anteil eines Unternehmens an der Wertschöpfung. Hohe Umsatzerlöse können auch durch den Weiterverkauf von Waren erreicht werden, die ein Unternehmen teuer eingekauft hat.
BEISPIEL
Unter den deutschen Unternehmen ist der Autohersteller Volkswagen (VW) sowohl das umsatzstärkste als auch dasjenige mit den weltweit meisten Mitarbeitern. Im Jahr 2016 arbeiteten weltweit 627.000 Menschen für VW, 508.000 für die Deutsche Post und jeweils rund 390.000 für die Schwarz‐Gruppe (»Lidl«) und den Industriekonzern Bosch. Die zweit‐ bzw. dritthöchsten Umsatzerlöse nach VW (217 Milliarden Euro) erwirtschaften 2016 Daimler und BMW (153 bzw. 94 Milliarden Euro).
Mitarbeiterzahl und Umsatzerlöse sind die zwei üblichen Kennzahlen zur Beschreibung der Unternehmensgröße. Ergänzende Kennzahlen lassen weitere Rückschlüsse zu.
Wie hoch ist der wertmäßige Eigenanteil eines Unternehmens am Zustandekommen der hergestellten Produkte und erbrachten Dienstleistungen? Das zeigt die Kennzahl
Wertschöpfung
, die sich mithilfe von Umsatzerlösen und Materialaufwand ermitteln lässt. Der Materialaufwand bildet den Wert der fremdbezogenen Vorleistungen ab. Diese werden ausgeblendet. So ist – anders als bei einer reinen Umsatzbetrachtung – die
Leistungs‐ oder Wertschöpfungstiefe
eines Betriebs erkennbar.
BEISPIEL
Autohersteller A erwirtschaftet Umsatzerlöse von 50 Milliarden Euro und hat Materialaufwendungen von 20 Milliarden Euro. Beim Konkurrenten B sind es 45 Milliarden Euro Umsatzerlöse und 30 Milliarden Euro Materialaufwendungen. Beim Vergleich der jeweiligen Wertschöpfung, 30 bzw. 15 Milliarden Euro, wird erkennbar, dass B viel stärker als A auf den Zukauf von Zulieferteilen und auf externe Dienstleistungen setzt. A benötigt deshalb deutlich mehr Mitarbeiter, Betriebsmittel und Flächen.
Bei Betrieben mit einem gleichartigen Output können die jeweiligen
Kapazitäten
und
Produktionsmengen
bestimmter Perioden für Vergleiche herangezogen werden. Bei einer vergleichbaren Leistung gibt auch die
Anzahl der Kunden
einen Anhaltspunkt für die Größe eines Betriebs.
Regelmäßig werden Ranglisten ermittelt, die börsennotierte Unternehmen nach ihrer Markt‐ bzw. Börsenkapitalisierung ordnen. Die Marktkapitalisierung beschreibt den Börsenwert und wird mithilfe des Börsenkurses und der Anzahl der Aktien errechnet.
Zusatzinformation
Die »Global 500« der Financial Times ist eine Liste der Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung, die »einen jährlichen Schnappschuss der weltweit größten Unternehmen« liefert (»an annual snapshot of the world's largest companies«, ft.com). In den letzten Jahren waren Apple und Google (seit Herbst 2015 heißt die Muttergesellschaft Alphabet) die wertvollsten Unternehmen.
1.3 Betriebe und ihre Umwelt
Betriebe und Unternehmen sind keine Inseln, sondern auf vielfache Weise verknüpft mit ihrer Umwelt und einem Netzwerk von Akteuren. Mit dem Begriff Umwelt ist an dieser Stelle nicht nur die ökologische Umwelt gemeint, sondern die Gesamtheit der Einflussfaktoren, die von außen auf den Betrieb wirken. Die Begriffe Umwelt und Umfeld werden in der BWL ähnlich verwendet. Umfeld betont, dass es um relevante Einflussfaktoren aus externen »Kräftefeldern« geht, die den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen.
Die Umwelt von Betrieben wird gedanklich in zwei Bereiche geteilt (Abbildung 1.5):
Abbildung 1.5 Allgemeine und marktliche Unternehmensumwelt
Unternehmen werden einerseits durch Rahmenbedingungen der
allgemeinen Umwelt
beeinflusst, zum Beispiel durch technologische und gesellschaftliche Trends und politisch‐rechtliche Faktoren.
Andererseits bilden Lieferanten, Arbeitskräfte, Konkurrenten und Kunden das unmittelbare, engere wirtschaftliche Umfeld, die
marktliche Umwelt
, die auch Wettbewerbsumwelt genannt wird . Für viele Betriebe, vor allem Konsumgüterhersteller, spielen in der Wettbewerbsumwelt auch Handelsunternehmen eine wichtige Rolle.
1.3.1 Allgemeine Umwelt
Trends in der natürlichen Umwelt und den Bereichen Technik, Gesellschaft und Politik können die Rahmenbedingungen für Unternehmen maßgeblich verändern. Gravierende Umbrüche zeichnen sich oft längere Zeit im Voraus ab. Die allgemeine Unternehmensumwelt lässt sich in mehrere Umfelder gliedern (vgl. Steinmann/Schreyögg/Koch 2013, S. 168 ff.):
Natürliches Umfeld:
Als Rohstoffquelle und Energielieferant ist die natürliche Umwelt Ausgangspunkt jeder Wertschöpfungskette. Die Natur dient auch als Aufnahmemedium für Rückstände. Für Tourismusregionen und die dort ansässigen Betriebe sind die ökologischen Rahmenbedingungen sehr wichtig. Sie bilden ein Ambiente, in dem sich Gäste wohlfühlen – oder nicht.
Technologisches Umfeld:
Der technische Fortschritt betrifft Materialien, Produktionsverfahren und Produkte. Leistungsfähigere Verfahren bieten Sachgutherstellern und Dienstleistern die Chance, die Effizienz zu steigern. Wer für seine Produkte früh neue Werkstoffe und Technologien nutzt, kann sich von Konkurrenten absetzen. Existenzprobleme drohen hingegen solchen Unternehmen, die technologische Veränderungen zu lange ignorieren.
Sozio‐kulturelles Umfeld:
Sozio‐kulturelle Trends betreffen die Entwicklung
gesellschaftlicher
Faktoren, zum Beispiel demografische Merkmale und vorherrschende Wertmuster. Beispiele für Veränderungen im sozio‐kulturellen Umfeld sind die Trends zu stärker individualisierten Sachgütern und Dienstleistungen und der Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung. Auch (zwischenzeitliche) Zeitgeist‐Phänomene sind hier zu nennen (zum Beispiel die »Geiz ist Geil«‐Welle).
Politisch‐rechtliches Umfeld:
Politische Institutionen auf der Bundes‐, Länder‐ und Gemeindeebene sowie der europäischen Ebene nehmen mit ihren Entscheidungen Einfluss auf Betriebe. Wirtschaftspolitische Einflüsse auf Branchen und Unternehmen sind zum Beispiel Subventionen, Steuern und Abgaben sowie Vorgaben zu Umwelt‐ und Verbraucherschutz.
Makroökonomisches Umfeld:
Auch von nationalen und internationalen wirtschaftlichen Gegebenheiten gehen Einflüsse auf Betriebe aus. Länderübergreifende Wirtschaftsbeziehungen nehmen zu. Unternehmen aus Ländern wie China und Indien drängen als Anbieter auf den Weltmarkt. Zu den Makro‐Faktoren gehören auch Wechselkurse, Rohstoffpreise und Entwicklungen auf den Kapitalmärkten.
BEISPIEL
Hersteller von Meisenknödeln fürchten die Klimaerwärmung. Die Nachfrage nach den Futterkugeln ist sehr »schnee‐elastisch«. In strengen Wintern werden deutlich mehr Knödel gekauft als in milden. Die Firma Erdtmann hat deshalb das Sortiment erweitert und stellt für Menschen mit ausgeprägter Fütterleidenschaft Sommermeisenknödel mit getrockneten Kirschen, Äpfeln und Birnen her.
1975 war der Medizin‐ und Pflegeproduktehersteller Paul Hartmann AG in den Markt für Babywindeln eingestiegen. In Deutschland entwickelte sich »Fixies« zur zweitgrößten Babywindelmarke nach »Pampers«. 2005 verkaufte Hartmann das Babywindelgeschäft an ein französisches Unternehmen. Das Geschäft mit Windeln und Einlagen für Senioren (Marke »Molimed«) wurde dagegen ausgebaut. Ein wesentlicher Grund für diese Neuausrichtung sind zwei sozio‐kulturelle Entwicklungen: der Geburtenrückgang in vielen EU‐Ländern und die steigende Zahl älterer Personen mit Inkontinenzproblemen.
Die Marktchancen von Autos mit elektrischen Antrieben werden stark von der Entwicklung politisch‐rechtlicher Rahmenbedingungen beeinflusst. Dazu zählen einerseits Fördermaßnahmen wie Prämien beim Kauf von Elektrofahrzeugen. Andererseits profitieren Autos mit E‐Antrieb davon, wenn der Verkauf und die Nutzung von Autos mit konventionellen Antrieben verteuert werden, zum Beispiel durch eine City‐Maut für Diesel und Benziner.
1.3.2 Marktliche Umwelt
Zur marktlichen Umgebung eines Betriebs gehören die Beschaffungs‐ und Absatzmärkte. Außerdem gibt es Konkurrenten, also die Gegenspieler in der eigenen Branche. Mit wie vielen Akteuren hat man es tun und wie groß ist deren jeweilige Bedeutung?
1.3.2.1 Marktstrukturen
Betriebe sind ein Teil mehrstufiger Wertschöpfungsketten, die von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung von Vorprodukten bis zu Sachgütern und Dienstleistungen für Endkunden führen. Die Anzahl und Größe der Anbieter und Nachfrager, die auf einzelnen Wertschöpfungsstufen verknüpft sind, prägen die Marktstruktur.
(a) Schaut man auf die Anzahl der Marktteilnehmer auf einer Wertschöpfungsstufe, werden die drei Marktformen Monopol, Oligopol und Polypol unterschieden:
In einem
Monopol
gibt es
nur einen
Anbieter oder
nur einen
Nachfrager. Im ersten Fall spricht man von einem Angebotsmonopol, im zweiten von einem Nachfragemonopol oder Monopson. Ein Alleinanbieter hat keine Konkurrenz, es gibt keine Alternativangebote. Kunden können nicht zwischen Anbietern wählen, sondern allenfalls auf den Kauf eines Guts verzichten. Deshalb befindet sich ein Monopolist in einer starken Position mit großer Marktmacht. Dies kann er zum Beispiel bei der Preissetzung nutzen.
In einem
Oligopol
konkurrieren auf einer Wertschöpfungsstufe nur
wenige
Anbieter (Angebotsoligopol), bzw. nur
wenige
Kunden fragen ein Gut oder eine Dienstleistung nach (Nachfrageoligopol oder Oligopson). Oligopolunternehmen beeinflussen durch ihr Angebot, ihre Preispolitik und weitere Maßnahmen stark das Marktgeschehen und den Erfolg ihrer Wettbewerber.
In einem
Polypol
sind auf einer Wertschöpfungsstufe
viele
Marktteilnehmer vorhanden. Einzelne Anbieter bzw. Nachfrager haben in einem Angebotspolypol bzw. Nachfragepolypol (Polypson) nur einen verschwindend geringen Einfluss. Es gibt keine exakte Zahlengrenze zwischen Oligopol und Polypol (à la »Ab zehn Anbietern spricht man von einem Polypol«). Zur Unterscheidung wird versucht, die sogenannte Reaktionsverbundenheit der Akteure abzuschätzen.
BEISPIEL
Bis Ende 2012 gab es in Deutschland regionale Monopole für die amtlich als »Feuerstättenschau« bezeichnete Dienstleistung der Schornsteinfeger. In einem Kehrbezirk war jeweils nur ein Kaminkehrer zugelassen. Unternehmen können durch patentgeschützte Innovationen eine temporäre Monopolposition erobern, bevor Nachahmer für Konkurrenz sorgen (zum Beispiel in der Pharmaindustrie).
Den Markt für große Passagierflugzeuge teilen sich Airbus und Boeing. So ein Oligopol mit zwei Anbietern heißt Duopol. Auf dem Weltmarkt für Festplatten gibt es nur drei Anbieter: Seagate, Western Digital und Toshiba.
In Ballungsräumen findet man regionale Angebotspolypole für gängige Handwerkerdienstleistungen und im Gastronomiebereich. Nachfragepolypole existieren bei vielen standardisierten Konsumgütern, die von zahlreichen privaten Endkunden nachgefragt werden.
(b) Für die Verteilung der Marktmacht ist nicht nur die Anzahl der Anbieter bzw. Nachfrager entscheidend. Auch Größenverhältnisse und Marktanteile spielen eine Rolle. Sind Konkurrenten zwar vorhanden, aber sehr klein, hat ein großes, marktbeherrschendes Unternehmen eine monopolartige Stellung. In einer Branche mit vielen Anbietern spricht man von einer oligopolistischen Marktstruktur, wenn wenige Unternehmen den Markt dominieren. Der Marktanteil kann zum Beispiel anhand der verkauften Menge (Absatz) gemessen werden, aber auch in Bezug auf den Wert der abgesetzten Güter (Umsatz).
BEISPIEL
Für Schnupftabak gibt es in Deutschland zwar mehrere Anbieter, beherrscht wird der Markt aber vom bayerischen Unternehmen Pöschl (»Gletscherprise«), das einen Marktanteil von 95 Prozent hält. Ähnlich monopolartige Positionen besetzen Google und die Deutsche Post bei Internetsuchmaschinen bzw. der Beförderung von Briefen.
In Deutschland gibt es mehr als eine Million Waldbesitzer(Angebotspolypol). Nur rund ein Dutzend Unternehmen verarbeitet in Sägewerken derzeit 85 Prozent des in Deutschland jährlich anfallenden Rundholzes (oligopolartige Nachfrage). Im Jahr 2005 haben sich private und kommunale Waldbesitzer in Süddeutschland zur Genossenschaft In.Silva zusammengeschlossen, um ihr Holzangebot gegenüber Sägewerken besser zu vermarkten.
1.3.2.2 Marktakteure
Außer den Marktstrukturen haben zahlreiche weitere externe Faktoren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Abbildung 1.6 zeigt ausgewählte Einflussfaktoren, die aus verschiedenen marktlichen Umfeldern auf ein Unternehmen einwirken.
Abbildung 1.6 Ausgewählte Einflussfaktoren aus marktlichen Umfeldern
BEISPIEL
Augenoptische Betriebe verkaufen Brillen und Kontaktlinsen. Die Mitarbeiter führen bei Kunden Sehtests durch, beraten beim Kauf der Sehhilfen und übernehmen Reparaturen. Verschiedene technologische Entwicklungen beeinflussen den Wirtschaftszweig, zum Beispiel leichtere Materialien für die Gestelle und neuartige Kunststoffgläser. Sehschwächen lassen sich auch durch Laseroperationen korrigieren. Ein relevantersozio‐kultureller Trend ist die veränderte Altersstruktur der Gesellschaft. Gesellschaftliche Schönheitsideale könnten den Markt langfristig beeinflussen. Zum politisch‐rechtlichen Umfeld der Augenoptikerbranche zählen Krankenkassen, die den Kauf von Sehhilfen weniger unterstützen als früher.
Ein Teil der Kunden hat einen Bedarf an Zweit‐ und Drittbrillen. Die Nachfrage wird auch von modischen Trends beeinflusst. Die Anzahl der stationären augenoptischen Geschäfte in Deutschland hat sich in den letzten Jahren kaum verändert (2015: 11.900). Als neue Konkurrenten sind Unternehmen hinzugekommen, die das Internet für den Onlineverkauf von Brillen, Kontaktlinsen und Linsenpflegemitteln nutzen. Wichtige Lieferanten