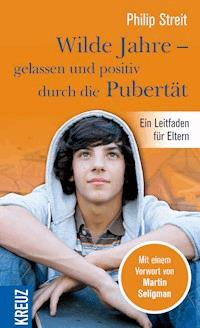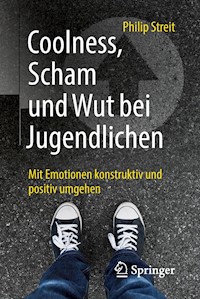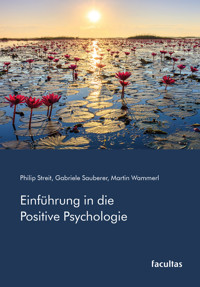
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch schließt die Lücke eines ganzheitlichen Überblicks zur Positiven Psychologie. Basierend auf der PERMA-Theorie des Wohlbefindens werden die wichtigsten Bausteine eines gelingenden Lebens und Aufblühens herausgearbeitet. Dazu wird die Neurobiologie des „Glücks“ verständlich und anwendungsorientiert vorgestellt. In dieses Setting werden die Bereiche der Resilienz, Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit, Motivation und des Mindsets integriert. Im Anwendungsteil des Buches werden Positive Erziehung, Positive Gesundheit, Positive Leadership, Positives Coaching und Therapie knapp und fundiert vorgesellt. Weitere Abschnitte befassen sich mit Positivem Altern und Positiver Kommunikation. Das Buch gibt einen Überblick zu den wichtigsten Forschungs- und Tätigkeitsbereichen der Positiven Psychologie und regt zur aktiven Auseinandersetzung damit an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Philip Streit, Gabriele Sauberer, Martin Wammerl Einführung in die Positive Psychologie
Dr. Philip Streit, Klinischer und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Leiter der Akademie für Kind, Jugend und Familie, Senior Advisor des Institutes für Kind, Jugend und Familie, Mitglied des Board of Advisors der International Positive Psychology Association (IPPA), Koordinator von Seligman Europe, EUPPA-zertifizierter Lehrtrainer der Positiven Psychologie.
Dr.in Gabriele Sauberer, MBA, Sprach- und Wirtschaftswissenschaftlerin, Expertin für Diversität, Interkulturalität und Positive Kommunikation. Leiterin der Europäischen Zertifizierungsstelle für Positive Psychologie und Geschäftsführerin der Vienna International Positive Psychology School.
Dr. Martin Wammerl, MA, MSc, Klinischer und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Soziologe, Dozent an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft der Sigmund Freud Privatuniversität Linz, Leiter der Forschungsabteilung des Instituts für Positive Psychologie und Mental Coaching Graz.
Im Text werden die weibliche und männliche Form abwechselnd gewählt. Dies schließt immer Angehörige aller Geschlechter (m/w/d) ein.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der Autorin, der Autoren oder des Verlages ist ausgeschlossen. Der Verlag hat sich bemüht, alle Urheber der in diesem Buch dargestellten Abbildungen zu erheben und die rechtliche Seite abzuklären. Sollte es bei einer Abbildung nicht gelungen sein, den tatsächlichen Urheber zu eruieren, bitten wir diesen, sollten Ansprüche gestellt werden, sich mit dem Verlag in Verbindung zu setzen.
1. Auflage 2025
Copyright © 2025 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Universitätsverlag, Stolberggasse 26, 1050 Wien, Österreich
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
Umschlagbild: ©lkunl – istockphoto.com
Lektorat: Mag. Katharina Schindl, Wien
Satz: Wandl Multimedia Agentur, Groß Weikersdorf
Druck und Bindung: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien
Printed in Austria
ISBN 978-3-7089-1935-5 (Print)
ISBN 978-3-99111-851-0 (E-Pub)
Dieses Buch ist in tiefer Liebe meiner Frau Brigitte und meinem Sohn Simon gewidmet.
Philip Streit
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Roy F. Baumeister
Geleitwort von Dr. Gunther Schmidt
Danksagung
1 Positive Psychologie – wie alles begann
1.1 Die Erfindung und Entwicklung der Positiven Psychologie
1.2 Zusammenfassung
Literatur
2 Modelle des Glücks und des Wohlbefindens – ein historischer Abriss über Quellen der Positiven Psychologie
2.1 Maslow und die Humanistische Psychologie
2.2 Subjective Well-being – der Beitrag von Ed Diener
2.3 Der Weg Bhutans
2.4 Psychological Well-being – das Konzept von Carol Ryff
2.5 Salutogenese nach Aaron Antonovsky – ein Beitrag zu seelischer Gesundheit
2.6 Die Geschichte des Flourishing
2.7 Das Doppelkontinuum geistiger Gesundheit und menschlicher Leistungsfähigkeit von Corey Keyes
2.8 Das Spektrum geistiger Gesundheit von Felicia A. Huppert
2.9 Resilienzprogramme als Basis der Positiven Psychologie
2.9.1 Resilienz nach Huber (2003)
2.9.2 Das Penn-Resilience-Programm
2.10 Wie genetisch ist das Glück?
2.11 Zusammenfassung
Literatur
3 Stärken stärken stärkt – wie menschliche Stärken zu einem gelingenden Leben beitragen
3.1 Charakter und Persönlichkeitsmerkmale
3.2 Der Beginn der Stärkenforschung
3.3 Die Charakterstärken im Überblick (Ruch & Proyer 2015)
3.4 Messen und Erfassen von Stärken
3.4.1 Stärkenmaße
3.5 Signaturstärken
3.6 Stärkenprofile
3.7 Ryan Niemiecs Arbeit mit Stärken
3.8 Können Stärken trainiert werden?
3.9 Zusammenfassung
Literatur
4 Auf der Suche nach einer Theorie der Positiven Psychologie
4.1 Von der Theorie des authentischen Glücks zu einer Theorie des Wohlbefindens
4.2 Theorie des Wohlbefindens (PERMA)
4.3 Aufblühen/Flourishing als Ziel der Positiven Psychologie
4.4 Zusammenfassung
Literatur
5 Wie unser Hirn Wohlbefinden produziert und was wir damit zu tun haben – eine kleine Neurobiologie des Glücks
5.1 Der Aufbau des Gehirns
5.2 Basale Fakten zum menschlichen Gehirn
5.2.1 Wir haben genug Hirn
5.2.2 Unser Gehirn ist paarig angelegt und neuroplastisch
5.2.3 Wir machen uns unser Gehirn selbst
5.3 Die Hauptbestandteile des Gehirns in Bezug auf eine Neurologie des Wohlbefindens
5.3.1 Präfrontaler Cortex (PFC)
5.3.2 Anteriorer cingulärer Cortex (ACC)
5.3.3 Insula
5.3.4 Thalamus
5.3.5 Hirnstamm
5.3.6 Corpus callosum
5.3.7 Kleinhirn
5.3.8 Limbisches System
5.3.9 Die Basalganglien
5.3.10 Striatum
5.3.11 Nucleus caudatus
5.3.12 Nucleus lentiformis
5.3.13 Nucleus accumbens
5.3.14 Substantia nigra
5.3.15 Hippocampus
5.3.16 Amygdala
5.3.17 Hypothalamus
5.3.18 Hypophyse
5.4 Neurochemische Stoffe – Betriebsmittel für das Gehirn
5.4.1 Primäre Neurotransmitter
5.4.2 Neuromodulatoren
5.4.3 Neuropeptide
5.5 Spiegelneuronensystem und Resonanzschaltkreise
5.6 Das zentrale Stresssystem
5.7 Das Belohnungssystem oder die Macht des Nucleus accumbens
5.8 Das Aufmerksamkeitssystem in Bezug auf eine neurobasierte Positive Psychologie
5.9 Das soziale Gehirn nach Esch bzw. das Engagement- und Sicherheitssystem
5.10 Das Belohnungs- und Motivationssystem des ZNS in Bezug auf eine neurobasierte Positive Psychologie
5.11 Zusammenfassung
Literatur
6 Positive Diagnostik
6.1 Die Well-being Scale von Carol Ryff
6.2 Die PANAS-Skala
6.3 Das Mental Health Continuum
6.4 Die Messung von Charakterstärken
6.5 Die Messung von PERMA
6.6 Die Messung von Positivity
6.7 Weitere Daten zu Glück und Wohlbefinden
6.8 Zusammenfassung
Literatur
7 Systemik und Positive Psychologie – Wie systemisch ist die Positive Psychologie? Ein Versuch der Einordnung
7.1 Systemische Effekte
7.2 Zusammenfassung
Literatur
8 Positive Interventionen
8.1 Die 14 Positiven Interventionen im Überblick
8.1.1 Drei Dinge, die gut sind (Three Blessings)
8.1.2 Entdecke und lebe deine Stärken
8.1.3 Dankesbrief (Gratitude letter) und Dankbarkeitstagebuch
8.1.4 Active-Constructive Responding (ACR) – Positive Kommunikation
8.1.5 „One door opens“ und die ABCDE-Methode
8.1.6 REACH – Vergeben
8.1.7 Genießen (Savoring), Make a perfect day
8.1.8 Nachruf
8.1.9 Zufriedenheit mit dem, was ich geschafft habe – Satisficing versus Maximising
8.1.10 Stammbaum der Stärken
8.1.11 Acts of Kindness und Perfect Surprise
8.1.12 Ziele anstreben und erreichen
8.1.13 Religion und Spiritualität praktizieren
8.1.14 Auf den Körper achten
8.2 Zusammenfassung
Literatur
9 PERMA: Die Macht der Positiven Gefühle
9.1 Zehn Positive Emotionen
9.2 Wie wirken Positive Emotionen?
9.2.1 Der Broadening-Effekt
9.2.2 Der Building-Effekt
9.2.3 Der Undoing-Effekt
9.3 Die Theorie der Aufwärtsspirale der Lebensstiländerung
9.4 Die Macht der spontanen Positiven Gedanken
9.5 Leidenschaften und spontane Positive Gedanken
9.6 Positivität messen: der Positive Ratio Test nach Barbara Fredrickson
9.7 Die Macht der Positiven Gefühle – Positivität entwickeln und stärken
9.7.1 Micromoments of Positivity (Mikromomentpraktiken)
9.7.2 Positivität priorisieren
9.7.3 Wenn-dann-Pläne
9.7.4 Positive Portfolios
9.7.5 Der positive Werkzeugkasten
9.8 Zusammenfassung
Literatur
10 PERMA: Flow – das Geheimnis von Engagement
10.1 Formen des Flow
10.2 Was bewirkt Flow?
10.3 Wie kommen Menschen in den Flow?
10.3.1 Handlungsanleitungen, um zu Flow-Erleben zu kommen
10.3.2 Ideen, um häufiger in den Flow zu kommen
10.4 Der Weg zur autotelischen Persönlichkeit
10.5 Zusammenfassung
Literatur
11 PERMA: Positive Beziehung – unentbehrlich für Well-being
11.1 Wege zu Positiven Beziehungen
11.1.1 Weg 1: Die Vorschläge von Chris Peterson
11.1.2 Weg 2: Enge Beziehungen und Familie pflegen
11.1.3 Weg 3: Resonanz aufbauen
11.1.4 Weg 4: Empathie, Altruismus und Mitgefühl kultivieren
11.1.5 Weg 5: Die sieben Säulen der gelingenden Beziehung leben
11.2 Zusammenfassung
Literatur
12 PERMA: Sinn beflügelt
12.1 Definitionen des Sinnerlebens
12.2 „Mattering“ statt „Meaning“
12.3 Aspekte des subjektiven Sinnerlebens
12.4 Das Meaning-Making-Modell
12.5 Sinnfindung als (Über-)Lebensstrategie
12.6 Sinnfindung nach Paul Wong
12.7 Sinnerleben und die Positive Psychologie 2.0
12.8 Zusammenfassung
Literatur
13 PERMA: Erfolg lässt aufblühen
13.1 Wie gelingt Accomplishment?
13.2 Zielkonstruktion
13.3 Arten von Zielen
13.4 Tugenden zur Zielerreichung
13.5 Everest-Ziele
13.6 Ziele und freier Wille
13.7 Ziele und Selbstwirksamkeit
13.8 Ziele und GRIT
13.9 Zusammenfassung
Literatur
14 Motivation & Positive Psychologie – warum streben Menschen nach Wohlbefinden?
14.1 Was ist Motivation?
14.2 Die Bedürfnispyramide
14.3 Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (2004)
14.4 Zusammenfassung
Literatur
15 Achtsamkeit – das Tor zur Positiven Psychologie
15.1 Achtsamkeit und Positive Psychologie
15.2 Achtsamkeit und Meditation
15.3 Grundbedingungen und Wurzeln der Achtsamkeit
15.4 Achtsamkeit in der westlichen Welt
15.5 Beispiele für Achtsamkeitsübungen
15.6 Entspannungsmethoden zur Förderung von Achtsamkeit
15.7 Achtsamkeit und (Selbst-)Mitgefühl
15.8 Zusammenfassung
Literatur
16 „We can come back“: Resilienz und Positive Psychologie
16.1 Was ist Resilienz?
16.2 Das 7-Säulen-Konzept der Resilienz
16.3 Positive Psychologie und Resilienz
16.4 Das Master Resilience Training
16.5 Zusammenfassung
Literatur
17 Positive Erziehung – wie sich unsere Kinder nachhaltig positiv entwickeln und aufblühen können
17.1 Begrifflichkeiten
17.2 Positive Parenting
17.2.1 Die Stärken der Kinder entdecken
17.2.2 Der Ansatz von Lea Waters
17.2.3 Das Modell von Lerner und Lerner
17.3 Positive Education – Wohlbefinden an der Schule lernen und lehren
17.3.1 Das Penn Resilience Program (PRP)
17.3.2 Positive Education als ganzheitliches Konzept an Schulen – das Programm der Geelong Grammar School
17.3.3 Positive Education international – die Entstehung des IPEN (International Positive Education Network)
17.3.4 Positive Education in Deutschland und Österreich – das Modell von Fritz-Schubert
17.3.5 Das PERMA.teach-Projekt
17.3.6 Weitere Projekte
17.4 Zusammenfassung
Literatur
18 Das Beste liegt noch vor uns – Altern und Positive Psychologie
18.1 Positives Altern
18.2 Altern aus neurobiologischer und psychologischer Sicht
18.3 Lebensqualität in höherem Alter
18.4 Zusammenfassung
Literatur
19 Positive Leadership: Wege zu außergewöhnlichem Erfolg
19.1 Positive Führungsmodelle
19.2 Positive Leadership nach Kim Cameron
19.2.1 Positives Arbeitsklima
19.2.2 Positive Beziehungen
19.2.3 Positive Kommunikation
19.2.4 Positive Meaning
19.3 Positive Leadership einführen
19.4 Zusammenfassung
Literatur
20 Körperlich und seelisch fit für das gelingende Leben – Positive Psychologie und Gesundheit
20.1 Definitionen von Gesundheit
20.2 Positive Psychologie und Positive Gesundheit
20.2.1 Denke und handle positiv
20.2.2 Entspanne – Relax
20.2.3 Schlaf gut – Sleep
20.2.4 Iss was Gutes – Eat
20.2.5 Bewege dich
20.2.6 Glückshormone und Körpertemperatur
20.2.7 Sitzen ist das neue Rauchen
20.2.8 Sport verändert das Epigenom
20.2.9 Bewegung bei Jugendlichen
20.3 Zusammenfassung
Literatur
21 Positive Kommunikation
21.1 Was ist Positive Kommunikation?
21.1.1 Positive Kommunikation ist aktiv-konstruktiv
21.1.2 ACR nicht nur bei Schönwetter
21.1.3 Strategien achtsamer Kommunikation
21.1.4 Positiv-provokative Kommunikation
21.1.5 Killer von Positiver Kommunikation
21.1.6 Positive Kommunikation von A bis Z
21.2 Grundvoraussetzungen Positiver Kommunikation
21.2.1 Der „Stark und Positiv“-Ansatz nach Streit
21.2.2 Weisheit und Positive Kommunikation
21.2.3 Positive Kommunikation und Kommunikationstheorien
21.3 Zusammenfassung
Literatur
22 Positives Coaching – wie in Beratungs- und Coachingprozessen außergewöhnliche Ergebnisse erzielt werden können
22.1 Was ist Coaching?
22.2 Verschiedene Coaching-Ansätze
22.3 Grundannahmen des Positiven Coachings
22.4 Positives Coaching in der Praxis
22.5 Zusammenfassung
Literatur
23 Positive Psychotherapie – von seelischen Leidenszuständen hin zum persönlichen Aufblühen und Wachstum
23.1 Was ist die Positive Psychotherapie?
23.2 Positive Psychotherapie in der Praxis
23.2.1 Positive Psychotherapie im Einzelsetting
23.2.2 Positive Psychotherapie im Gruppensetting
23.3 Zusammenfassung
Literatur
24 Stark und Positiv in Erziehung, Lehre und Führung – ein Modell nicht nur für herausfordernde Kontexte
24.1 Herausforderungen für Erziehung, Lehre und Führung
24.2 Psychologische Grundbedürfnisse und Herausforderungen
24.3 Inadäquates Handeln und Störungsgenese
24.4 Notwendigkeiten für souveränes Handeln
24.5 Basismodelle für Stärke und Positivität
24.5.1 Das Modell der Positiven Jugendentwicklung von Richard und Harriet Lerner
24.5.2 Das PERMA-Modell von Martin Seligman
24.5.3 Die Neue Autorität von Haim Omer
24.5.4 Positive Leadership von Kim Cameron
24.5.5 Gemeinsam unwiderstehlich
24.6 10 Stark-und-Positiv-Werkzeuge
24.6.1 Resonanz und Struktur aufbauen
24.6.2 Sei wachsam und präsent!
24.6.3 Bleibe in schwierigen Situationen ruhig!
24.6.4 Bleib nicht allein – etwas mehr Hirn, bitte!
24.6.5 Stärken stärken stärkt
24.6.6 Widerstand statt Strafe und Härte
24.6.7 Sinn verleiht Flügel – das große Ganze sehen
24.6.8 One Door Opens – eine Türe öffnet sich für uns selbst und andere
24.6.9 Fördere Wiedergutmachung
24.6.10 Entwickle Ziele und bleib beharrlich
24.7 Zusammenfassung
Literatur
25 Die Zukunft der Positiven Psychologie – Gelingen in der Welt von gestern, heute und morgen
25.1 Von erlernter Hilflosigkeit zu Optimismus und Hoffnung – über die innovative Kraft der Positiven Psychologie
25.2 Kritik an der Positiven Psychologie
25.2.1 Die vier starken Kritiken
25.2.2 Die drei schwachen Kritiken
25.3 Wellen der Positiven Psychologie
25.3.1 Positivity: die erste Welle der Positiven Psychologie
25.3.2 Polarity: die zweite Welle der Positiven Psychologie
25.3.3 Complexity: die dritte Welle der Positiven Psychologie
25.3.4 Globality: die vierte Welle der Positiven Psychologie – Flourishing in einer von Krisen geschüttelten Welt
25.4 Positive Psychologie als gesellschaftlicher, politischer Faktor
25.5 Hoffnung und Zuversicht: die neuen Elemente einer Positiven Psychologie der Zukunft
25.5.1 Die Hoffnungstherapie von Lopez
25.6 Agency – Triebkraft positiver Veränderung und des Fortschritts
25.7 Prospektion und Positive Psychologie
25.7.1 Was ist Prospektive Psychologie?
25.7.2 Prospektion – ein neues Paradigma für Coaching, Therapie und Beratung
25.7.3 Prospektion und Positive Psychologie
25.7.4 Das RET-Modell
25.8 Zusammenfassung
Literatur
26 Anhang
26.1 Die deutsche Version der Satisfaction of Life Scale (SWLS)
26.2 Scale of Positive and Negative Experience (SPANE)
26.3 Der Stärken-von-Kindern-Test von Katherine Dahlsgaard
26.4 IPPM-Arbeitsblätter nach Tayyab Rashid zur Ermittlung von Signaturstärken
26.5 PERMA-Profiler
26.6 Positivitäts-Fragebogen (Fredrickson, 2009)
26.7 Mental Health Continuum nach Corey Keyes (2002)
26.8 Golden Mean
26.9 Nützliche Links & Adressen
Geleitwort von Roy F. Baumeister
Präsident der Internationalen Vereinigung für Positive Psychologie
Die Positive Psychologie trat in den 1990er-Jahren als eine zentrale Initiative von Martin Seligman als Präsident der American Psychological Association auf den Plan. Sie knüpfte an eine Tradition an, die mindestens auf Maslow und Rogers zurückgeht, und vertrat die Auffassung, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Sie erkannte an, dass die Psychologie den Schattenseiten des Lebens – einschließlich Trauma, Aggression, Geisteskrankheit usw. – Vorrang einräumen muss. Gleichzeitig bestand sie aber darauf, dass die Schattenseiten nicht alles sein sollten, was es gibt. Freud soll etwas zynisch bemerkt haben, dass das Ziel der Psychotherapie darin bestehe, neurotisches Elend durch gewöhnliches Unglücklichsein zu ersetzen. Er hat sich nicht viel darum gekümmert, wie man das Glück vermehren kann. Auch das war ein vernünftiger Anfang, aber kein befriedigendes Ende. Die Positive Psychologie ist aggressiv in diese Lücke gestoßen und hat nie zurückgeblickt.
In den folgenden Jahrzehnten hat sich die Positive Psychologie zu einem globalen Phänomen entwickelt. Praktikerinnen helfen Menschen, auch solchen, die keine Probleme mit psychischen Erkrankungen haben, wie z. B. in dem rasch expandierenden Bereich des Coachings. (Coaching ist nicht mehr nur etwas für Sportler und Führungskräfte.) In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche Forschungspsychologen mit den grundlegenden Fragen beschäftigt, wie man Glück und Wohlbefinden steigern kann.
Es ist verständlich, dass die humanistischen Psychologen und Psychologinnen in der Nachfolge von Maslow über das Aufkommen eines neuen Fachgebiets, das sich mit vielen der gleichen Themen und Ziele befasste wie ihr Fachgebiet, sehr erfreut waren. Doch es sollte einen wichtigen Unterschied geben. Die humanistische Psychologie umfasste alle Arten von positiven Erfahrungen – ging dabei aber weit über das hinaus, was die strenge Wissenschaft behandeln konnte. Viele von uns bedauerten den Verlust an wissenschaftlicher Strenge und damit auch an breiter Glaubwürdigkeit. Seligman bestand von Anfang an darauf, dass die Positive Psychologie eine solide Grundlage in der Forschung behalten sollte.
Das vorliegende Buch versteht sich als eine Einführung, aber das ist viel zu bescheiden. Es ist eine leistungsstarke, endgültige Ressource. Dieses Buch als
Einführung in die Positive Psychologie zu bezeichnen, ist in etwa so, als würde man eine 30-jährige Ehe als Einführung in eine romantische Beziehung bezeichnen! Dieses Buch bietet alles, was man wissen muss, um bezüglich der heutigen Positiven Psychologie auf dem Laufenden zu sein. Es liefert Hintergrund und Kontext und enthält sogar eine praktische Einführung in das Gehirn. Es behandelt die Geschichte dieses jungen Fachgebiets. Es stellt viele der zentralen Ideen vor, die das Feld geprägt haben: Flow, Wohlbefinden, PERMA, Aufblühen, Achtsamkeit, die 24 Charakterstärken. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Messgrößen und Skalen, die zur Beurteilung von Menschen und deren Fortschritt verwendet werden können. Es stellt die verschiedenen Interventionen vor, die Forscherinnen und Therapeuten als wirksam für die Verbesserung des Wohlbefindens erachtet haben. Es deckt Anwendungen ab, von der Erziehung glücklicher, gedeihender Kinder über die Stärkung der geistigen und körperlichen Gesundheit im Erwachsenenalter bis hin zur Frage, wie Führungskräfte die Kraft positiver Eigenschaften nutzen können.
Ich hoffe, dass dieses wunderbare Buch viele junge Menschen dazu inspirieren wird, die Positive Psychologie in ihrem Berufs- und Privatleben anzuwenden. (Ältere Menschen sind natürlich auch willkommen!) Wenn möglich, sollten Sie versuchen, sich in der Gemeinschaft der Positiven Psychologie zu engagieren. Eine Sache, die mir an der Positiven Psychologie besonders gut gefallen hat, sind die Menschen. Im Gegensatz zu vielen Fachkonferenzen, auf denen sich viele mürrische Teilnehmende über die Mängel in der Arbeit der anderen beschweren und über die persönlichen und beruflichen Angelegenheiten der anderen tratschen, strahlen die Treffen der Positiven Psychologie in der Regel ein schönes Gefühl der gegenseitigen Unterstützung und konstruktiven Begeisterung aus. Dies war auch bei der Innsbrucker Konferenz 2024 der Fall, bei der dieses Buch in Manuskriptform der Welt vorgestellt wurde. Die tatkräftige Beteiligung zahlloser Personen ist eine der Stärken der Positiven Psychologie und ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass dieses Gebiet noch jahrzehntelang florieren wird!
August 2024
Roy F. Baumeister
Geleitwort von Dr. Gunther Schmidt
Wenn man die Entwicklung der Konzepte der Positiven Psychologie in den letzten 25 Jahren im europäischen und insbesondere im deutschsprachigen Raum überblickt, weist sie eine beeindruckende Erfolgsdynamik auf. Um diesen Prozessen gerecht zu werden, ist ein Buch wie dieses hier längst überfällig. Sehr angemessen finde ich dabei, dass es gerade von Philip Streit und seinen Kolleginnen verwirklicht wird. Denn so wie ich diese Entwicklung in Europa erleben konnte, nicht nur im deutschsprachigen Raum, hat dafür niemand nur annähernd ähnlich große Verdienste erreicht wie Philip Streit. Seit ca. 20 Jahren hat Philip z. B. durch die Organisation großer Kongresse in Österreich, Deutschland und der Schweiz und durch viele fundierte Weiterbildungen die Positive Psychologie einem sehr großen Publikum bekannt gemacht, wahrscheinlich sogar viel wirksamer, als es durch die Publikationen von Martin Seligman und seinen Kollegen in diesem Teil der Welt selbst gelungen wäre. Inzwischen haben Hunderte von professionellen Experten im psychosozialen Raum Curricula zur Positiven Psychologie durchlaufen und haben darauf aufbauend eine umfassende multiplikatorische Wirkung in ihren Berufsfeldern bewirkt. Diese Entwicklung, so kommt es mir vor, ist nicht nur nicht mehr aufzuhalten, sondern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erst noch eine viel größere Kraft in den nächsten Jahren entfalten. Dieses Buch hier, da bin ich mir sicher, wird dazu tatkräftig beitragen.
Gerade weil die Entwicklung in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern so stürmisch vorwärts gegangen ist, kann man dadurch aber auch schnell den Anschluss daran und die Übersicht darüber verlieren. Dieses Werk schafft einen wunderbar klaren Überblick, in welchen wichtigen Bereichen der Arbeit von Menschen mit Menschen inzwischen wertvollste Anwendungen der Positiven Psychologie zurecht erfolgreich Fuß gefasst haben. So ermöglicht es auch wieder vielen an diesen Konzepten Interessierten, sich vertieft mit ihnen auseinanderzusetzen und so zur weiteren Verbreitung beizutragen.
Sehr gerne steuere ich zu diesem Buch ein Vorwort bei. Denn die hier umfassend dargelegten Konzepte der Positiven Psychologie entsprechen ganz dem Denken und den konzeptuellen Vorstellungen, die mich Ende der 1970er-Jahre zu Milton Erickson gebracht und mich danach dazu angeregt haben, auf der Basis auch der systemisch-konstruktivistischen Konzepte den hypnosystemischen Ansatz zu entwickeln. Milton Erickson hat schon seit den 1930er-Jahren in seinem Modell der Hypno- und Psychotherapie konsequent eine Kompetenz- und Ressourcen-orientierte Haltung und Vorgehensweise vertreten. Dieses Modell, welches eine sehr deutliche Alternative zu den damals allgemein vorherrschenden Pathologie- und Defizit-fokussierenden, insbesondere den psychoanalytischen, aber auch den behavioristischen Konzepten darstellt, wurde von manchen Vertretern dieser Mainstream-Psychologie-Konzepte über Jahrzehnte massiv bekämpft. Heute zeigt sich, wenn man die Ergebnisse der modernen Hirn-, Gedächtnis-Priming- und Wahrnehmungsforschung berücksichtigt, dass Erickson damals in vielerlei Hinsicht seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. So war es auch eine fast zwingende logische Folge daraus, dass z. B. Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in ihrem lösungsfokussierenden Konzept und ich in der hypnosystemischen Konzeption dies dann darauf aufbauend weitergeführt haben.
Die Positive Psychologie führt nun diese Erickson’sche Tradition konsequent fort. Sie trägt so zu einer deutlich gestärkten umfassenderen Verbreitung dieser Denk- und Handlungsmodelle bei.
Fokussierung der Aufmerksamkeit, deren multivalente Vielschichtigkeit und Positive Psychologie als eine Konstruktives schaffende Kraft
Aus der hypnosystemischen Sicht, die sich auch an den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung orientiert, kann davon ausgegangen werden, dass jedes Erleben durch Prozesse der Aufmerksamkeitsfokussierung erzeugt wird. Diese muss nicht unbedingt bewusst gesteuert eingesetzt werden, üblicherweise geschieht der größte Teil der Aufmerksamkeitsfokussierung unbewusst und unwillkürlich. Alle Interventionen im Rahmen der Positiven Psychologie, ja insgesamt das gesamte Konzept der Positiven Psychologie stellen aus dieser Sicht ein systematisch strukturiertes Modell der gezielten Aufmerksamkeitsfokussierung dar, wobei dies dabei aber ganz willentlich bewusst eingesetzt wird. Damit wird selektiv ein Erleben angeregt, welches von Menschen in aller Regel als wohltuend, Gesundheit fördernd und insgesamt bereichernd erlebt wird.
Dabei zeigt sich aber auch eine sehr interessante und wichtige mehrschichtige Tendenz, die man auch als angeborene Ambivalenz oder sogar Multivalenz in der menschlichen Erlebnis-Dynamik bezeichnen könnte. In der Evolutionsbiologie und der Paläoanthropologie gibt es seit Langem weitgehenden Konsens dazu, dass Menschen eine offenbar angeborene Tendenz zu Worst-case-Szenarien haben. Dies stellt aber keineswegs eine Unfähigkeit dar. Vielmehr war es wohl entscheidend für das Überleben der Spezies in den vielen Hunderttausenden von Jahren der menschlichen Entwicklungsgeschichte, in denen unsere Vorfahren ständig massiven Gefahren ausgesetzt waren. Der Hirnforscher Joseph Le Doux („Das Netz der Gefühle“) hat dies auf die charmante Formel gebracht, es habe in der Evolution die „Schnellen und die Toten“ gegeben. Mit den „Schnellen“ meint er dabei die schnell Angst- und Defizit-Fokussierungs-Bereiten, die eher immer „das Glas halb leer“ sehen, mit den „Toten“ meint er die einseitig eher immer positiv und optimistisch Gestimmten, die lieber „das Glas immer halb voll“ sehen und die dann eben manche Gefahren nicht genügend beachtet haben könnten und so ihre Gene nicht genauso erfolgreich weitergeben konnten wie die Angst-Bereiten. So gesehen sind wir heutigen Menschen vermutlich vor allem die Erben der tendenziell zunächst auch schnell negativ Gestimmten und Angst-Bereiten. Als Teil dieser negativ gefärbten Sicht kann wahrscheinlich auch die Weltsicht gesehen werden, es gehe in der Natur und insbesondere auch bei Menschen vor allem um Konkurrenz, Egoismus und darum, dass sich die Stärkeren letztlich immer gegen Schwächere durchsetzen wollten („das egoistische Gen“). Die gerade aufgeführten Überlegungen weisen auch darauf hin, dass die Welt leider nicht an sich positiv ist und die Menschen sind es auch nicht im Sinne eines vorgegebenen Seins, es bedarf jedes Mal wieder einer Entscheidung dafür, in welche Welt jemand „gehen“ will, die „Tür“ zur „negativen“ Welt steht jederzeit auch offen und viele Menschen wählen sie.
Angesichts von Völkermord, Folter, Gewalt an Kindern und anderen, Ausbeutung, Unterdrückung, Menschenhandel, noch immer Sklaverei usw., Kriegen und imperialistischen Machtspielen, ständiger Missachtung der Würde anderer Menschen (und Tiere) ist es alles andere als selbstverständlich, wenn sich jemand für Positives entscheidet. Ich kann jeden Menschen verstehen, der an diesen ständig immer wieder neu auftauchenden fürchterlichen Phänomenen verzweifelt, zynisch und verbittert reagiert. Das Schlimme dabei ist aber eben, dass solche Reaktionen vor allem den Leidenden selbst noch mehr schaden.
Menschen sind nicht an sich gut, Menschen sind zu allem fähig, man muss ja nur täglich die Nachrichten hören oder sehen. Menschen sind aber eben auch zu allem Guten fähig, die Frage ist letztlich immer, wofür sich jemand entscheidet. Und dass Menschen zu Entscheidungen fähig und nicht nur z. B. Opfer ihrer Vergangenheiten usw. sind, davon können wir nach allen Ergebnissen der Wissenschaft sehr wohl ausgehen.
Aus systemischer und hypnosystemischer Sicht ist dabei allerdings auch wichtig, wie die jeweiligen Kontextbedingungen gestaltet sind, in denen solche Entscheidungen entwickelt werden. Alle systemischen Erkenntnisse weisen klar darauf hin, dass die Art, als welche Umwelt die jeweiligen Kontextbedingungen von Menschen erlebt werden, als extrem wichtige „Einladungsbedingungen“ dafür wirken, wie sich jemand entwickelt. Dies macht auch deutlich, dass Positive Psychologie sich nicht nur auf die individuelle Lebensgestaltung beziehen darf, sondern die systemischen interaktionellen, organisatorischen und auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen genauso wichtig nehmen muss.
Gerade hinsichtlich dieser Ambi- und Multivalenzen stellt die Positive Psychologie eine Mut und Hoffnung stärkende Vorgehenswiese und Weltsicht dar,
die dabei hilft, für eine Welt mit Lebensfreude, wechselseitiger Wertschätzung, Neugier und Achtung zu sorgen.
Die beeindruckenden Ergebnisse der Forschung zur Positiven Psychologie zeigen auch deutlich, wie hilfreich deren Interventionen für das Erleben von Menschen sein können. Ich schließe daraus, dass es bei uns Menschen eben auch eine angeborene Sehnsucht nach einem Leben in Sicherheit, in gegenseitiger Wertschätzung, mit Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und hoher Kooperationsbereitschaft und einem Erleben wechselseitiger Würde geben muss. Nicht umsonst wird heute sogar vom „kooperativen Gen“ (J. Bauer) gesprochen und davon ausgegangen, dass die menschliche Spezies im Laufe der Evolution nur durch ebensolche Kooperationsprozesse so erfolgreich werden konnte (und nicht nur sie).
Sonst wären aus meiner Sicht auch die gut beforschten, enorm effektiven Wirkungen z. B. der Erickson’schen, der Lösungs-fokussierenden und der hypnosystemischen Konzepte und eben gerade auch die der Positiven Psychologie nicht erklärbar. Sie alle bewirken ja durch ihre gezielte Fokussierungswirkung, dass „schlummernde Potenziale“ in wirksamer Weise reaktiviert werden. Die Formulierung „reaktiviert“ nutze ich hier sehr bewusst, denn die gesamte Hirnforschung zeigt ja klar, dass man von außen durch solche Interventionen nichts „eintrichtern“ kann, sondern (im Sinne der Autopoiese) nur dazu beitragen kann, etwas, was schon im internalen Erlebnisrepertoire vorhanden ist, von innen heraus autonom zu reaktivieren.
Aus den Erkenntnissen der Autopoiese-Forschung kann deshalb auch geschlossen werden, dass Angebote der Positiven Psychologie (im Sinne von Niklas Luhmann) nicht direkt selbst wirken, sondern als sehr wirksame Einladungen für eine hilfreiche und als förderlich erlebte Umfokussierung dienen, die wiederum dann zur Gestaltung einer innerlichen Welterfahrung führt, welche den Empfängern ihrer Botschaften dabei hilft, diese ganz autonom in sich umzusetzen und damit „schlummernde“ Erlebnisnetzwerke aus ihrem unbewussten Erlebnisrepertoire zu reaktivieren. Dies ist übrigens genau das, was z. B. eine wirksame Hypnotherapie und insbesondere die hypnosystemischen Vorgehensweisen machen. So gesehen kann auch gesagt werden, dass die Konzepte der Positiven Psychologie durchaus eine tendenzielle Verwandtschaft zu Hypnotherapie und Hypnosystemik zeigen.
Plädoyer für eine ganzheitlich balancierende non-duale Perspektive im Rahmen der Positiven Psychologie
Nicht selten wird die Positive Psychologie von Unkundigen mit positivem Denken verwechselt. Damit wird dann oft gemeint, alle Dinge und Prozesse immer in erster Linie oder sogar nur „positiv“ zu sehen. Dies stellt ein krasses Missverständnis dar. Es wird wohl von keinem Menschen alles, was jemand erlebt, nur positiv gesehen werden können, z. B. massives Leid, als massiv erlebte Verletzungen, körperlich oder seelisch. Dann von jemandem zu erwarten, dass auch dies als etwas Positives an sich gesehen werden sollte, dürfte wohl bei den meisten Betroffenen zurecht nur als zynisch und missachtend erlebt werden.
In der Positiven Psychologie, so verstehe ich sie, sollten leidvolle Prozesse nicht an sich als positiv bewertet und behandelt werden, vielmehr geht es darum, dann insbesondere für die Betroffenen selbst Möglichkeiten aufzuzeigen, daraus für ihr weiteres Leben Kraft gebende Haltungen zu entwickeln.
Es geht aus meiner Sicht bei der Positiven Psychologie überhaupt nicht um positives Denken in solch undifferenzierter Form. Vielmehr geht es um eine spezifische Einstellung zur Lebensgestaltung, zu Sinnentwicklung und auch um ein Verständnis, dass jede menschliche Existenz in einen das jeweilige Ich transzendierenden größeren Zusammenhang gestellt ist, dessen man sich auch mit Demut bei gleichzeitiger Anerkennung des eigenen Wertes kontinuierlich bewusst bleiben sollte. Damit wird auch deutlich, dass konsistent praktizierte Positive Psychologie auch immer den Aspekt einer achtungsvollen Bezogenheit auf andere Menschen und auch auf andere Lebewesen und die Natur im Allgemeinen mit impliziert (Bezogene Individuation im Sinne von Helm Stierlin).
In dieser Hinsicht weist das Konzept der Positiven Psychologie auch z. B. über Konzepte der Achtsamkeit hinaus. Jedenfalls gibt es in manchen Forschungsergebnissen Hinweise darauf, dass manche AnwenderInnen von Achtsamkeitskonzepten diese so anwenden, dass dabei eher Ego-zentrierte Haltungen verstärkt werden und ebendieser so wichtige Aspekt der Bezogenheit auf diese Weise nicht in eine stimmige Balance mit Individuationsprozessen geführt wird. Da die Positive Psychologie eben auch genau diese zentralen Aspekte einer bezogenen Individuation berücksichtigt, könnte man sie vielleicht auch zusätzlich als „Balance-Psychologie“ bezeichnen.
Dabei würde ich mir aber für viele Anwender der Positiven Psychologie wünschen, dass sie die hier erwähnten Ambi- und Multivalenzen sehr systematisch mit in ihre Interventionsplanungen einbeziehen und nutzen. Die meisten der wertvollen Strategien der Positiven Psychologie sind als willentlich bewusst einsetzbare Maßnahmen konzipiert. Dies hat sehr konstruktive Aspekte, kann es doch die Selbstwirksamkeit von Menschen deutlich stärken. Allerdings werden nach meinem Eindruck die Strategien der Positiven Psychologie ziemlich häufig noch aus der in unserer Kultur noch immer vorherrschenden dualistischen Weltsicht verstanden und angewendet, als ob es „an sich Positives“ oder „an sich Negatives“ gäbe und nicht beachtet wird, dass dies vor allem Kultur-bezogene Realitätskonstruktionen sind. Diese Tendenz ist nicht dem Konzept der Positiven Psychologie vorzuwerfen, sie ist ihm nicht inhärent. Leider neigen aber nicht wenige Anwenderinnen der Positiven Psychologie bisher noch zu dieser Tendenz.
Wenn wir berücksichtigen (was die Hirnforschung und alle hypnosystemischen Belege klar zeigen), dass der größte Teil des Erlebens auf unwillkürlicher Ebene geschieht, also zunächst nicht vom bewussten Willen gesteuert wird, können wir sicher davon ausgehen, dass es auf unwillkürlicher Ebene in den meisten Fällen sehr schnell zu gegenläufigen Impulsen führen kann, dass also z. B. jede konstruktiv gedachte Positive Intervention mit bisher unterschwellig dominierenden „negativen“, z. B. mit Angst-, Aggressions-, Abwertungs-, Zynismus- oder Hoffnungslosigkeits-assoziierten Impulsen blitzschnell unwillkürlich beantwortet wird.
Diese Impulse sehen aus hypnosystemischer Sicht aber nur „negativ“ aus. Man kann mit hypnosystemischen Methoden sehr gut zeigen, dass sie Ausdruck anerkennenswerter Lösungsversuche, Glaubenshaltungen und auch Loyalitätsleistungen sind, die unter Kontextbedingungen entwickelt wurden, die zu dieser Zeit als einzige hilfreiche Möglichkeit für Betroffene erschienen. Insofern können sie ebenfalls als sehr „positiv“ in diesem Sinne, allerdings oft verbunden mit einem hohen Preis für heutige Kontexte, verstanden werden. Sie repräsentieren auch bei ihrem jeweils heutigen Auftauchen genau die wertvollen Bedürfnisse, die im „Damals“ leider nicht oder nicht genug berücksichtigt werden konnten, und stellen damit auch ein kompetentes intuitives Wissen über diese sich auch
„im Heute“ wieder meldenden Bedürfnisse dar. Deshalb sollten sie in dieser Hinsicht geachtet und übersetzt werden, damit sie in erfüllender Weise „im Heute“ genutzt werden können.
Da diese unwillkürlichen (und oft auch zunächst unbewussten) Prozesse aber gerade in Phasen, in denen jemand Probleme erleidet, meist Teil der gerade dominierenden Erlebnis-Netzwerke sind, die in diesen Phasen Teil der vertrauten Identität darstellen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass gerade dann Interventionsstrategien aus der Positiven Psychologie auch Irritationen auslösen können (Destabilisierung der bisher erlebten Homöostase), auf welche dann zunächst unwillkürliche Gegenreaktionen als Versuch folgen, die bisher vertraute Homöostase wiederherzustellen. Erst allmählich werden solche Impulse dann schwächer, wenn die positiven Interventionen lange genug aufrechterhalten werden.
Ich habe schon öfter erlebt, dass z. B. Klienten, denen die wertvollen Interventionsschritte aus der Positiven Psychologie angeboten wurden, dies so verarbeitet haben, dass sie dann eben in deren Sinne vor allem oder nur „positiv“ fokussieren sollten. Wenn dann, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber zu erwarten ist, solche vermeintlich „negativen“ Impulse in ihnen auftauchen, erleben sie das oft als Versagen, kämpfen mit Selbstabwertung dagegen an und schwächen sich so deutlich, verstärken sogar dabei oft ihr Problemerleben. Dies empfinde ich als schade, denn gerade auch diese „negativen“ Impulse stellen eben aus hypnosystemischer Sicht eine andere Art wertvoller Kompetenzen dar, welche sehr stärkend genutzt werden könnten und so die wertvollen Ideen der Positiven Psychologie sogar noch viel wirksamer werden lassen könnten.
Auch die Ergebnisse der WOOP-Forschungen (Oettingen, Rethinking positive thinking) weisen deutlich darauf hin, dass die Ergebnisse z. B. in Therapien und Beratungen signifikant besser und nachhaltiger werden, wenn man nicht nur „positive“ Aspekte berücksichtigt, sondern auch Worst-case-Möglichkeiten systematisch mit einbezieht und dazu strukturierte „Wenn-dann-Pläne“ entwickelt, um im Bedarfsfall sofort effektiv selbstwirksam handlungsfähig sein zu können.
Um diese, man könnte sagen „ganzheitlich positive“ Sichtweise optimal umsetzen zu können, bietet sich besonders der Utilisationsansatz an, den Milton Erickson entwickelt hat und der für mich in der Entwicklung der hypnosystemischen Konzepte zu einer der wichtigsten strategischen Interventionshilfen geworden ist, weshalb ich ihn dafür auch systematisch weiterentwickelt habe. Mit ihm wird möglich, dass jedes Phänomen, also auch sogenannte „negative“, durch die Art, wie man es konstruktivistisch umwertet und sich entsprechend mit ihm in Beziehung setzt, zu einem nutzbaren und damit auch wertvollen Phänomen werden kann.
Positive Psychologie als befreiende, Richtung gebende Fokussierung
Oft wird Anwenderinnen und Anwendern der Positiven Psychologie vorgeworfen, sie würden durch ihre teilweise recht direktiv anmutenden Interventionen unzulässig in die Autonomie ihrer Klienten eingreifen, man solle es vielmehr doch den Klientinnen in ihrer eigenständigen Wahl überlassen, was sie tun oder nicht tun wollen oder sollen. Diese Sicht basiert meiner Meinung nach auf mehreren gut widerlegbaren Prämissen.
Gerade die Erfahrungen aus der hypnosystemischen Arbeit zeigen deutlich, dass es für jemanden, der sich z. B. in massiv niederdrückenden „depressiven“ oder überflutenden Angst-Prozessen oder Flashbacks im Rahmen einer PTBS absorbiert erlebt, enorm schwer sein kann, sich dem Sog dieser intensiv einengend wirkenden Prozesse zu entziehen. Auch die Gedächtnisforschung liefert da Belege, sie zeigt, dass jemand je nach Befindlichkeit unwillkürlich selektiv andere Erinnerungs-, aber auch Zukunftsvorstellungen erlebt (state dependent memory/ state dependent future orientation). Jedes menschliche Erleben kann mit den hypnosystemischen Modellen als Ausdruck von Netzwerkbildungen differenziert beschrieben und genutzt werden. Zwar kann dabei auch praktisch immer gezeigt werden, dass Betroffene in ihrem unbewussten Erlebnis-Repertoire sehr wohl über hilfreiche Lösungskompetenzen verfügen. Diese sind aber während eines Leidensprozesses aus dem gerade dominierenden Erlebnis-Netzwerk oft völlig dissoziiert, sodass jemand aus eigener Kraft nur sehr schwer wieder den Zugang zu diesen Kompetenzen reaktivieren kann. Genau dann schaffen z. B. die klaren, schnell wieder Orientierungshilfe bietenden Interventionen der Positiven Psychologie ausgesprochen wirksame Umfokussierungshilfen.
Dennoch sollten die Bedenken, jemanden womöglich mit diesen Interventionen unter Druck zu setzen, ernst genommen werden. Sie sind aber nur dann relevant, wenn sie im Sinne von „Sie müssen …, Sie sollten …“ angeboten werden. Wenn sie als hypothetische „Einladung“ (dieser Begriff bewährt sich in unserer Arbeit sehr) mit der Betonung der freien Wahl und vor allem mit dem Angebot, achtsam zu beobachten, wie die eigene unwillkürliche Reaktion aus dem Organismus der betreffenden Klienten auf sie „antwortet“, stärken sie kontinuierlich die Autonomie und gleichzeitig die wache Kooperation des Bewusst-Willentlichen mit den unwillkürlichen Prozessen und fördern gerade dadurch wieder eine stabile Gesundheitsentwicklung.
Es ist also auch hier nicht der Inhalt der Angebote, der eventuell ungünstige Wirkungen erzeugen könnte, sondern die Art der Beziehungsgestaltung der Anbieterinnen. Ich habe für eine besonders günstige Haltung beim Anbieten solcher Einladungen den Begriff des „Realitätenkellners“ geprägt. Damit ist gemeint, dass z. B. im Rahmen einer Psychotherapie oder Beratung die jeweiligen Interventionen als „Menü-Angebote“ den „Gästen“ zur freien und auch kritisch getätigten Auswahl vorgelegt werden, mit konsequenter Würdigung auch dann, wenn diese Angebote von den kompetenten „Gästen“ abgelehnt werden sollten. Wird die Positive Psychologie so angewendet, und nur so kenne ich sie in der Art, wie z. B. Philip Streit sie vermittelt, wird sie zu einer hervorragenden Chance der befreienden Umfokussierung und der Reaktivierung „schlummernder“ Kompetenzen und Potenziale.
Gesellschaftliche Bedeutung der Positiven Psychologie
Einfluss auf Erziehung, erfüllendes Altern, Coaching, Führungs-, Team- und Organisationsentwicklung, Gesundheitsentwicklung und Prävention, Psychotherapie, Politik: Die erfreuliche, immer stärker werdende Verbreitung der Positiven Psychologie stärkt in mir auch sehr die Hoffnung darauf, dass sie allmählich auch mehr Einfluss auf unsere gesellschaftspolitische Entwicklung gewinnt. Ich erlebe die Entwicklung der öffentlichen Kommunikationskultur bei uns, insbesondere durch den massiv stärker gewordenen Einfluss der sozialen Medien so, dass sie deutlich aggressiver, abwertender und teilweise in böswilliger Weise negativistischer geworden ist. Darin sehe ich große Gefahren für die Entwicklung demokratischer Gesellschaften. Schon jetzt gibt es vielfältige Belege dafür, dass autokratische, Demokratie-feindliche Bewegungen gezielt auf negative, einseitige Feindbilder aufbauende Angst-Induktions-Prozesse setzen und damit systematisch die Basis pluralistisch orientierter Demokratiesysteme aushöhlen wollen, leider offenbar mit erheblichem Erfolg.
Wir wissen z. B. aus wichtigen Experimenten im Bereich der Priming-Forschung, dass eine unterschwellige, oft latent unbewusste Angst-Dynamik bei vielen Menschen zu Minderheiten-Feindlichkeit, Ausländerhass und reaktionären Positionen führt, oft verbunden mit dem „Ruf nach dem starken Mann“, der dann autoritär und unterdrückend agiert (siehe z. B. die Arbeiten von J. Bargh). Wem immer an achtungsvoll mit Unterschieden umgehenden, neugierig-toleranten Begegnungen in offenen, freien Gesellschaften gelegen ist, sollte das sehr wachsam und aktiv machen. Nicht nur sie, aber sicher auch die Positive Psychologie kann hoffentlich auch hier konstruktive Entwicklungen begünstigen. Je zahlreicher die wissenschaftlichen Belege für ihre günstigen Einflüsse nicht nur für individuelle psychische und körperliche Gesundheitsentwicklung, sondern auch für kulturelle Toleranz und Koexistenz und für achtungsvolle gesellschaftliche Kooperationsprozesse werden, desto mehr erhoffe ich mir, dass dies auch die politische Kommunikationskultur allmählich beeinflussen kann.
Da gerade auch dieses Buch dazu einen wichtigen Beitrag liefern kann, wünsche ich ihm den großen Erfolg und die weite Verbreitung, die es für mich zweifellos verdient.
Dr. med. Dipl. rer. pol. Gunther Schmidt
Leiter des Milton-Erickson-Instituts Heidelberg
Ärztl. Direktor der sysTelios-Klinik für psychosomatische
Gesundheitsentwicklung Waldmichelbach-Siedelsbrunn
Danksagung
Mit diesem Buch ist mir ein großer Wurf gelungen und ich habe vielen dafür zu danken.
Zuallererst Martin Seligman, mit dem mich seit 2009 innige Freundschaft verbindet. Er hat mich immer wieder ermutigt, dranzubleiben. Immer wieder haben wir uns ausgetauscht. Ich habe sehr von seinen „magischen Gedanken“ und seinem kritischen Feedback profitiert. Ohne ihn gäbe es das Kapitel zur Zukunft der Positiven Psychologie nicht.
Besonders habe ich zwei Menschen zu danken: Dr. Gabriele Sauberer und Dr. Martin Wammerl.
Gabriele hat die Möglichkeit aufgetan, das Buch überhaupt zu schreiben. Sie hielt mich beharrlich bei der Stange. Regelmäßig reflektierten wir über die Inhalte des Buchs. Gabriele hat auch die Kapitel über Positive Kommunikation, Resilienz, Sinn und Positive Health verfasst sowie maßgeblich zu den Kapiteln 8, 11, 13, 15 und 19 beigetragen.
Martin Wammerl war und ist der Mann der Wissenschaft, der unermüdlich auf korrekte Zitierung der Quellen geachtet hat. Die Kapitel über Positive Erziehung und Achtsamkeit hat er mitverfasst sowie maßgeblich zu den Kapiteln 20, 22 und 23 beigetragen.
Daher ist es mir eine besondere Ehre, beide als Co-Autoren anzuführen.
Ich danke auch Alina Pritz sehr. Sie hat das Kapitel über Stark und Positiv mitverfasst und in der Endphase unermüdlich Kapitel für Kapitel durchforstet. Dass alles seine richtige Form und den richtigen Stil hat, wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
Ich danke meiner Frau Brigitte für ihre Geduld und Liebe. Immer wieder hat sie mich in die richtige Richtung gewiesen.
Mein Sohn Simon, selbst Psychologe und Biomedical Engineer, war zur Stelle, wenn es etwas zu diskutieren gab, und sorgte für beflügelnden Input. Danke!!!
Durch Barbara Fredrickson entdeckte ich die „Liebe“ neu und verstand, warum Positive Psychologie eine interpersonelle Wissenschaft ist.
Mit Willi Ruch, meinem Studienkollegen, durfte ich mich über Fortschritte und Neuentwicklungen in der Anwendung und Entdeckung von Charakterstärken austauschen. Ich nehme mit: Overuse von Stärken gibt es so nicht.
Danke auch an Suzann Pileggi und James Pawelski für einen entscheidenden Impuls für gelingende Paarbeziehung. Liebe die Stärken des anderen so sehr, dass du bereit bist, dich dafür zu ändern.
Barbara Fredrickson sagte in Melbourne zu mir: „You have to meet this guy.” Und sie hatte recht. Von Michael Steger kamen entscheidende Impulse für das Sinnkapitel.
Zwei Großmeistern der Positiven Psychologie habe ich sehr viel zu verdanken: Roy Baumeister gab mir die Willenskraft, dranzubleiben. Kim Cameron versteht es immer wieder, mich positiv zu führen, und gibt mir das Gefühl, einfach „groß“ zu sein.
„Danke“ auch an Daniela Blickhan. Ihr Buch über Positive Psychologie gab mir wertvolle Anregungen.
Danke auch an Markus Ebner für so manchen Austausch über PERMA Lead. Er half, das Führungskapitel in Form zu bringen.
Einen speziellen Dank an die über 900 Teilnehmenden an meinen EUPPA-Kursen für Positive Psychologie. An ihren Reaktionen konnte und kann ich überprüfen, wie valide und reliabel ich gerade in der Positiven Psychologie unterwegs bin.
Großartig ist es, einen Ort zu haben, an dem im wahrsten Sinn des Wortes der Geist der Positiven Psychologie haust. Diese sind das Institut für Kind, Jugend und Familie und die Akademie für Kind, Jugend und Familie. Tagtäglich leben wir Positive Psychologie mit unseren Kundinnen und Kunden. Danke an dieses großartige Team.
Last but not least danke ich Sigrid Mannsberger-Nindl vom Facultas Verlag für Austausch und Dialog und ihre schier unendliche Geduld.
1 Positive Psychologie – wie alles begann
2005 in Fort Lauderdale, Florida: Ich, Philip Streit, bin Gast beim 2. Kongress für Kurzzeit- und Lösungsorientierte Therapie der Vereinigten Staaten und stelle meine auf systemisch-lösungsorientierter Basis entwickelte Gruppentherapie vor.
Bei dieser Therapieform geht es darum, mit Kindern, Jugendlichen und Familien so zu arbeiten, dass positives Erleben und gelingendes Handeln in den Vordergrund gestellt werden, anstatt das Problem genauestens zu analysieren.
„Etwas schräg ist das schon“, dachte ich damals, als ich mich als gelernter akademischer Psychologe dafür entschied, Steve de Shazers Ansatz auszuprobieren (de Shazer, 2004). „Bei einer echten psychologischen Behandlung brauchst du doch zuerst eine fundierte Situationsanalyse, von der ausgehend das Leiden dann gemindert werden kann, oder doch nicht?“ Doch das lösungsorientierte Vorgehen funktionierte so gut, dass mir die Ehre widerfuhr, darüber in Ford Lautherdale (USA) einen Vortrag halten zu dürfen. Vor Ort überrascht mich Yvonne Dolan, die mich gemeinsam mit Terry Trepper eingeladen hat. Sie bringt mir ein Buch mit. A Primer in Positive Psychology ist darauf zu lesen. Autor: Christopher Peterson (2006). „Das können wir alles schon, was da drinnen steht“, sagt Yvonne.
Weil ich aber nicht immer alles gleich glaube, will ich mich unbedingt beim Autor selbst davon überzeugen. Also fahre ich kurzentschlossen zu Jeff Zeigs Konferenz Evolution of Psychotherapy 2005 und besuche den Workshop von Martin Seligman.
4000 Leute sind in der Halle, als Seligman „Positive Psychology and Positive Interventions“ gibt. Er beginnt mit einer interessanten Aufforderung: „Bitte suchen Sie sich eine Person in dieser Halle aus und stellen Sie sich mit Ihren zwei besten Eigenschaften vor. Bitten Sie im Anschluss auch den anderen, sich so vorzustellen.“ Von einigen lässt er sich dann die besten Eigenschaften wechselseitig berichten. Die Halle bebt.
Aber es wird noch intensiver, als Professor Seligman die Teilnehmenden auffordert, einen Dankesbrief an jemanden zu schreiben, dem sie noch nicht ausreichend gedankt haben. Drei Personen lesen ihren Brief vor. 4000 Teilnehmende schweigen ergriffen.
Was folgt, ist ein Furioso der 14 besten positiven Interventionen. Alles kommt darin vor: „Three Blessings“ (Drei gute Dinge), ein perfekter Tag, der Nachruf,
„Acts of Kindness“, Entdecken und Einsatz von Stärken, Aktiv-Konstruktives Reagieren (ACR) (Lyubomirsky, 2008).
„Aha! So kann Psychologie also auch sein“, denke ich mir überrascht. Als jemand, der seinen Doktortitel in empirischer Psychologie gemacht hat und dem eingebläut wurde, wie wichtig gerade die Anamnese und die Analyse des Vergangenen für psychologisches Arbeiten ist, öffnet dies ganz schön die Augen. In die Zukunft gerichtet, positiv, wissenschaftlich und trotzdem so praktisch, genial! Am selben Tag habe ich auch gleich das Glück, mit Martin Seligman persönlich ins Gespräch zu kommen. „Was steckt hinter dem Ganzen?“, frage ich ihn neugierig. „Die Psychologie erschöpft sich nicht darin, eine Wissenschaft über das Entstehen seelischer Krankheiten und die Minderung des Leidens zu sein. Auch erschöpft sie sich nicht darin, theoretische Konstrukte zu entwickeln, die dann praktisch sowieso nicht angewendet werden können“, antwortet er mir. „Es geht auch darum, eine Psychologie zu entwickeln, deren Fokus auf dem Gelingenden liegt und die die Kluft zwischen Theorie und Praxis schließt. Eine Psychologie für alle Menschen, damit alle zufriedener sein und leben können!“
Mein Interesse ist entflammt und ich beginne nachzuforschen. Mein Entdeckergeist geht mit mir seine Wege. Als es mir 2009 mit meinem Institut für Kind, Jugend und Familie gelingt, Seligman nach Österreich zu holen, wachsen mein Interesse und meine Neugier immer weiter. „Wie hat das alles begonnen?“, frage ich mich.
Ich beginne mit der Recherche und schon bald kommt Überraschendes zutage, mit dem ich nicht gerechnet habe. Seligman, so zeigt das Studium seiner Biografie (Seligman, 2018) und seiner Bücher, war schon immer einer, der gegen den Strom geschwommen ist. Das würde man gar nicht annehmen vom Erfinder der erlernten Hilfslosigkeit (Peterson, Maier & Seligman, 1993), einer Theorie, die besagt, dass Mensch und Tier in Situationen der Ausweglosigkeit dazu tendieren, hilflos zu reagieren, und dann nicht mehr in der Lage sind, aus der Situation zu entkommen. Die Hilflosigkeit sei einfach antrainiert, konditioniert, erlernt. Aufgrund dieser Erkenntnisse gilt Seligman als einer der ganz Großen in der psychologischen Forschung.
Doch seine Biografie enthüllt auch, worum es ihm mit jener Forschung wirklich gegangen ist. Sein Ziel war es zu erforschen, wie Menschen in sehr schwierigen, verzweifelten Situationen, die zu Depression führen, zu helfen ist, anstatt das Phänomen der erlernten Hilfslosigkeit nur zu beschreiben. Aus diesem Grund setze er sich auch energisch dafür ein, dass die Klinische Psychologie Teil der wissenschaftlichen Psychologie wird (Seligman, 1998). Gar nicht so einfach, im behavioristischen, empiristischen und theoretischen Klima der amerikanischen Psychologie in den 1960er- und 1970er-Jahren. Viele Jahre später revidiert Seligman seine eigene Theorie der erlernten Hilfslosigkeit, wie wir später noch sehen werden, und zeigt auf, dass Menschen in scheinbar aussichtslosen Situationen doch dazu in der Lage sind, konstruktiv Lösungen zu finden.
Und noch etwas stellt Seligman immer wieder zur Diskussion: Er will die Kluft zwischen Theorie und Praxis in der Psychologie schließen. Laut ihm muss die psychologische Forschung verständlich, präzise, klar und praktisch sein. Sie darf nicht im Elfenbeinturm der Theorie verbleiben, sondern muss für alle anwendbar sein.
1.1 Die Erfindung und Entwicklung der Positiven Psychologie
Als Martin Seligman 1998 zum President Elect der American Psychology Association (APA) gewählt wird (mit der größten Mehrheit bisher), wird der von ihm schon in den Jahren davor angedachte Weg nach der erlernten Hilfslosigkeit, der Klinischen Psychologie, dem erlernten Optimismus und der Präventionsforschung ein weiteres Kapitel in seinem wissenschaftlichen Weg aufschlagen.
Die Positive Psychologie nimmt Formen an. Ausschlaggebend dafür war die Erkenntnis, wie Seligman erzählt, dass nicht alle Hunde und Menschen in ausweglosen Situationen hilflos reagieren. Circa ein Drittel bleibt im Gegensatz zu den anderen, trotz der Unentrinnbarkeit der Situation, stark. Seligman hatte außerdem bemerkt, dass Menschen, die optimistisch sind, ihre Stärken nutzen, Positive Gefühle entwickeln und zufrieden mit ihrem Leben sind, sich allgemein wohler fühlen, resilienter sind und besser mit schwierigen Situationen umgehen können. Des Weiteren konnte er die Erfahrung machen, dass Menschen zwar durchaus glücklich waren, wenn sie „einen draufmachten“, einen Film ansahen oder ein Eis aßen. Wenn sie allerdings anderen halfen, sie zum Beispiel beim Schneewegräumen unterstützten oder ihnen Nachhilfe gaben, verlief ihr Tag nochmals besser und die positiven Gefühle hielten noch länger an. Der Grund dafür scheint, dass „einen draufzumachen“, einen Film zu schauen etc. externe Belohnungen sind. Aber wenn man für jemand anderen etwas tut, kommen die Bestärkung und die Belohnung von innen.
Doch zu guter Letzt war wohl die Erfahrung mit seiner Tochter Nikki die entscheidendste. Diese hüpfte und sauste wieder einmal im Garten der Seligmans herum, als Seligman den Rasen mähen und seine Rosen pflegen wollte. Also meckerte er seine Tochter an, doch endlich brav zu sein und Ruhe zu geben. Nikki antwortete ihm darauf nur: „Weißt du, Papa, bis zum Alter von 5 Jahren habe ich jeden Tag geweint. Dann habe ich beschlossen, nicht mehr zu weinen, weil es so besser ist. Das war eine sehr schwere Entscheidung, aber es ist mir gelungen. Wenn mir das gelingt, dann kann es dir doch auch gelingen, nicht immer so ein Miesepeter zu sein.“ Seligman erzählt: „Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte immer das Negative vor Augen und war immer ein klassischer Pessimist oder ein echter Miesepeter. So kam dann der Anreiz, eine neue Richtung in der Psychologie einzuschlagen.“
Zum Jahreswechsel 1997/1998 luden Martin und Mandy Seligman Mike (Mihály) Csíkszentmihályi und seine Frau sowie Ray Fowler, den Direktor der American Psychology Association, nach Akumal, Mexiko, in das Haus der Grateful Dead, einer psychodelischen Rockband, im Ort Yal Ku ein. Dort wollten sie über die Positive Psychologie sprechen.
Ray Fowler war ein väterlicher Freund von Martin Seligman, der ihn schon vor seiner Zeit als APA President Elect immer wieder begleitet hatte und wichtig bei der Entwicklung neuer Projekte war. Mihály Csíkszentmihályi, den Erfinder des Flows, hatte Seligman bei einem Urlaub auf Hawaii im Kona Village getroffen. Dieses erste Akumal-Treffen bestand hauptsächlich aus orientierenden Diskussionen, was genau die Hauptessenz der Positiven Psychologie sein sollte, und war insbesondere der Namensgebung dieses neuen Teilgebiets der Psychologie gewidmet.
Seligman berichtet: „Wir waren vorerst dem Wort positiv gegenüber skeptisch, weil wir dachten, es wäre vielleicht zu amerikanisch, und das Wort Psychologie dazu zu schlagwortartig. Dennoch war es eine gemeinsame Entscheidung. Der Begriff ‚Positive Psychologie‘ war einfach das Beste, was uns einfiel.“ (Seligman, 2018) Die Positive Psychologie sollte allerdings nicht im Gegensatz zu einer „Negativen Psychologie“ stehen, sondern vielmehr eine wichtige Ergänzung der etablierten Psychologie darstellen.
Im August 1998 hielt Seligman dann seine Inaugurationsrede als Präsident der American Psychology Association (APA) und präsentierte das Projekt „Positive Psychologie“. Dort erzählte er die Geschichte von seiner Tochter Nikki und berichtete, dass Positive Psychologie der Schwerpunkt seiner Tätigkeit als APA-Präsident werden würde. Er erklärte, dass es um mehr ginge als nur darum, präventiv zu forschen, denn Prävention zu verwenden hieße, Behandlungsmethoden, die bei Kranken geholfen hatten, auch bei Gesunden anzuwenden. Doch es brauche einfach mehr! Es brauche eine Psychologie und eine Forschung, die es ermöglichen, systematisch Faktoren festzustellen, wie Menschen mit ihrem Leben zufriedener sein und sich wohler fühlen könnten.
Psychologie, so sagte Seligman in seiner Antrittsrede, sei von einer Wissenschaft der Gesundheit zu einer Wissenschaft der Krankheit verkommen. Im Rahmen des National Institute for Mental Health und gemeinsam mit dem DSM-IV seien die Psychologen willfährige Erfüllungsgehilfen von Psychiatern geworden, um Kriterien für psychische Erkrankungen zu finden. Nicht, dass dies nicht erfolgreich gewesen war. So konnten in der Vergangenheit 16 Kategorien für psychische Krankheiten gefunden und ihre Entstehungsbedingungen dargelegt werden. Für zwei spezifische Krankheiten, nämlich Panikstörungen und bestimmte spezifische Phobien, konnten sogar Heilungsmaßnahmen beschrieben werden (Seligman, 2003). Trotzdem gehe es um mehr, nämlich um eine neue Richtung der Psychologie, die nicht nur die Heilung von Leid, sondern Wohlfühlen und Aufblühen im Fokus habe. Und es gehe um eine Psychologie, die wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praktisch anwendbar sei.
Die Zustimmung innerhalb der APA war viel größer, als Martin Seligman es sich erhofft hatte. Vor allem der praktisch tätige Teil der Psychologinnen und Psychologen brachte dem neuen Ansatz viel Interesse und Begeisterung entgegen. Auf der Fahrt nach Venedig 2009 fragte ich Seligman einmal, wie denn die etablierte wissenschaftliche Psychologie in Amerika auf seine bahnbrechende Antrittsrede reagiert hatte. „Man hätte mich exkommuniziert“, antwortete er, „hätte ich nicht Martin Seligman geheißen!“
Schon im Jänner 1998 schrieben Mihály Csíkszentmihályi und Martin Seligman einen Brief an 45 Nachwuchswissenschaftler im Bereich der Psycho- logie und angrenzender Wissenschaften und luden sie ein, mit ihnen gemeinsam am Projekt „Positive Psychologie“ zu arbeiten. Mit 18 dieser Personen, darunter auch Professor Willibald Ruch, ein Studienkollege von mir, verbachten sie – wiederum in Akumal – sechs Tage mit intensiver Diskussion über die Anwendungsbereiche der Positiven Psychologie, darüber, wie die Ziele der Positiven Psychologie umgesetzt werden könnten. Es wurde festgelegt, welche Ziele und welche Inhalte eine positive Wissenschaft haben sollte. Das Akumal-Manifest war entstanden, das erste Positive Netzwerk war gegründet. 2001 wurde das Manifest im American Psychologist, der angesehensten psychologischen Fachzeitschrift, veröffentlicht und der erste Fachartikel zur „Positiven Psychologie“ war geboren.
Was enthält nun dieses Akumal-Manifest? Es definiert die Positive Psychologie wie folgt: Die Positive Psychologie ist die wissenschaftliche Lehre von optimalem menschlichem Handeln. Sie versucht, Faktoren zu entdecken und zu fördern, die es Individuen und Gemeinschaften erlauben, aufzublühen. Die Bewegung der Positiven Psychologie repräsentiert die neue Einsatzbereitschaft forschender Psychologinnen und Psychologen, ihre Aufmerksamkeit auf die Ursprünge psychischer Gesundheit zu richten und somit über den vorherigen Schwerpunkt auf Störung und Krankheit hinauszugehen (Sheldon et al., 2000).
Das Manifest enthält im Weiteren die Ziele und die Anwendungsbereiche der hier erstmals definierten Positiven Psychologie. Erforscht werden sollte das optimale menschliche Handeln auf der biologischen, persönlichen, experimentellen, institutionellen, kulturellen, globalen und der Beziehungsebene. Die Forschung sollte sich auf die dynamische Beziehung zwischen den Prozessen all dieser Ebenen sowie auf die menschliche Kapazität, Ordnung und Sinn inmitten von unausweichlichen Zeiten der Not zu erschaffen, beziehen. Zu guter Letzt sollten auch die Möglichkeiten erforscht werden, in denen das gute Leben in all seinen Formen aus diesen Prozessen entstehen kann (Sheldon et al., 2000).
Die im Manifest beschriebenen Anwendungsbereiche reichen von der Verbesserung der Erziehung von Kindern durch Einsatz von positivem Affekt und Aktualisierung der inneren Motivation über die Verbesserung der Psychotherapie durch Methoden, die Hoffnung, Sinn und Selbstheilung betonen, bis hin zur Verbesserung der Moral in der Gesellschaft durch ein besseres Verstehen der transzendenten Impulse in Menschen.
Die im Manifest angeführten Anwendungsvorschläge der Positiven Psychologie umfassen diese Bereiche im Detail (Sheldon et al., 2000):
• Verbesserung der Erziehung von Kindern
• Verbesserung der Psychotherapie
• Verbesserung des Familienlebens
• Verbesserung von Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne
• Verbesserung von Organisationen und Gesellschaften
• Verbesserung des moralischen Charakters der Gesellschaft
Ausgehend vom zweiten Akumal-Treffen lud Don (Donald) Clifton, der Vorsitzende von Gallup und angesehener Stärkenforscher, der auch bei diesem Treffen war, zu einem weiteren Treffen auf Grand Cayman ein. Anwesend war neben Seligman auch Professorin Kathleen Hall Jamieson, Direktorin des Annenberg Public Policy Centers der Penn University. Ihr Ziel war es, die Positive Psychologie in die Gesellschaft einzugliedern. Mit dabei war auch Professor Ben (Benjamin) Robinson, ein außerordentlicher Philosoph und Psychologe, der die Positive Psychologie mit Aristoteles in Verbindung brachte. Ebenfalls anwesend war George Vaillant von der Harvard University. Vaillant war für seine Forschungen zum Thema „Reife Abwehr“ bekannt geworden. Menschen, die eine reife Abwehr haben, können sich zurückhalten, abwägen, den Überblick behalten und den Blick in die Zukunft richten, was dazu führt, dass sie erfolgreicher, glücklicher und zufriedener im Alter sind. Das Meeting führte dazu, dass Vaillant (1971) nicht mehr von „Reifer Abwehr“, sondern von Charakterstärken sprach.
Ein weiterer Gast war Ed Diener. Er forschte unabhängig von Martin Seligman bereits seit Längerem am subjektiven Wohlbefinden. Ed Diener ist die Entstehung des Begriffs „Subjective Well-being“ und die Entwicklung einer Skala dazu zu verdanken (vgl. Kapitel 2 und Diener 1984). Ed Diener spielte daher in diesem Meeting eine entscheidende Rolle. Ihm ging es zwar nicht so sehr um Aristoteles, aber dafür darum, dass Positive Psychologie als wissenschaftliche Disziplin vor allem eines haben sollte: klare wissenschaftliche Standards und Forschungsfragen, die gemessen werden können. Mihály Csíkszentmihályi, der Erfinder des Flow, war ebenfalls anwesend. Auf die Frage, ob man etwas fühle, wenn man im Flow ist, antwortete er damals: „Nein. Dem Flow gibt man sich ganz hin. Man fühlt weder Zeit noch Raum. Würde man etwas fühlen, dann wäre das nicht Flow.“ Ebenfalls dabei war Robert Nozik, der gemeinsam mit seinem Harvard-Kollegen John Rawls damals einer der führenden Philosophen dieser Welt war. Anfangs bestand die Befürchtung, dass Nozik zu kritisch sein könnte, doch seine Aussagen und Ideen passten sehr gut in die Diskussionen hinein. Zu guter Letzt war noch ein Dissertant von Martin Seligman namens Derek Isaacowitz anwesend, der alles mitschrieb.
Das Thema des Cayman-Treffens war die Positive Psychologie. Alle liebten die Idee des Gelingens (des gelingenden Lebens). Was könnten nun die Bestandteile des gelingenden Lebens sein? Alle waren sich einig, dass Happiness und alles, was mit dem Gefühl rund um Happiness (Glück) zusammenhänge, dabei sein müsse. Genauso klar war, dass Flow ein wichtiger Bestandteil zu sein habe, denn Flow war für sich schon eine positive Erfüllung. So waren bereits zwei Bestandteile positiver Erfahrung und Erfüllung gefunden: positives Gefühl und Flow. Doch war dies alles?
Kathleen Hall Jamieson bestand darauf, dass es noch etwas Drittes bräuchte. Sie erklärte, dass die Soziologie sich nur mit negativen Institutionen und Ursachen von Themen wie Verbrechen, Armut und Rassismus beschäftige. Die Positive Psychologie solle auch beinhalten, dass positive Einrichtungen wie Demokratie, freie Presse, starke Familien, freiwilliger Dienst etc. auch zum Wohlbefinden beitragen. Somit wurde auch Sinn ein Bestandteil der Positiven Psychologie. Bob Nozik warf zudem ein, dass es noch etwas brauche, um positive Erfüllung zu erleben, nämlich positive Eigenschaften (Traits). Die Psychiatrie studiere nur die Verrücktheit und suche ausschließlich nach negativen Persönlichkeitsmerkmalen wie Depression, Schizophrenie und Manie. Es ginge laut Nozik allerdings auch darum, positive Persönlichkeitseigenschaften zu finden. Eine Diskussion, ob es positive Persönlichkeitsmerkmale oder nur situative Zustände gebe, entbrannte. Ed Diener konnte schlussendlich alle davon überzeugen, dass es sehr wohl positive Persönlichkeitseigenschaften gebe und dass diese auch essenziell seien.
Somit war auch der letzte Bestandteil Positiv-psychologischer Forschung im Cayman-Meeting festgelegt. Glück, gelingendes Leben und Erfüllung brauchen
a) positives Gefühl, b) Flow, c) positive Institutionen und d) positive Persönlichkeitsmerkmale (Charakterstärken, vgl. Kapitel 3).
Noch konkreter wurde die Konstruktion der Positiven Psychologie beim ersten internationalen Summit für Positive Psychologie in Lincoln im September 1999. Dort präsentierte Barbara Fredrickson zum ersten Mal ihre „Broaden and Build Theory of Positive Emotions“ (vgl. Kapitel 9), die besagt, dass Positive Emotionen die Leistungsfähigkeit verbessern und uns aufblühen lassen.
Der Sohn von Ed Diener, Robert Biswas-Diener, stellte bei diesem Event seine revolutionären positiven Coachingmethoden vor, was ihm später auch den Namen „Indiana Jones der Positiven Psychologie“ einbrachte. Bei diesem Gipfel zeigte er drei Dinge auf, auf die es bei der Positiven Psychologie ebenfalls ankommt: Stolz, Liebe und Anerkennung. „Ich bin so stolz auf meinen Vater“, sagte er, nachdem dieser einen grandiosen Vortrag über das Messen von Glück und die herausfordernde Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten gehalten hatte. So begann der weite Weg der Positiven Psychologie. Ausschlaggebend war eindeutig ein unscheinbares Gespräch von Martin Seligman mit seiner Tochter Nikki gewesen, das Seligman die Vision der Positiven Psychologie eröffnet hatte. Auf einer institutionalisierten Ebene haben Ray Fowler, Mihály Csíkszentmihályi und Martin Seligman durch das Akumal-Manifest die ersten Weichen gestellt. Doch die Positive Psychologie hatte auch Glück. Sie wurde damals von sehr scharfsinnigen Philanthropen entwickelt und hat bis heute die Kraft, aufgrund ihrer bahnbrechenden Forschung Großartiges zu ermöglichen.
1.2 Zusammenfassung
In diesem Einstiegskapitel haben wir uns mit dem Weg von Philip Streit zur Positiven Psychologie beschäftigt und dem Weg, wie Martin Seligman in Zusammenarbeit mit Diener, Czíkszentmihályi und anderen die Grundsätze und die Mission der Positiven Psychologie entwickelt hat. Das IPPA Mission Statement lautet: „Die Positive Psychologie ist die Wissenschaft über jene Dinge, die es Individuen und Gemeinschaften ermöglichen aufzublühen“ (Positive Psychology is the scientific study of what enables inidividuals and communities to thrive).
Sie ist die systematische Erforschung von psychologischem, sozialem und gesellschaftlichem Glück und daher die Forschung des gelingenden Lebens. Die Positive Psychologie befasst sich mit den Stärken wie auch mit den Schwächen der Menschen, dem Aufbau der schönen Seiten des Lebens und ebenso der Verbesserung der Widrigkeiten. Ihr geht es darum, das Leben von gesunden Menschen erfüllender zu gestalten und dies genau so ernst zu nehmen wie die Heilung von Krankheiten. Ihr Auftrag ist es, Interventionen zu entwickeln, die das Wohlbefinden steigern, anstatt nur das Leid zu lindern.
Im nächsten Kapitel werden wir uns genauer ansehen, welche Modelle des gelingenden Lebens es bereits gibt, angefangen von der humanistischen Psychologie bis hin zur Self-Determination Theory von Ryan and Deci.
Literatur
de Shazer, S. (2004). Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie. Heidelberg: Carl-Auer.
Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doe.org-10.1037/0033-2909.95.3.
Lyubomirsky, S. (2008). The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books.
Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. Oxford: Oxford University Press.
Peterson, C., Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (1993). Learned helplessness: A theory for the age of personal control. Oxford University Press.
Seligman, M. E. P. (1998). Learned optimism. New York: Pocket Books.
Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
Seligman, M. E. P. (2003). Der Glücks-Faktor: Warum Optimisten länger leben. Ehrenwirth.
Seligman, M. E. P. (2018). The Hope Circuit: A Psychologist’s Journey from Helplessness to Optimism. PublicAffairs.
Seligman, M. E. P. & Csíkszentmihályi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5–14. 10.1037/0003-066X.55.1.5.
Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421. https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410
Sheldon K., Fredrickson, B., Rathunde, K. & Csíkszentmihályi, M. (2000). Positive Psychology Manifesto (revised). https://ppc.sas.upenn.edu/sites/default/files/Positive%20Psychology%20Manifesto.docx (16.12.2020).
Vaillant, G. E. (1971). Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms: A 30-year follow-up of 30 men selected for psychological health. Archives of General Psychiatry, 24(2), 107–118. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1971.01750080011003
2 Modelle des Glücks und des Wohlbefindens – ein historischer Abriss über Quellen der Positiven Psychologie
Im vorigen Kapitel haben wir erfahren, wie dank Martin Seligman die Positive Psychologie geboren wurde. Im folgenden Kapitel wollen wir der Frage nachgehen, welche wichtigen Modelle und Konzepte des Glücks und des Wohlbefindens es schon vor der Positiven Psychologie gegeben hat.
Beginnen wir mit einem Zitat von Aristoteles in Anlehnung an den Philosophen Leopold Seiler: „Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Weisheit und Glückseligkeit.“
Damit wird eines schon klar: Die Glückskonzepte der alten Griechen, von Epikur bis Aristoteles, beschrieben als Ziel des Menschen, einen Zustand der Erfüllung und der Glückseligkeit zu erreichen. Die Anfänge der griechischen Philosophie betrachteten Glück (vgl. Martin Seligman, der das Wort Glück an und für sich nicht so sehr mochte; persönliches Zitat, Reise nach Venedig, 2009) als einen Augenblick, in dem einem von außen etwas Schönes zustößt, wie ein Lottosechser.
„Glück haben“ heißt im Jüdischen „ein Massel haben“. Der Glücksbegriff der griechischen Frühdenker entspricht so am ehesten dem englischen Wort „luck“ und der Begriff der Eudaimonie der Positiven Psychologie entspricht eher dem Begriff der Glückseligkeit von Aristoteles (Aristoteles, 2009).