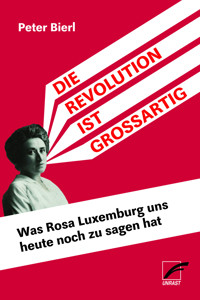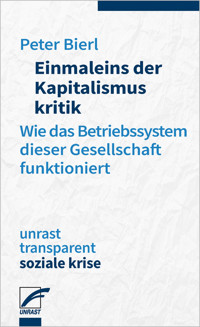
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Ansätze der Kapitalismuskritik aus den vergangenen zwei Jahrhunderten werden in ihrem Kontext dargestellt und kritisch analysiert. Dabei zeigt sich, dass Kapitalismuskritik kein Privileg der Linken war oder ist. Es gab und gibt konservative, reaktionäre, rechte und völkische, nationalliberale und sozialreformerische Ansätze, neben anarchistischen, sozialistischen und kommunistischen Theorien. Herausgearbeitet werden Affinitäten, Überschneidungen und Verkürzungen, aber auch Traditionslinien, die sich in aktuellen politischen Strömungen, in der Globalisierungskritik, bei Occupy oder rechten und populistischen Bewegungen wiederfinden. Ein Schwerpunkt liegt in der knappen Darstellung der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie, im Gegensatz zur Lenin’schen Imperialismustheorie sowie aktuellen antimonopolistischen und finanzmarktorientierten Richtungen in der Linken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Peter Bierl
Einmaleins der Kapitalismuskritik
soziale krise
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Peter Bierl:
Einmaleins der Kapitalismuskritik
unrast transparent
soziale krise, Band 6
2., erweiterte Auflage, März 2025
eBook UNRAST Verlag, September 2025
ISBN 978-3-95405-233-2
© UNRAST Verlag, Münster 2025
Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffe, Definitionen und Differenzen
Links und rechts
Was ist Kapitalismus?
Was zeichnet verkürzte Analysen aus?
3. Kapitalismuskritik von rechts
Der Begriff Kapitalismus und die ersten Debatten um die neue Wirtschaftsweise
Kritik des Liberalismus in Deutschland
Völkische Antikapitalisten und Kathedersozialisten
NSDAP: Deutscher Sozialismus
Neonazis, Neue Rechte und AfD
4. Der Dritte Weg
5. Kapitalismuskritik von links
Frühsozialisten und Anarchisten
Die Marx’sche Kritik der Politischen Ökonomie
Zusammenbruchstheorie
Abkehr von der Marx’schen Analyse – die Lehre vom (Staats-)Monopolkapitalismus
Finanz- und Monopolkapitalismus: Das Ende der Mehrwertproduktion
6. Globalisierungskritik
Dominanz des Finanzkapitals
Entmachtung von Nationalstaat und Demokratie
Kriminelle Machenschaften
Zurück ins goldene Zeitalter des Kapitalismus
Geld und Zins
Marktwirtschaft statt Kapitalismus
7. Schluss: Offen nach rechts
8. Literaturtipps
Anmerkungen
1. Einleitung
Ein Zeitalter des Wohlstands und Friedens prophezeite der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama (1992), nachdem der Kapitalismus im Kalten Krieg gesiegt hatte. Er prägte dafür das Schlagwort vom »Ende der Geschichte«. Demokratie und Marktwirtschaft würden sich nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus überall und endgültig durchsetzen. Wenig später versackte die japanische Ökonomie in der Stagnation. Die Asienkrise 1997/98 traf sogenannte Tigerstaaten wie Südkorea und Thailand, es folgten der Einbruch der hochgelobten New Economy 2000, die Schuldenkrise in Lateinamerika und die Weltwirtschaftskrise von 2007. Keine dieser Pleiten hatten Politiker*innen, Wirtschaftswissenschaftler*innen und Journalist*innen vorhergesehen, die den Kapitalismus für die beste aller Welten halten. Dabei sind solche Krisen ein schlechter Maßstab. Denn auch wenn das Geschäft brummt, ist das Leben vieler Menschen voller Elend und Not, Demütigung und Unsicherheit.
Nach Angaben der Welthungerhilfe (Oktober 2024) leiden mehr als 730 Millionen Menschen an Hunger, inmitten eines Überflusses, wie es ihn nie zuvor in der Geschichte gegeben hat. In Afrika, Asien und Lateinamerika findet Industrialisierung zu frühkapitalistischen Bedingungen statt, in Nordamerika, West- und Osteuropa wurden ganze Regionen deindustrialisiert. Die Arbeiter*innenklassen und Mittelschichten in Nordamerika und Westeuropa, deren Lebensstandard nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich gestiegen war, verloren an realen Einkommen. Prekäre Jobs, niedrige Löhne, Erwerbslosigkeit und Armut breiten sich aus, der Sozialstaat wird demontiert, während die mikroelektronische Revolution die Rationalisierung und Intensivierung der Arbeit weiter vorantreibt. Dabei bedeutet Wirtschaftswachstum, dass immer mehr Energie, Rohstoffe und Land verbraucht werden, mehr Abfallprodukte und Gifte zurückbleiben. Phasen des Booms treiben eine ökologische Zerstörung voran, die Teile des Planeten unbewohnbar machen wird.
Die Prognose vom Ende der Geschichte war schnell widerlegt, weil die Widersprüche des Kapitalismus keineswegs überwunden waren, sondern sich verschärften. Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Pandemie, Kriegen, Inflation und wachsender sozialer Ungleichheit prägte der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze 2022 stattdessen den Begriff Polykrise.
Die von Fukuyama ausgerufene Epoche der Glückseligkeit endete schon nach zwei Jahren, als die Zapatistas im Süden Mexikos rebellierten. Sie kündigten neue Formen sozialrevolutionärer Politik an, wollen alte autoritäre, staatsfixierte und gescheiterte Muster der Linken überwinden. »Fragend schreiten wir voran«, lautet einer ihrer Slogans. Die Zapatistas wollen weder als Guerillaarmee die Macht im Staat erobern, noch sich an Wahlen oder gar Regierungen beteiligen. Sie setzen auf Selbstorganisation. Denn grundstürzende Veränderungen wird es nur geben, wenn viele Menschen diese wollen und selbst durchsetzen.
In Südkorea und Frankreich folgten Massenstreiks von Lohnabhängigen, die sich gegen Sozialabbau richteten. In Indien und Brasilien erstarkten Bewegungen von Bauern, Bäuerinnen und Landarbeiter*innen gegen Großgrundbesitzer. Weltweit entstand die sogenannte globalisierungskritische Bewegung und erreichte ihre Höhepunkte in den Kämpfen in Seattle (1999) und Genua (2001). In Argentinien, später in Spanien und Griechenland formierte sich massenhafter Protest gegen die Folgen kapitalistischer Krisen. 2011 folgten die kurzlebigen Occupy-Proteste und der arabische Frühling, zwei Jahre später Auseinandersetzungen in Brasilien und um den Gezi-Park in der Türkei. Bloß in Deutschland entwickelte sich kaum Protest, nicht einmal als die rot-grüne Bundesregierung mit der Agenda 2010 und den Hartz-Reformen den größten sozialen Kahlschlag in der Geschichte des Landes vollzog und den Niedriglohnsektor ausweitete. Anscheinend konnte die Masse der Lohnabhängigen immer noch ein Einkommen erzielen, das ausreichte, um die Menschen materiell einzubinden. Weitgehend unbeachtet ist, dass die meisten und größten Streiks sowie lokale Aufstände in China stattfinden. In dieser Entwicklungsdiktatur herrscht eine Partei, die sich kommunistisch nennt und das Land zur Werkbank des Kapitals gemacht hat, unter elenden Arbeits- und Lebensbedingungen.
Eine Gemeinsamkeit vieler dieser neuen Bewegungen war und ist ihre begrenzte Perspektive. Das nicht abwertend gemeint, sondern eine Feststellung. Sie kämpfen nicht für Sozialismus, Kommunismus oder Anarchismus (was immer das nach dem historischen Scheitern solcher Ansätze sein könnte). Protest und Widerstand richten sich gegen schlechtere Arbeits- und Lebensverhältnisse, eine verschärfte Ausbeutung und Verarmung, gegen sexistische und patriarchale Strukturen, gegen ökologische Zerstörungen und deren Folgen, gegen diktatorische Regime und autoritäre Tendenzen. Sie fordern mehr Mitsprache, soziale Absicherung, ein besseres Leben, oft kämpfen die Menschen schlicht um ihre Existenz. Diese Bewegungen und daraus entstehende Parteien füllten eine Lücke, die die traditionellen sozialdemokratischen Parteien hinterließen, als sie einen neoliberalen Kurs einschlugen. Dazu gehören der Abbau sozialer Leistungen und die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Bahn, Kommunikation, Energie- und Wasserversorgung. In der Folge verlor die Sozialdemokratie an Einfluss oder wurde bedeutungslos wie in Italien und Frankreich. Anstelle der sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen Parteien entwickelte sich in der Linken die sogenannte Globalisierungskritik mit Forderungen, die im Kern neo-sozialdemokratisch sind: höhere Steuern für die Reichen, stärkere staatliche Einflussnahme auf Banken und Konzerne sowie die Einhaltung gewisser Sozial- und Umweltstandards. Dagegen ist nichts einzuwenden, bloß ist der Spielraum für solche Reformen äußerst eng, wie das Scheitern des ›Sozialismus des 21. Jahrhunderts‹ in Lateinamerika zeigte, der von der globalisierungskritischen Bewegung abgefeiert wurde. Die Präsidenten Lula und Hugo Chavez waren Superstars auf den Weltsozialforen. Dabei setzte die Regierung der Arbeiterpartei in Brasilien auf eine kapitalistische Modernisierung, von der für alle etwas abfallen sollte, die Chavistas in Venezuela zweigten einen Teil der Ölrente für soziale Vorhaben ab, was für die Betroffenen sicher gut war, aber nichts an gesellschaftlichen Strukturen änderte. Ökologisch ist dieser fossilistische Extraktivismus katastrophal. Das Sinken des Weltmarktpreises für Erdöl beendete das Projekt in Venezuela, die Masse der Bevölkerung versinkt wieder in der Armut. In Griechenland knüppelte die vermeintlich linksradikale Syriza die EU-Sparprogramme durch und schränkte sogar das Streikrecht ein. Die Chavistas und Syriza haben ähnlich wie Podemos, eine Partei, die in Spanien aus der Occupy-Bewegung entstand und nichts Besseres anzufangen wusste, als eine Koalition mit der Sozialdemokratie einzugehen, die Linke weiter diskreditiert. Zuvor hatten Staatssozialismus, Marxismus-Leninismus und Sozialdemokratie bereits Scherbenhaufen hinterlassen. Ihr politisches, moralisches und intellektuelles Scheitern lasten wie ein Alptraum selbst auf jenen linken Strömungen, die diese Richtungen stets kritisiert und abgelehnt hatten oder dafür gar ausgegrenzt und verfolgt bzw. deren Anhänger*innen eingekerkert und ermordet wurden. Die Linke braucht darum einen kompletten Neustart, wobei sie mit früheren Illusionen, Fehlern und Verbrechen schonungslos abrechnen muss.
Derzeit sind weltweit autoritäre, regressive bis offen faschistische Bewegungen auf dem Vormarsch, wie die Erfolge der extremen Rechten in Deutschland und Europa, von Donald Trump in den USA, Javier Milei in Argentinien, Jair Bolsonaro in Brasilien, dem Hindunationalismus oder Islamismus zeigen. Sie werden von einem Teil der Lohnabhängigen, von Arbeiter*innen und kleinen Bäuer*innen unterstützt. Etliche Schlagworte der Globalisierungskritik hat die extreme Rechte übernommen und keineswegs verfremdet, sondern deren nationalistischen Gehalt auf den Punkt gebracht. Dabei haben rechte Regierungen in Polen und Ungarn anfangs durchaus soziale Kürzungen liberaler Vorgänger zurückgenommen. Insgesamt zielt die Rechte jedoch darauf, soziale Leistungen und demokratischen Rechte abzubauen.
Der wichtigste Treiber der weltweiten Faschisierung ist die Umweltzerstörung. Inzwischen sind sechs von neun planetaren Grenzen überschritten, beim Klimawandel, dem Artensterben, der Belastung mit neuartigen Substanzen wie Mikroplastik, Farbstoffen und Pestiziden sowie Stickstoff und Phosphor, der Verfügbarkeit von Süßwasser und der Landnutzung. Abrupte Brüche stehen bevor. Die Folgen treffen die arbeitenden Klassen mit voller Wucht, vor allem jene im sogenannten globalen Süden. Die ärmsten Teile der Weltbevölkerung drohen ausgelöscht zu werden. Ganze Landstriche werden unbewohnbar, die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen schrumpfen, wegen Hitze, Trockenheit, Überflutungen oder steigendem Meeresspiegel. Notwendig wäre ein internationales Umsiedlungsprogramm für einige Hundert Millionen Menschen. Was stattfindet, ist die Abschottung von Wohlstandsoasen in einem Meer des Elends und Sterbens. Diese Lösung gestalten bürgerlich-demokratische Parteien mit und setzen damit den wesentlichen Punkt aktueller faschistischer Programme um, gestützt auf eine Mehrheit, die keine Veränderung will, die den Abschied vom herrschenden Konsummodell beinhaltet.
So notwendig Antifaschismus ist, bleibt er seinem Wesen nach defensiv, notwendig ist eine gesellschaftliche Perspektive, die den sozialen und ökologischen Problemen gerecht würde und Mehrheiten gewinnen könnte. Zwar wäre es illusionär zu glauben, damit ließen sich antisemitische, rassistische oder frauenfeindliche Überzeugungstäter*innen gewinnen, oder all jene, die dem Wahn und Verschwörungsglauben verfallen sind. Aber alle anderen, deren Wut berechtigt, deren Ohnmacht real und deren Resignation unübersehbar ist, müssen ansprechbar sein, wenn sich etwas verändern soll.
Realistisch betrachtet muss eine emanzipatorische Linke davon ausgehen, dass sie auf absehbare Zeit randständig ist, ihre Aufgabe ist der Neuanfang, die Reflexion, die Kritik.
Wenn es nennenswerte Reformen im Sinn einer Verbesserung der Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen geben soll, müssten Basisbewegungen erst einmal eine Drohkulisse aufbauen. Denn Zugeständnisse müssen aus Sicht der herrschenden Klasse das geringere Übel darstellen. Ob solche Basisbewegungen in der Lage wären, die Gesellschaft grundlegend zu verändern, muss ebenso offen bleiben wie die Frage, wie eine solche vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen aussehen könnte.
In jedem Fall ist eine zutreffende Analyse und Kritik der herrschenden Verhältnisse notwendig. Aus theoretischen Erkenntnissen kann effektive Praxis entstehen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Wahrnehmung und Interpretation der ökonomischen und sozialen Verhältnisse.
In Teilen der Bevölkerung ist der Kapitalismus wieder diskreditiert, allerdings ist den meisten keineswegs klar, was dieses System überhaupt ausmacht. Die Globalisierungskritik hat Zerrbilder befördert, die Kapitalismus als Wirken finsterer Mächte vorzugsweise aus der Finanzsphäre und dem Ausland missverstehen. Solche Kurzschlüsse sind nahe dran am Alltagsbewusstsein, an völkischen, antisemitischen und verschwörungsideologischen Vorstellungen. Damit sind wir beim Thema dieses Buches: der Darstellung des Kapitalismus als einem Betriebssystem, einer umfassenden Struktur, die auf dem Markt als Vermittlungsinstanz, dem privaten Eigentum an Produktionsmitteln, auf Konkurrenz, Lohnarbeit, der Ausbeutung von Menschen und der Zerstörung von Natur basiert.
Dabei ist Kapitalismuskritik fast so alt wie der Kapitalismus selbst. Konservative haderten seit dem frühen 19. Jahrhundert mit der neuen Wirtschaftsweise, die überkommene ständische Privilegien unterminierte. In Deutschland grenzte sich die sogenannte Historische Schule von der politischen Ökonomie des Manchesterkapitalismus ab. Die Rede vom angelsächsischen Raubtierkapitalismus ist bis heute ein Vehikel nationalistischer Propaganda. Die Kathedersozialisten, eine Gruppe von Professoren, plädierten für staatliche Eingriffe und soziale Reformen, weil sie um den Fortbestand der Klassengesellschaft bangten. Völkische Agitatoren nahmen Bank und Börse, das Kaufhaus und den Zins als jüdisches Machwerk ins Visier. Eine »goldene Internationale« würde ehrliche Unternehmer, brave Handwerker und fleißige Arbeiter aussaugen. Die Propaganda eines »deutschen Sozialismus« sollte der marxistischen Linken das Wasser abgraben. Gehaltvolle Beiträge zur Kritik des Kapitalismus gibt es aus der Rechten bis heute nicht, sie schwankt zwischen antisemitischen Verschwörungsideologien, national-sozialem Pathos, leeren Versprechungen und neoliberalem Sozialdarwinismus.
In der Linken entwickelte sich Kapitalismuskritik von den ersten amerikanischen, englischen und französischen Anarchist*innen und Sozialist*innen über die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx und Friedrich Engels hin zu den Zusammenbruchs-, Monopol- und Imperialismustheorien der sozialistischen Zweiten Internationale und der kommunistischen Dritten Internationale. Hatte Marx unter Kapitalismus eine gesellschaftliche Totalität verstanden und Ausbeutung als strukturellen ökonomischen Mechanismus analysiert, behauptete Lenin, die Herrschaft des Finanzkapitals habe die Ausbeutung des Proletariats zur Nebensache degradiert, der Kapitalismus basiere auf Wucher und Erpressung durch Finanzmagnaten und Monopolisten. Die Lehre vom Monopol- oder Staatsmonopolkapitalismus dominierte fortan die Linke, selbst dissidente Strömungen wie den Rätekommunismus oder die kritische Theorie sowie Debatten unter linken Sozialdemokraten. Die aktuelle Globalisierungskritik klingt wie eine oberflächliche Variation.
Der Anarchismus brachte mit Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) nur einen ökonomischen Theoretiker hervor. Er beschränkte sich auf die Kritik von Geld und Zinsen und wollte eine zinsfreie Marktwirtschaft von Kleinproduzenten. Während einige zweifeln, ob Proudhon überhaupt als Anarchist gelten kann (Van der Walt/Schmidt 2013), knüpfte David Graeber (1961-2020), der als Mastermind von Occupy galt, mit seinen Überlegungen zu Geld, Zins und Kredit an Proudhon an. Der Individualanarchismus wiederum predigt seit jeher das hohe Lied des freien Unternehmertums und mündet in rechtslibertären Ideen der Gegenwart, ansonsten finden sich kaum originäre Beiträge des Anarchismus zur Ökonomie. Michail Bakunin empfahl die Lektüre von Marx.
Links wie rechts findet sich die Idee eines sogenannten Dritten Weges zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Sie ist mit der Vorstellung verbunden, Kapitalismus und Marktwirtschaft seien verschiedene Wirtschaftsformen. Dabei wird Kapitalismus mit der Finanzsphäre und mit Monopolen identifiziert und Marktwirtschaft als mittelständische oder agrarisch-handwerklich dominierte Ökonomie idealisiert. Die grundlegenden Charakteristika wie privates Eigentum an den Produktionsmitteln, Konkurrenz, Lohnarbeit, Produktion von Gütern und Dienstleistungen nicht für den direkten Gebrauch, sondern zum Verkauf auf Märkten, sind jedoch gleich. Kapitalismus ist die moderne Form der Marktwirtschaft.
Falsche Vorstellungen sind dennoch populär, weil sie ein verbreitetes Unbehagen aufgreifen. Die wenigsten Leute beschäftigen sich mit Theorien, zumal dafür oft eine privilegierte Position, Zeit und Bildung notwendig ist. Seit jeher ist Antikapitalismus selbst bei Leuten, die sich als links definieren, stark moralisch und persönlich gefärbt, was nicht verkehrt ist. Allerdings finden sich oft wilden Mischungen, Sedimente unterschiedlicher, sich zum Teil ausschließender Ansätze. Fragmente aus Monopol- und Machttheorien sowie Zins- und Geldkritik werden zusammengewürfelt.