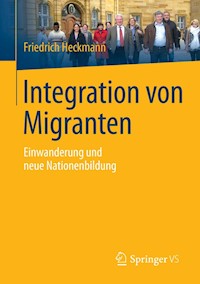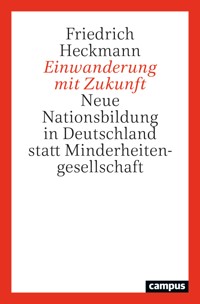
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer sind »Wir« in Deutschland und wer gehört dazu? Auf der Grundlage der deutschen und internationalen Migrations- und Integrationsforschung prüft Friedrich Heckmann, ob sich ethnische Minderheitenbildung infolge von Einwanderung verfestigt oder ein Übergangsphänomen im Integrationsprozess ist. Seine Untersuchung macht deutlich, dass es im Zeit- und Generationenverlauf zu einem (wechselseitigen) Annäherungsprozess zwischen Einheimischen und eingewanderten Bevölkerungsteilen und deren Nachkommen in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommt. Deutschland erweist sich als integrative Gesellschaft, die in einem Prozess »Neuer Nationsbildung« Gegenwart und Zukunft der Einwanderung gestaltet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Heckmann
Einwanderung mit Zukunft
Neue Nationsbildung in Deutschland statt Minderheitengesellschaft
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Wer sind »Wir« in Deutschland und wer gehört dazu? Auf der Grundlage der deutschen und internationalen Migrations- und Integrationsforschung prüft Friedrich Heckmann, ob sich ethnische Minderheitenbildung infolge von Einwanderung verfestigt oder ein Übergangsphänomen im Integrationsprozess ist. Seine Untersuchung macht deutlich, dass es im Zeit- und Generationenverlauf zu einem (wechselseitigen) Annäherungsprozess zwischen Einheimischen und eingewanderten Bevölkerungsteilen und deren Nachkommen in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommt. Deutschland erweist sich als integrative Gesellschaft, die in einem Prozess »Neuer Nationsbildung« Gegenwart und Zukunft der Einwanderung gestaltet.
Vita
Friedrich Heckmann ist Professor emeritus für Soziologie an der Universität Bamberg und Vorsitzender des Expertenforums beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorwort
1
Einführung: Fragen zu Einwanderung, ethnischer Differenzierung und Nation
2
Wie sich Nationsbildung methodisch untersuchen lässt
3
Annäherungen bei Bildung, Qualifizierung und Erwerbstätigkeit
3.1
Bildung und Qualifizierung
Frühkindliche Bildung
Schulartenbesuch und Schulabschlüsse
Berufsausbildung
Studium
Zusammenfassung
3.2
Entwicklungen im Bereich der Erwerbstätigkeit
Erwerbstätigenquote
Positionierung auf dem Arbeitsmarkt
Einkommen und Armutsgefährdung
Erwerbstätigkeit und Diskriminierung
Selbstständigkeit
Ethnische Unterschiede
Zusammenfassung
4
Angleichungen bei Rechtsstatus und Mitgliedschaft
4.1
Staatsangehörigkeit
Gesellschaftliche und staatsbürgerliche Mitgliedschaft
Entwicklungstendenzen
Einbürgerung, Integration und Identifizierung
Zusammenfassung
5
Annäherungen bei Kultur, Sprache und persönlichen Beziehungen
5.1
Kultur, Sprache, Werte
Kenntnis und Gebrauch der deutschen Sprache
Annäherungen bei Werten
Normen, Sitten und Bräuche
Religion und selektive Akkulturation
Alltagskultur: Ernährung, Mediennutzung
Zusammenfassung
5.2
Persönliche Kontakte und Nahbeziehungen
Persönliche Kontakte
Freundschaftsbeziehungen
Interethnische Ehen und Partnerschaften
Interethnische Ehen, Verwandtschaftsbeziehungen und Gruppengrenzen
Zusammenfassung
6
Annäherungen und Angleichungen bei Zugehörigkeit, Identifizierung und Beteiligung
6.1
Zugehörigkeit
Faktische Zugehörigkeiten
Zugehörigkeitszuschreibungen und Zugehörigkeitsgefühle
Zusammenfassung
6.2
Soziale Identität und Identifizierungen von Migranten
Identifizierung und Generation
Mehrfachidentifizierung und Konflikt
Zusammenfassung
6.3
Zivilgesellschaftliche und politische Beteiligung
Zusammenfassung
7
Zwischenruf: Deutschland ist eine integrative Gesellschaft
8
Wie die ethnische Differenzierung unserer Gesellschaft bisher beschrieben und erklärt wird
8.1
Multikulturalismus und multikulturelle Gesellschaft
Multikulturelle Gesellschaft als Beschreibungskonzept
Multikulturalismus als politisches Konzept und politische Bewegung
Multikulturelle Gesellschaft als Vorbote künftiger Entwicklungen
8.2
Denationalisierung und postnationale Gesellschaft
Der Wert der Staatsbürgerschaft
8.3
Theorie der postmigrantischen Gesellschaft
Analyse der gesellschaftlichen Folgen von Migration
Gesellschaftskritik und politische Utopie
Neue Erzählung über Nation in Deutschland
Möglichkeiten und Grenzen des Paradigmas
9
Nationen: Entstehung, Merkmale, Wirkungen
9.1
Die Entstehung von Nationen
Staatsnationen und Kulturnationen
Nationswerdung in Deutschland
9.2
Was ist eine Nation?
Nation, Erinnerungskultur und Gedächtnisgemeinschaft
Nation und Sprache
Nation, Ethnie, Volk
Nation, Kultur, Diversität und Gemeinsamkeit
Nation, Staat, Territorium, Souveränität
Definition von Nation
9.3
Wirkungskraft des Nationskonzepts
Gesellschaftliche Integrationswirkung
Nation schafft Zugehörigkeit und soziale Identität
Konklusionen für die Entwicklung eines neuen Nationsbegriffs
10
Grundlagen und Elemente für Neue Nationsbildung in Deutschland
10.1
Gründungsgeschichte und Erinnerungskultur
10.2
Ethnos, Demos, Minderheiten: Wie es zu einem neuen Kollektivbewusstsein kommen kann
10.3
Kulturelle Vielfalt und Gemeinsamkeit
10.4
Wer dazu gehört und die Transformation des kollektiven »Wir«
10.5
Nation, Sozialstaat, Demokratie
10.6
Bindung, Patriotismus, Gefühle
10.7
Wen Neue Nationsbildung angeht und wer davon profitiert
10.8
Neue Nationsbildung als offener Prozess
11
Neue Nationsbildung im gesellschaftlichen Diskurs: 20 Thesen
Abbildungen
Tabellen
Literatur
Personenregister
Vorwort
Aus gegenwärtiger Sicht war es rückblickend sowohl wissenschaftlich wie praktisch wichtig, dass sich ein Selbstkonzept Deutschlands als Einwanderungsland gegen Widerstand nach vielen Diskussionen und angesichts der Fakten schließlich durchsetzen konnte. Eine neue Definition der gesellschaftlichen Situation (»Framing«) – Deutschland ist ein Einwanderungsland – war die Voraussetzung dafür, dass es in der sozialwissenschaftlichen Forschung gelang, von einer sogenannten Ausländerforschung hin zu einer international eingebundenen Migrations- und Integrationsforschung zu gelangen und diese inzwischen breit aufzustellen.1 In praktisch-politischer Hinsicht ermöglichte das neue Selbstkonzept die Begründung einer systematischen Integrationspolitik und trug zu einer grundlegenden Reform des Staatsangehörigkeitsrechts bei.
Die Untersuchungen dieses Buches gehen davon aus, dass nach vielen Jahrzehnten von Migration und vor allem Integration eine Situation entstanden ist, die auch eine neue Definition der gesellschaftlichen Situation erforderlich macht. Kinder und Kindeskinder von Einwanderern bilden einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung in Deutschland. Verstehen diese sich und werden sie auch verstanden als Minderheiten in Deutschland oder eher als Teil eines größeren Ganzen und einem gemeinsamen »Wir« zugehörig? Nähern sich ihre sozialen Lagen denen ohne Migrationshintergrund an, oder stabilisieren und vergrößern sich bestehende Unterschiede, die einem neuen »Wir« im Wege stehen?
Empirisch zeige ich in diesem Buch, dass tatsächlich ein Annäherungsprozess stattgefunden hat und weiter stattfindet. Für eine Definition der gesellschaftlichen Situation nach der Integration der Kinder und Kindeskinder der selbst Eingewanderten und nach wichtigen Veränderungen der »Mehrheitsgesellschaft« entwickle ich das Konzept der »Neuen Nationsbildung«. Am Ende meines Buches von 20152 hatte ich das Konzept bereits als mögliches Verständnis genannt, aber im vorliegenden Buch wird es ausführlich entwickelt und begründet. »Neue Nationsbildung« ist dabei keine Forderung oder Wunschvorstellung, sondern Ergebnis der Analyse des »wirklichen« Integrationsprozesses im Generationenverlauf.
Mir ist bewusst, welche Vorbehalte gegenüber »Nation« in Deutschland bestehen. Sie sind historisch begründet, aber man sollte Nation nicht dem Rechtsextremismus und völkischer Ideologie überlassen. Grenzen von Europäisierung und Globalisierung zeigen weltweit die weiter bestehende Dominanz von Nation als politischem und gesellschaftlichem Organisierungsprinzip. Für Migranten und ihre Kinder verstehe ich ein reformuliertes modernes Nationskonzept als Einladung für Zugehörigkeit und Identifizierung.
Für gründliche, produktiv-kritische Lektüre des Manuskripts danke ich den Kolleginnen und Kollegen Rainer Bauböck (Wien), Paul Braune (Berlin/Nürnberg), Kay Hailbronner (Konstanz), Chris Hann (Cambridge/Halle), Philip Martin (Davis), Deema Kaneff (Birmingham), Skevos Papaioaonnou (Rethymnon/Kassel), Dietrich Thränhardt (Münster/Berlin) und Petr Skalnik (Hradec Kralove).
Die Recherchen von Jonathan Ernsthenrich (Bamberg) erbrachten wichtige Ergebnisse zur Thematik der Annäherung. Technische Unterstützung bei der Erstellung von Tabellen und Abbildungen kam von Wolfgang Bosswick (Bamberg). Nach meiner Emeritierung ermöglicht die Arbeit im EU-Migrationsforschungsprojekt »HumMingBird«3 mit dem Kollegen Daniel Göler die fortgesetzte Einbindung in die Forschung an der Universität Bamberg, von der dieses Buch profitiert hat. Zahlreiche Anregungen für die Thematik entstanden im Austausch mit Rahman Jamal (Paderborn), Kevin Gurka (Stuttgart), Harald Lederer, Manfred Pöppl, Ursula Praschma, Wolfgang Schmieg, Angelika Weikert (alle Nürnberg) und nicht zuletzt in meiner Familie mit Lale, Ilyas und Gerhard. Allen danke ich ganz herzlich.
Nürnberg/Bamberg im Januar 2024
1Einführung: Fragen zu Einwanderung, ethnischer Differenzierung und Nation
Wohin entwickelt sich die deutsche Gesellschaft unter dem Einfluss von Migration und Integration? Hin zu einer multikulturellen, diversen, postnationalen, postmigrantischen oder noch anders bezeichneten Gesellschaft? Angesichts neuer und alter sozialer Differenzierungen – kann es da noch ein die Differenzierungen der Sozialstruktur übergreifendes Wir-Konzept geben, oder ist das nicht sogar unabdingbar? Wenn ja, wie könnte dieses verstanden und definiert werden? Hat der Begriff der Nation als übergreifendes Konzept für die Integration von Migranten und die Integration der gesamten Gesellschaft in Deutschland eine Bedeutung, oder ist er angesichts von Europäisierung und Globalisierung ein Relikt des Nationalismus?
Das sind Hauptfragen und Themen, mit denen sich dieses Buch beschäftigt. Es versucht auf der Basis von Fakten aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, mit theoretischen Erklärungen und Rückgriffen auf Einwanderungsgeschichte Antworten zur Entwicklung und Zukunft der deutschen Gesellschaft zu geben. Wie und wann kam es dazu, dass wir in der Gegenwart mit solchen Fragen konfrontiert sind?
Es begann damit, dass vor gut sechzig Jahren die Wanderung von Millionen von Menschen aus dem Ausland nach Deutschland einsetzte und die demografische und ethnische Zusammensetzung von Bevölkerung und Gesellschaft verändert wurde. Viele der eingewanderten Gruppen organisierten sich auf dem Hintergrund gemeinsamer Herkunft als Vereine für die verschiedensten kulturellen Aktivitäten, als Religionsgemeinschaften oder als Organisationen zur Interessenvertretung. Mit Einwanderung und Integration ist auch eine ethnische Ökonomie entstanden, die auf Bedürfnisse der Migranten eingeht, aber z.T. auch auf Nachfrage aus der Mehrheitsgesellschaft trifft. Zu den formalen treten zahlreiche informelle ethnische Strukturen hinzu, wie Verwandtschaft und Freundschaft, soziale, kulturelle, religiöse und wirtschaftliche Vereinigungen und Netzwerke, die mit den formalen Strukturen einen Prozess der ethnischen Minderheitenbildung begründet haben.4
Mit den formalen und informellen Strukturen der Minderheitenbildung sind Formen ethnischen Bewusstseins verbunden und bedeuten bei vielen Migranten, sich im neuen Land weiter türkisch, italienisch, griechisch, persisch und auf viele andere Weise zu fühlen und zu identifizieren. Bestärkt werden solche ethnischen Identifikationen durch Diskriminierungserfahrungen seitens der Mehrheitsgesellschaft. Die Politik mancher Herkunftsländer fördert Bindungen und bleibende Identifikationen mit dem Herkunftsland durch besondere politische Maßnahmen und betrachtet »ihre Landsleute« als politische Ressource in den internationalen Beziehungen.
Für die Zukunft der gesellschaftlichen Folgen von Einwanderung stellt sich die zentrale Frage, ob diese Ansätze einer Minderheitenbildung zu einem festen Strukturmerkmal der Gesellschaft werden, oder ob ethnische Differenzierung und Minderheitenbildung als Übergangsphänomene auf dem Weg der Integration in die Mehrheitsgesellschaft und neue Nationsbildung anzusehen sind. Dies ist nicht nur eine analytische Frage, sondern auch eine Gestaltungsfrage an Politik und Gesellschaft.
Die Befestigung von ethnischen Minderheitenstrukturen ist per se noch kein gesellschaftliches Problem. Gesamtgesellschaftliche Kommunikation und Kooperation zu ermöglichen sowie die politische Loyalität der Minderheitenangehörigen als Staatsbürger zu erreichen und abzusichern, stellen dann jedoch eine permanente Aufgabe dar. Zugleich bergen ethnische Minderheiten-Mehrheits-Strukturen in Krisensituationen die Gefahr, dass soziale, wirtschaftliche und politische Konflikte ethnisiert werden. Zahlreiche historische Erfahrungen haben die Leidenschaftlichkeit und Unmenschlichkeit ethnisierter Konflikte gezeigt. Auf solche möglichen Entwicklungen hinzuweisen und diesen vorzubeugen, stellt ein legitimes Ziel von Politikberatung und Politik dar.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die beobachtbare ethnische Differenzierung und Minderheitenbildung in der Bevölkerung kein abgeschlossener Prozess, sondern ergebnisoffen ist und – auch unter dem Gesichtspunkt der Steuerbarkeit – untersucht werden muss. Für die genauere Analyse der genannten Veränderungen stellen sich folgende Untersuchungsfragen:
Sind die gegenwärtig vorfindbaren ethnischen Strukturen stabil, verstärken sie sich oder schwächen sie sich ab? Ist die ethnische Differenzierung ein Übergangsphänomen auf dem Weg zur Akkulturation oder ein dauerhaftes Merkmal der Sozialstruktur?5
Mit welchen gesellschaftstheoretischen Konzepten können die Folgen der veränderten und sich weiter verändernden gesellschaftlichen Strukturen beschrieben und analysiert werden?
Sind Nation und Nationsbildung Konzepte, mit welchen die sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen beschrieben, analysiert und gestaltet werden können?
Als methodologischer Nationalismus werden häufig Positionen kritisiert, die, wenn von »Gesellschaft« oder »Gesamtgesellschaft« die Rede ist, im Grunde immer im nationalstaatlichen Rahmen organisierte Gesellschaften als gemeinte Objekte voraussetzen.6 Ich »gestehe« gern, dass ich diesem Muster folge, auch wenn man auf einem hohen Abstraktionsniveau durchaus von »Weltgesellschaft« sprechen kann. Nation und Gesellschaft sind aufs Engste zusammenhängende Phänomene. Nation ist die kollektive Bewusstseinsform in Form einer vorgestellten Gemeinschaft, die sich ganz überwiegend auf im nationalstaatlichen Rahmen organisierte Gesellschaften bezieht.7 Sie ist eine Form des Kollektivbewusstseins, das gesellschaftliche Unterschiede überbrücken kann, zugleich aber an bestimmte Gemeinsamkeiten gebunden ist.
Ich argumentiere in diesem Buch, dass Nation und Nationsbildung Konzepte sind, mit denen die in Deutschland in der Gegenwart vorgehenden Prozesse und Folgen der Integration von Migranten zutreffend erfasst und erklärt werden können. Kapitel 9 wird sich daher mit dem gerade in Deutschland noch immer skeptisch betrachteten allgemeinen Konzept der Nation beschäftigen.8 Was besagt es und, vor allem, kann es in längerfristiger, generationenübergreifender Perspektive den wirklichen Prozess der Entwicklung der Beziehungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten und ihren Nachkommen beschreiben, aber auch orientieren? Da es verschiedene Konzepte von Nation gibt, sollen seine Verständnisweisen rekonstruiert und ein in Bezug auf die Fragestellung geeignetes Konzept entwickelt und vorgestellt werden. Weiterhin muss quasi als Voraussetzung diskutiert werden, ob es überhaupt eine Zukunft für Nationen und Nationalstaaten als Formen politischer Organisierung gibt. Vieles spricht dafür, dass trotz Globalisierung und Europäisierung Nation und Nationalstaat die dominanten Formen politischer Organisierung bleiben werden bzw. sich in vielen Regionen der Welt erst gegen regionale und stammesbezogen bornierte Strukturen herausbilden.
Nähern sich einheimische und migrantische Bevölkerungsgruppen in ihrem Bewusstsein und ihrer sozialen Lage an, bleiben überkommene Unterschiede bestehen oder werden sie sogar größer? Kapitel 3 bis 6 untersuchen diese Fragen ausführlich auf der Basis vorliegender empirischer Untersuchungen. Nach einem »Zwischenruf« über Deutschland als integrative Gesellschaft wird in Kapitel 8 kritisch diskutiert, wie die vorliegenden und in der Öffentlichkeit beachteten Theorien des Multikulturalismus, der postnationalen und der postmigrantischen Gesellschaft die Folgen von Migration und Integration für unsere Gesellschaft zu beschreiben und zu erklären suchen.
Kapitel 10 und 11 entwickeln ausführlich den Ansatz Neuer Nationsbildung. Mich interessiert, ob mit längerer Aufenthaltszeit, vor allem aber mit der Integration der zweiten und dritten Migrantengeneration Annäherungs- und Identifizierungsprozesse erfolgen, die darauf hinauslaufen, dass viele dieser Menschen zu Deutschen werden oder werden wollen; und weiter und vor allem, ob mit der Integration und Akkulturation von Migranten ein Prozess neuer Nationsbildung im Gange ist, bei welchem sich auch die Mehrheitsgesellschaft verändert.
Die ethnische Differenzierung der Bevölkerung und Sozialstruktur hat sich als Folge der Einwanderung herausgebildet, weil ethnische Strukturen der unmittelbar zugewanderten Bevölkerung nicht nur praktische Hilfen in den anfänglichen Integrationsprozessen bieten, sondern für sie auch ein Stück »Heimat in der Fremde« darstellen. Bei fortlaufender Einwanderung entstehen bei den neuen Migranten immer wieder Bedürfnislagen, die von den ethnischen Strukturen und Institutionen aufgegriffen werden und sie in ihrem Bestand reproduzieren. Aber auch nach der Erstintegration und längerem Aufenthalt können ethnische Strukturen für zumindest Teile der zugewanderten Bevölkerung und ihren Nachkommen soziale, kulturelle und materielle Bedeutung behalten.
Abhängig von der Länge des Aufenthalts, vor allem aber vom Generationenverlauf, integrieren sich große Teile der eingewanderten Bevölkerung in die Institutionen und Beziehungen der Mehrheitsgesellschaft und werden so selbst Bestandteile dieser. Kleinere Gruppen leben aber nach längerem Aufenthalt und auch in der zweiten und dritten Generation weiter vorzugsweise innerhalb der ethnischen Strukturen. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, pflegen aber weiter starke Beziehungen zu ihren oder ihrer Eltern Herkunftsländern und identifizieren sich ethnisch. Aus der Forschung über soziale Milieus in der Migrantenbevölkerung kennen wir unter den zehn identifizierten Milieus z.B. das »religiös-verwurzelte Milieu«, das ca. 6 % der Migranten umfasst und eine starke Binnenorientierung aufweist (Sinus Markt- und Sozialforschung 2018). Eine weitere Lebensform von Migranten ist dadurch gekennzeichnet, dass ein eindeutiger Lebensmittelpunkt in einer Gesellschaft nicht vorliegt. Der in der Literatur häufig thematisierte Transnationalismus, also das Leben in zwei (oder mehreren) Gesellschaften, ist ein interessantes Phänomen, aber gesellschaftlich nicht strukturbestimmend. Diese Lebensform kann nur von einer eher kleineren Zahl von Personen und Familien gewählt werden, da sie schon aus materiellen, aber auch sozialen, vor allem familialen Gründen, äußerst aufwendig und schwierig zu praktizieren ist.
Nicht nur für Einwanderer mit längerem Aufenthalt, vor allem für die nachfolgenden Generationen, stellt sich für sie selbst wie für die Aufnahmegesellschaft die Frage ihrer Zugehörigkeit und Identität. Sind sie nur anwesend, aber nicht zugehörig? Sind sie nur rechtlich zugehörig, aber identifizieren sich nicht mit dem Land, in dem sie leben? Wenn ihre Zugehörigkeit bejaht wird, ist diese definiert als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger oder über einen Status als Minderheit? Sind Migranten mehreren Gesellschaften partiell zugehörig oder auch nach längerem Aufenthalt immer noch Ausländer und der Herkunftsgesellschaft zuzurechnen? Zugehörigkeit stellt sich für die Menschen mit Migrationshintergrund als subjektive Identifizierungsfrage und als Zuschreibung der Mehrheitsgesellschaft dar. Zugehörigkeitszuschreibungen werden zum einem über das herrschend kollektive Selbstverständnis der Mehrheitsbevölkerung gebildet, zum anderen über konkrete Verfassungsartikel und Gesetze des Staates, vor allem im Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht. Diskriminierungserfahrungen, d.h. die Erfahrung unberechtigter Ungleichbehandlung, stehen der Bildung von Zugehörigkeitsgefühlen bei den Migranten im Wege.
Im wissenschaftlichen wie medialen Diskurs werden immer wieder Unsicherheiten über die konzeptionelle Erfassung der Folgen der Veränderungen von Gesellschaft und Sozialstruktur durch Migration und Integration sichtbar. In den Sozialwissenschaften wird über die neuen Verhältnisse mit widersprüchlichen Konzepten diskutiert, so mit den oben erwähnten Konzepten der multikulturellen, postmigrantischen oder postnationalen Gesellschaft. Kapitel 8 prüft ihre Eignung, die neuen Verhältnisse und deren Entwicklungstendenzen zu erfassen.
Unsicherheiten über Fragen von Zugehörigkeit und Identität spiegeln sich in der Öffentlichkeit u.a. in liberalen Leitmedien und in verschiedenen Buchpublikationen. So schreibt beispielsweise Ulrich Wickert einen Spiegel-Essay mit dem Titel »Die Deutschen sind sich fremd« und meint: »Hinter der Islamdebatte verbirgt sich eine ganz andere Frage, die nach der deutschen Identität« (Wickert 2018, 116). Wenige Wochen später überschreibt in dem gleichen Magazin Sebastian Hammelehle eine Besprechung von Neuerscheinungen zum öffentlichen Diskurs über Migration und Integration in Deutschland mit der Formulierung »Wer sind wir?« (Hammelehle 2018, 110-113). Der Economist fragt ebenfalls 2018 in einem Essay über »The new Germans«: »Whose Heimat? These days ›Germany‹ can mean many things to many people« (The Economist 2018, 6). Die (Wieder-)Prominenz des Themas Heimat in allen Feuilletons und selbst in den Namen von Ministerien9, die Zuständigkeiten für Integration von Ausländern haben, lässt sich als Versuch werten, Gewissheiten über Identitäten und Zugehörigkeiten (wieder)zugewinnen.
Eine Reihe publizistischer Produktionen, populistisch auf ein breiteres Publikum zielend, verstärkt allerdings vorhandene Unsicherheitsgefühle und schürt Bedrohungsängste. Als Beispiele aus einer längeren Reihe: »Deutschland schafft sich ab« (Sarrazin 2010); »Kontrollverlust: Wer uns bedroht und wie wir uns schützen« (Schulte 2017); »Gehört der Islam zu Deutschland?« (Schlicht 2017); »Deutschland außer Rand und Band. Zwischen Werteverfall, Political Correctness und illegaler Migration« (Paulsen 2018); »Der Selbstmord Europas, Immigration, Identität, Islam« (Murray 2018). Auf rechtsradikaler Seite hat sich eine »identitäre Bewegung« formiert, die durch Rekurs auf völkische Ideologie Gewissheiten anzubieten behauptet.
Autorinnen und Autoren mit Migrationsgeschichte greifen das Thema der Zugehörigkeit in biografischer Weise auf und verbinden es mit alltagsbezogenen und politisch-gesellschaftlichen Forderungen. Einer der ersten war Cem Özdemir mit seinem Buch »Ich bin Inländer. Ein anatolischer Schwabe im Bundestag« (1997). Aus jüngerer Zeit können beispielhaft genannt werden Tuba Sarica mit ihrem Buch »Ihr Scheinheiligen! Doppelmoral und falsche Toleranz. Die Parallelwelt der Deutschtürken und die Deutschen« (2018), Ferda Ataman »Hört auf zu fragen! Ich Bin Von Hier (2019), Nariman Hammouti-Reinke »Ich diene Deutschland« (2019) oder Michel Abdollahi mit »Deutschland schafft mich. Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin« (2020). Optimistischer, sehr informativ, humorvoll und systematisch reflektierend ist »Der Mann ohne Muttersprache« von Rahman Jamal (2021); zuversichtlich und von einer positiven Grundstimmung ist ebenfalls Düzen Tekkals »German Dream«, eine offensichtliche Anspielung auf den American Dream und Deutschland als Land der Chancen (Tekkal 2020). Kurze autobiografische Essays von 27 erfolgreichen und bekannten Persönlichkeiten türkischer Herkunft sind in einem Band vereint, der für schließliche Bindung an Deutschland steht. Er trägt den Titel »Wie Deutschland zur Heimat wurde« (Mutlu 2022).
Ganz häufig berichten migrantische Autoren von Diskriminierungserfahrungen, deren Kern die Verweigerung der Zugehörigkeits- und Gleichberechtigungsanerkennung durch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft ist. Zugleich gibt es aber zahlreiche Stimmen aus der Mehrheitsgesellschaft, die z.B. von den »Transformationen des Wir-Gefühls« (Blomert et al. 1993) oder einem »neuen Wir« (Plamper 2019) sprechen sowie für ein »Vielfältiges Deutschland« (Bertelsmann Stiftung 2014) und für Offenheit gegenüber Zuwanderern werben. Nicht ganz klar oder nicht ausgesprochen bleibt dabei häufig, um welches »Gebilde« es sich denn handelt, das offen sein soll und in dem es dieses »neue Wir« gibt oder geben soll. Dabei fällt auf, dass die Begriffe und die Bedeutung von Nation und Nationalstaat in diesem Kontext in Deutschland bisher nur eine geringe Rolle spielen.10 Im Gegensatz dazu gehe ich in diesem Buch davon aus, dass Vorstellungen und Praxis von Nation und Nationalstaat ganz entscheidend für die Gestaltung der Beziehungen zu den Zuwanderern und den Verlauf von Integrationsprozessen sind. Sie prägen die Vorstellungen über Zugehörigkeit und Identität und beeinflussen die Sichtweise und Bewertungen der von den Zuwanderern »mitgebrachten« Ethnizität.
Die Vorstellungen von Zugehörigkeit auf der Basis von Nationskonzepten gehen rechtlich ein in die Gestaltung des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts, Zusammenhänge, die in der soziologischen Forschung klassisch von Rogers Brubaker (1989, 1992) für das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts am Beispiel Frankreichs und Deutschlands herausgearbeitet wurden. Ohne den Schwerpunkt wie Brubaker auf die Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts zu legen, stellt sich die vorliegende Studie die Aufgabe, Zusammenhänge zwischen der ethnischen Differenzierung und der Entwicklung des Nationskonzepts und ihrer gesellschaftlichen und politischen Bewertung zu untersuchen. Es wird dabei gefragt, ob sich ein Prozess der Annäherung zwischen Einheimischen und Migranten zeigt, der zur Abschwächung der Bedeutung ethnischer Herkunft führt und Voraussetzungen für neue Nationsbildung schafft.
Die bisherige Vernachlässigung einer solchen Perspektive scheint damit zusammenzuhängen, dass aus historischen Gründen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den Sozialwissenschaften »Nation« in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem belasteten und vernachlässigten Thema geworden war (Richter 1997, 60).11 Exzesse des Nationalismus, Krieg, Vertreibungen und Ermordung großer Bevölkerungsgruppen durch den Nationalsozialismus hatten auch den Begriff der Nation diskreditiert. Arbeiten von Francis (1976) und Lepsius (1986 und 1990) über die Rollen von Nation und Ethnizität in Gesellschaft und Politik bilden dabei gewisse Ausnahmen, die aber in der Soziologie keinen diskursbestimmenden Einfluss hatten.
Zumindest in der Politikwissenschaft, die die Vernachlässigung des Themas mit der Soziologie lange Zeit teilte, zeigt sich in den letzten Jahren eine gewisse Veränderung und ein gestiegenes Interesse an der Untersuchung der Relevanz des Nationalen und des Nationalstaats. So stellte die Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft ihre 35. Jahrestagung im Jahr 2017 unter das Thema »Zur Lage der Nation«. »Abgesehen von der viele Beobachter überraschenden nationalstaatlichen Lösung der ›deutschen Frage‹ vor mittlerweile schon fast drei Dekaden, gewannen in den letzten gut zehn Jahren weltweit bestimmte Aspekte des Nationalen und Nationalstaatlichen wieder an Aktualität und Beachtung. Einerseits durch den Aufstieg von Ländern wie China, Indien und anderen (ehemaligen) Entwicklungs- und Schwellenländern, deren Regierungen bei aller wirtschaftlichen Öffnung in politischer Hinsicht größten Wert auf die Erhaltung nationaler Souveränität legen und sich skeptisch gegenüber supranationalen Lösungen zeigen. Andererseits formuliert eine heterogene Kritik an bestimmten kulturellen und ökonomischen Aspekten der Globalisierung in den Ländern des Westens ihr Unbehagen häufig in nationalen und teilweise nationalistischen Begriffen« (Masala 2018, 5). Der von Masala herausgegebene Sammelband (Masala 2018) dokumentiert zentrale Beiträge der Jahrestagung 2017. Auch in den Kulturwissenschaften zeigt sich Interesse für das Thema Nation (Götz 2011; Assmann 2020). Fast schon wie eine Aufgabe für meine Studie formuliert Assmann im Titel ihres Buches »Die Wiedererfindung der Nation. Warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen«. In jüngster Zeit zeigt die eindrucksvolle und mutige Erhebung der ukrainischen Bevölkerung gegen die Invasion russischer Truppen die praktische Bedeutung und Solidarisierungskraft des Nationskonzepts. Das Geschehen kann geradezu wie ein Laborexperiment in Sachen Nationsbildung betrachtet werden (Skalnik 2023).12
Das vorliegende Buch verfolgt nicht zuletzt das Ziel, in einer Situation der Unsicherheit über die mittel- und längerfristigen Folgen von Migration und Integration eine Orientierung zu geben. Es geht um die Definition der gesellschaftlichen Situation, um die Entwicklung eines Framing-Konzepts. Dieses stellt ein Angebot für die Wahrnehmung und Interpretation der gesellschaftlichen Realität dar und enthält quasi eine Aufforderung für die Entwicklung von »Narrativen« oder Erzählungen darüber, welche Richtung unsere Gesellschaft unter dem Einfluss von Einwanderung nehmen könnte. Frames können also der Handlungsorientierung dienen. Sie sind Modelle und Vorstellungen der Akteure über ihre Situation, über die Rahmenbedingungen ihres Handelns, die in ihre Entscheidungen als Definition der Situation eingehen. Sie stellen eine kognitive Ordnung dar, ein Modell der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit, das Akteure übernehmen, ablehnen oder modifizieren können (Esser 1993, 94).
Die gesellschaftliche Bedeutung von Framing-Prozessen kann an einem Beispiel aus den Arbeiten des Autors selbst erläutert werden. Als in den 70er und 80er Jahren ersichtlich wurde, dass ein bedeutender Teil der sogenannten Gastarbeiter und ihrer nachgeholten Familien entgegen allgemeiner Erwartungen im Lande blieb, entstand eine Diskussion, ob die Bundesrepublik ein Einwanderungsland sei oder nicht. Das war im Grunde bereits eine erste Zugehörigkeitsdiskussion und insofern von Bedeutung, als mit einer bestimmten Definition der Situation auch bestimmte Handlungsfolgen und politische Entscheidungen zu erwarten waren, die, abhängig von der Definition der Situation, unterschiedlich ausfallen würden. Das Buch »Die Bundesrepublik: ein Einwanderungsland? Zur Soziologie der Gastarbeiterbevölkerung als Einwandererminorität« (1981), auch in zahlreichen Vorträgen einer interessierten Öffentlichkeit erläutert, konnte, ohne dass sich das exakt bemessen lässt, einen Beitrag dazu leisten, dass schließlich nach langen argumentativen und politischen Auseinandersetzungen im Jahre 1998 eine offizielle Definition des Landes als Einwanderungsland erfolgte.13 Dies bildete in den folgenden Jahren die Grundlage für die Entwicklung einer systematischen Integrationspolitik, die vom Bleiben von Gastarbeitern und ihrer Familien sowie anderer Zuwanderergruppen ausging.
Das »Bleiben« der Gastarbeiter war der Ausgangspunkt für die ethnische Differenzierung von Sozialstruktur und Gesellschaft in Deutschland seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.14 Ethnische Differenzierung verläuft zeitgleich zu anderen Prozessen sozialer und sozialökonomischer Differenzierung, die moderne und »spätmoderne« Gesellschaften kennzeichnen: etwa die Ausdifferenzierung von Produktion und Dienstleistungen und damit verbundene fortschreitende Arbeitsteilung, die Differenzierung von Lebenswelten und kultureller Milieus oder die fortschreitende Differenzierung von Formen des Zusammenlebens und von Familienstrukturen. Differenzierung und vor allem zunehmende Differenzierung des Systems der Gesellschaft als eine Seite der Entwicklung erfordern auf der anderen Seite bestimmte Integrationsmechanismen und Leistungen, die den Bestand des Systems sichern. Diese bekannte Einsicht funktionalistischer Systemtheorie wird auch von Theoretikern der Spätmoderne geteilt: »Eine Gesellschaft, auch wenn sie noch so differenziert und individualisiert ist, kommt offensichtlich nicht ohne ein Mindestmaß an sozialer Integration aus, das heißt an zivilen Normen, die alle teilen. Fehlen solche gemeinsamen Regeln … bricht das Soziale zusammen« (Reckwitz 2020, 12).15
Für die Integration ethnischer Gruppen bedeutet dies, dass bei aller Differenzierung die Notwendigkeit bestimmter gemeinsam geteilter kultureller Orientierungen und Werte zwischen Zuwanderern und ihren Nachkommen und der »Mehrheitsgesellschaft« besteht. Wenn es diese Gemeinsamkeiten gibt, müssen sie erhalten werden oder, im anderen Fall, neu in den Reihen der Migranten und Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft etabliert werden. In Kapitel 10 und 11 wird gezeigt, dass ein reformulierter und zukunftsfähiger Nationsbegriff zum einen die Mehrheitsgesellschaft zur Neuorientierung herausfordert, zum anderen eine Einladung an Migranten und Personen mit Migrationshintergrund zur Mitgliedschaft beinhaltet. Dies schließt die Erwartung und das Angebot ein, trotz Unterschieden einen Satz von Grundwerten und -regeln zu teilen, »das Wohl der eigenen Gesellschaft als kollektives Projekt« (ibidem) zu begreifen.
Von den ca. 22 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland waren im Jahr 2022 ca. 12 Mio. Ausländer. Die vorliegende Untersuchung geht nicht davon aus, dass mögliche Nationsbildungsprozesse diese Gruppe der 12 Mio. Ausländer insgesamt betreffen. Das gesamte Migrationsgeschehen in Deutschland ist nicht nur von hohen Zuwanderungszahlen, sondern auch zumeist von hohen Abwanderungszahlen gekennzeichnet. Es herrscht ein »starkes Kommen und Gehen« mit vergleichsweise niedriger Nettozuwanderung und von ca. 200.000 bis ca. 400.000 Wanderungsfällen.16 Vielerlei persönliche und familiale Gründe, nur temporärer Aufenthalts- oder Schutzstatus und staatliche Zwangsmaßnahmen führen zu hohen Abwanderungszahlen mit der Konsequenz, dass viele Menschen, die im Lande sind, nur temporär in Deutschland leben. Die Untersuchung von möglicher Nationsbildung ist daher bezogen auf Menschen mit langem Aufenthalt, die gesellschaftlich integriert und häufig eingebürgert sind und auf die Kinder und Kindeskinder von Eingewanderten.
Eine abschließende Bemerkung zur Terminologie. Bei der Bezeichnung der Akteurinnen und Akteure im Feld der Migration und Integration werde ich, wenn es nicht zur Verstärkung von Vorurteilen und ausgrenzenden Zuschreibungen führt, »etablierte« Begriffe verwenden, auch wenn sie inhaltlich z.T. problematisch sind. Als Beispiel sind Migrantinnen und Migranten ja Personen, die selbst gewandert sind; es hat sich aber in der internationalen und deutschen Migrationsforschung eingebürgert, auch noch deren Kinder, die im Einwanderungsland geboren wurden, mit Migration in Verbindung zu bringen und als zweite Migrantengeneration zu bezeichnen. Man benötigt ein Konzept und Daten für die Kinder von Einwanderern, um Partizipationsfortschritte messen zu können.
Ein weiteres Beispiel: Statt konsequent immer wieder von Personen mit und ohne Migrationshintergrund zu sprechen, vergleiche ich in bestimmten Kontexten »Migranten« mit »Einheimischen«, auch wenn ich weiß, dass Migranten im Allgemeinen nach längeren Aufenthaltszeiten zu Einheimischen werden. Wenn man das Wort Migrationshintergrund nicht besonders mag, kann man aber auf das Konzept, für welches das Wort steht, nicht verzichten. Es steht für das Forschungsinteresse, Annäherungen oder Distanzierungen zwischen Gruppen erfassen zu können, was nicht zuletzt für die integrationspolitische Praxis von höchster Relevanz ist.
2Wie sich Nationsbildung methodisch untersuchen lässt
Als Resultat der Zuwanderung hat sich die Sozialstruktur Deutschlands stark differenziert und es sind neue Unterscheidungen von Lebenslagen, sozialen Beziehungen und Bewusstseinsformen entstanden. In den Kapiteln 3 bis 6 wird untersucht, wie sich in verschiedenen gesellschaftlichen und individuellen Bereichen Unterschiede zwischen Mehrheits- und Migrantenbevölkerung im Zeit- und Generationenvergleich empirisch entwickelt haben, d.h. ob sie sich verstärkten, verfestigten, abschwächten oder nicht mehr existieren. Verändern sich z.B. im Zeitverlauf Unterschiede in Bildungsabschlüssen zwischen erster und zweiter Generation oder zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund? Für die Einschätzung zukünftiger Trends sind gegenwärtige Trends eine ganz wichtige Grundlage: Einmal etablierte Strukturen und auf den Weg gebrachte Entwicklungen zeigen häufig eine langfristige Stabilität, die sozialwissenschaftlich als Pfadabhängigkeit von Entwicklungen begriffen wird.
Für die Analysen können wir auf eine Vielzahl vorliegender empirischer Untersuchungen sowie auf amtliche Statistik mit einer großen Zahl von Daten zurückgreifen. Die jeweiligen Untersuchungsdaten sind zwar für je spezifische Fragestellungen erhoben und ausgewertet worden, können aber häufig zugleich aus der Perspektive des dargestellten Erkenntnisinteresses analysiert werden. Viele Studien greifen dabei auf Datensätze des Mikrozensus, des Sozioökonomischen Panels oder des European Social Survey zurück; andere Studien haben eigene Daten erhoben.
Bezogen auf das Interesse an der Entwicklung ethnischer Differenzierung und an Nationsbildung könnten Kritiker fragen, ob der Autor nicht zumindest implizit einer bestimmten normativen Agenda folgt, die das Ideal einer möglichst homogenen Gesellschaft und Nation nach nationalistischem Muster anstrebt. Das wäre ein gravierendes Missverständnis. Bei dem Interesse an der Entwicklung von Unterschieden geht es zunächst keinesfalls nur um die Untersuchung von Veränderungen der zugewanderten Bevölkerung im Verlauf des Eingliederungsprozesses, sondern zentral ebenso um die Frage von Veränderung der aufnehmenden Gesellschaft und um die Art und Weise, wie sie sich auf die neue Situation einstellt. Das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf das Verstehen gegenwärtiger Entwicklungstendenzen ethnischer und migrantischer Differenzierung und der Bedingungen gesellschaftlicher und politischer Integration, alltagssprachlich häufig als gesellschaftlicher Zusammenhalt bezeichnet. Dieser ist z.B. gefährdet, wenn soziale, wirtschaftliche und kulturelle Probleme und Konflikte ethnisiert werden und zu ethnischen Konflikten führen.
Ob sich Prozesse der ethnischen und/oder migrantischen Differenzierung verfestigen oder es zu Annäherungen und der Abschwächung von Unterschieden zwischen Einheimischen und Zuwanderern kommt, soll auf der Basis der Sekundärauswertung vorliegender empirischer Studien untersucht werden. Die Auswahl zentraler Bereiche für die Analyse dieser Fragestellung erfolgt auf der Grundlage der Integrationstheorie mit ihren zentralen und wechselseitig abhängigen Dimensionen der strukturellen, kulturellen, sozialen und identifikativen Integration.17 Dieser Ansatz ist verwandt mit grundlegenden Prämissen der Theorie Richard Albas, der vor allem die Integration und den Aufstieg zuvor diskriminierter und benachteiligter europäischer Einwanderergruppen in den USA wie der Osteuropäer, Südeuropäer und von Juden im 20. Jahrhundert untersucht und erklärt hat. Als zentrale Faktoren für Annäherung nennt Alba: »… social mobility, which produces parity with many individuals in the mainstream, the growth of amicable personal relationships with such individuals; and the mainstream cultural change that elevates the moral worth of minority individuals …« (Alba 2020, 8/9).18 Der letzte Punkt zeigt, dass Annäherungen und Integration nicht nur Veränderungen bei den Einwanderern, sondern auch bei den Einheimischen erfordert.
Im Einzelnen werden Studien zu folgenden Bereichen ausgewertet:
Bildung und Qualifizierung (strukturelle Integration)
Erwerbstätigkeit (strukturelle Integration)
Rechtsstatus (strukturelle Integration)
Kultur, Werte, Religion (kulturelle Integration)
Persönliche Kontakte, Nahbeziehungen (soziale Integration)
Zugehörigkeiten und Identifizierungen (identifikative Integration)
Partizipation und politische Beteiligung (strukturelle Integration)
Mittel- und längerfristige Entwicklungen der ethnischen und migrantischen Differenzierung können konzeptuell und empirisch auf verschiedene Weise erfasst werden. Die erste Möglichkeit ist, auf die Wirkung der Aufenthaltsdauer von Migranten im Einwanderungsland zu schauen. Das ist eine Sicht, die sich auf Menschen bezieht, die selbst gewandert sind, also die sogenannte erste Migrantengeneration. Aufenthaltsdauer steht für Zeitraum und Intensität der Einflüsse der Einwanderungsgesellschaft und deren Aneignung, Abwehr oder Ignorierung durch Migrantinnen und Migranten und impliziert, dass Veränderung und Integration eine Funktion von Zeit sind. Veränderungen, die sich mit der Aufenthaltsdauer einstellen, bieten Hinweise darauf, wie und in welche Richtung sich ethnische und migrantische Differenzierung entwickeln.
Eine weitere Möglichkeit, die Entwicklung ethnischer und migrantischer Differenzierung zu verfolgen, besteht darin, intergenerationale Unterschiede zu erfassen. Variablenwerte von erster und zweiter Generation können verglichen werden wie auch jeweilige Unterschiede der Werte von erster und zweiter Generation im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft. So kann z.B. die Erwerbstätigkeitsquote von erster und zweiter Generation direkt verglichen werden und/oder ein Vergleich des Unterschieds der Erwerbstätigkeitsquote zur Mehrheitsgesellschaft im Zeitverlauf analysiert werden. Letzteres lässt sich auch als Vergleich der Beschäftigungslücke zwischen erster und zweiter Generation bezeichnen. Beschäftigungslücke meint in der Erwerbstätigkeitsstatistik die Differenz der Erwerbstätigkeitsquoten zwischen Bevölkerungsgruppen.19 Will man die dritte Generation noch Migranten nennen, kann der Generationenvergleich natürlich auch auf diese erweitert werden.20 Man muss sie nicht »Migranten« nennen, es ist aber für das Interesse an längerfristigen Entwicklungen wichtig zu erfahren, was aus den Enkeln und Enkelinnen der Einwanderer geworden ist. Dabei ist auf die Besonderheiten des Generationenkonzepts in der Integrationsforschung zu achten.
Der soziologische Generationsbegriff thematisiert im Allgemeinen, dass die Zugehörigkeit zu gleichen oder ähnlichen Geburtsjahrgängen in einer historisch, kulturell und politisch definierten räumlichen Einheit über den lebensprägenden Sozialisationsprozess zu einer bestimmten Gemeinsamkeit von Erfahrungen, Haltungen und Verhalten führt. »Individuen sind als Beobachter, Akteure und Opfer immer schon in die übergeordnete Dynamik geschichtlicher Ereignisse eingebunden. Jeder Mensch ist in seiner Altersstufe von bestimmten Schlüsselerfahrungen geprägt, und ob man will oder nicht, teilt man mit der Jahrgangskohorte gewisse Überzeugungen, Haltungen, Weltbilder, gesellschaftliche Wertmaßstäbe und kulturelle Deutungsmuster« (Assmann 2014, 26). In unterschiedlichen soziokulturellen Milieus werden allerdings jeweilige zeitlich gemeinsame Ereignisse unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert, was zu einer Ausdifferenzierung der Generationsgemeinsamkeiten führt. Der Generationsbegriff der Migrations- und Integrationsforschung setzt ebenfalls an der Gemeinsamkeit von Erfahrungen bestimmter Kohorten von Menschen an, aber nicht primär in der zeitlich-historischen Dimension. Angehörige einer Migrantengeneration können, müssen aber keineswegs in dem gleichen historischen Zeitraum gelebt haben. Das Gemeinsame der Erfahrungen bezieht sich bei der ersten Generation vor allem auf typische Erfahrungen, die mit der Einwanderung in ein neues Land gemacht werden, auf neue Herausforderungen und eine neue Sozialisation, die man als Erwachsener durchläuft, nicht primär auf die gleichen Zeitumstände, unter denen man gelebt hat. Bei der zweiten Generation bestehen die gemeinsamen Erfahrungen aus bestimmten Anforderungen und Sozialisationsprozessen, die typisch für die Kinder von Einwanderern sind, z.B., dass man zu Hause eine andere Sprache spricht als in der Gesellschaft, in der man lebt und/oder Diskriminierungen ausgesetzt sein kann oder ist.
Vergleiche zwischen erster und zweiter Generation haben eine lange Tradition in der Integrationsforschung. In der neueren Forschung zeigt sich, dass es bedeutsame Unterschiede im Integrationsprozess auch innerhalb der ersten Generation gibt, abhängig vom Lebensalter bei der Einwanderung (Rumbaut 2004). Es wird unterschieden zwischen der Einwanderung in der frühkindlichen Phase (0-5), der 1,75. Generation, der Phase der mittleren Kindheit (6-12), der 1,5. Generation und der Phase der Pubertät (13-17), der 1,25. Generation (ibidem, 1181).21 Die Dezimalstellen stehen für die Nähe der Bedingungen des Aufwachsens zur zweiten Generation, die im neuen Land geboren wurde. Für die Forschung in Deutschland wird sich allerdings zeigen, dass es nur ganz wenige Untersuchungen gibt, die mit diesen Differenzierungen des Generationskonzepts arbeiten.
Eine weitere Möglichkeit, die Entwicklung ethnischer und migrantischer Differenzierung zu verfolgen, stellen Vergleiche der Daten von Personen mit und ohne Migrationshintergrund im Zeitverlauf dar. Seit 2005 ist es möglich, im Mikrozensus Personen mit Migrationshintergrund zu identifizieren und damit Vergleiche für eine Reihe von Daten mit Personen ohne Migrationshintergrund im Zeitverlauf durchzuführen. Der Kern des Konzepts Migrationshintergrund erfasst Ausländer, eingebürgerte Deutsche und zugewanderte deutsche Spätaussiedler sowie die Kinder dieser drei Gruppen unter Einschluss von Familienangehörigen in Familien, in denen ein Elternteil Einheimische(r) ist.22 Letzteres wird in der Forschung als einseitiger Migrationshintergrund bezeichnet. Einzelne Untersuchungen treffen diese Unterscheidung und kommen zu relevanten Unterschieden im Sozialisationsprozess (z.B. Die Beauftragte 2021, 105).
Gegenüber der lange vorherrschenden Unterscheidung der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit erlaubt das Konzept des Migrationshintergrunds über die Analyse der Entwicklung von Unterschieden zwischen den Bevölkerungen mit und ohne Migrationshintergrund das genauere Erkennen des Verlaufs von Integrationsprozessen; so z.B. auch von Integrationserfolgen, die im Fall von Einbürgerungen verborgen bleiben, da die Daten für die Eingebürgerten den Deutschen zugeordnet werden und Eingebürgerte überwiegend Personen sind, deren Integration erfolgreich verlaufen ist. Entsprechend ermöglicht das Konzept ebenfalls, bleibende Herausforderungen der Integration besser zu identifizieren.23
Aus theoretischer und praktisch-politischer Sicht ist es weiterhin relevant zu untersuchen, ob bei der Entwicklung ethnischer Differenzierung nicht nur Unterschiede zwischen Einheimischen und Personen nichtdeutscher Herkunft eine Rolle spielen, sondern auch, ob die Unterschiede zwischen den Personen nichtdeutscher Herkunft bedeutsam sind. Haben z.B. Personen italienischer Herkunft signifikant andere Erwerbstätigkeitsquoten oder Zugehörigkeitsgefühle als Personen vietnamesischer und türkischer Herkunft? Ethnizität bzw. ethnische Herkunft wird daher methodisch in die Untersuchung einbezogen werden, wenn entsprechende Daten vorliegen. Der hier gewählte Untersuchungsansatz unterscheidet sich von einer ethnografischen Vorgehensweise, bei welcher mit Methoden ethnografischer Feldforschung die Entwicklung einzelner ethnisch-religiöser Migrantenminderheiten oder von Diaspora-Gruppen generationenübergreifend untersucht werden. Diasporas kann man dabei im Vergleich zu den genannten Migrantenminderheiten als noch stärker Herkunftsland-orientiert ansehen (Safran 1991).
Kern des Nationskonzepts, das als allgemeines Konzept in Kapitel 9 ausführlich dargestellt wird, ist die »vorgestellte Gemeinschaft«. Stärker als das in vorliegender Literatur diskutiert wird, gehe ich davon aus, dass bestimmte materielle, soziale und psychische Bedingungen gegeben sein müssen, damit es überhaupt zu einer vorgestellten Gemeinschaft in einer Bevölkerung kommen kann. Afrikanischen Ländern, die Nationsbildung anstreben und deren Regierungen sich selbst schon als Nationen bezeichnen, gelingt es in sehr vielen Fällen nicht oder nur unzureichend, Spaltungen und Konflikte aus dominanten Stammes- und Clanstrukturen durch übergreifende Vorstellungen zu überbrücken. Sie sind Nationen nur nach ihrer Selbstbezeichnung. Materielle, soziale und psychische Grundlagen der Nationsbildung lassen sich für die vorliegende Studie in der Annäherung oder Angleichung von Lebenslagen sowie Verhaltens- und Bewusstseinsformen von Bevölkerungsgruppen identifizieren. In den folgenden Kapiteln 3 bis 6 geht es um die Untersuchung der Annäherung oder Angleichung zwischen Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund als möglicher Grundlage für Nationsbildung.
3Annäherungen bei Bildung, Qualifizierung und Erwerbstätigkeit
3.1Bildung und Qualifizierung
Viele Daten zeigen Unterschiede zwischen den Bildungsgängen und dem Bildungs- und Qualifizierungsstand von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. In pauschaler Betrachtung sind diese Unterschiede zumeist Bildungsnachteile bei den Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Vor einer näheren Betrachtung der gegenwärtigen Bildungslage und der Analyse von Entwicklungen muss für eine Erklärung der Entstehung dieser bis in die Gegenwart bestehenden strukturellen Unterschiede zunächst auf die Ausgangssituation der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik hingewiesen werden.
Integration und Bildung in Deutschland sind nämlich noch immer von der Tatsache beeinflusst, dass die Anwerbung der Gastarbeiter für unbeliebte und nur geringe Qualifikation erfordernde Positionen und Tätigkeiten erfolgte und damit faktisch zunächst vor allem »bildungsferne« Bevölkerungsgruppen ins Land geholt wurden. Dieser Effekt war nicht beabsichtigt, aber eine Folge der Fehleinschätzung eines nur temporären Aufenthalts der Gastarbeiter. Die nachfolgende und bis in die Gegenwart andauernde Familienmigration war und ist weiter stark von dieser Ausgangssituation mitgeprägt: Es hat sich eine bestimmte Pfadabhängigkeit von Migration und Integration von der Ausgangssituation der Anwerbung entwickelt. Die Zuwanderung von »bildungsnäheren« Bevölkerungsgruppen über die europäische Freizügigkeit, die Anwerbung von Fachkräften und Hochqualifizierten aus Drittstaaten, aber auch die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit vielfältigen und höheren Qualifikationen24 schwächt die genannte Pfadabhängigkeit in der Gegenwart ab und führt zu einer Differenzierung der migrantischen Sozialstruktur, hat sie aber als Einfluss nicht beseitigt.
Das Interesse der vorliegenden Studie ist vor allem darauf gerichtet zu analysieren, wie sich vorhandene Unterschiede bei Bildung und Qualifikation zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund im Zeit- und vor allem im Generationenverlauf entwickelt haben, ob es zu Annäherungen zur einheimischen Bevölkerung oder der Befestigung und Reproduktion von Unterschieden und Ungleichheiten kommt. Dieser Aufgabenstellung stehen allerdings beträchtliche methodisch-statistische Hindernisse im Wege. Zentrale amtliche Daten z.B. für Schulbesuch, Schulleistungen und Schulabschlüsse werden nach wie vor nur nach Staatsangehörigkeit erhoben. Da unter den Deutschen auch eine beträchtliche Zahl eingebürgerter Familien ist und stärker integrierte und bildungsnähere Personen auch eine höhere Einbürgerungsquote haben, »übertreibt« die nach Staatsangehörigkeit gegliederte Schulstatistik die Bildungsnachteile der Kinder mit Migrationshintergrund, verbirgt die Integrations- und Schulerfolge der eingebürgerten Kinder und rechnet sie den einheimischen Deutschen zu. Die amtliche Schulstatistik ist daher für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie von geringem Wert.
In dieser Situation ist die über Befragungen im Mikrozensus oder in anderen Untersuchungen erfolgende Erhebung von Schuldaten nach Migrationsstatus ein Ausweg und eine Alternative. Probleme von Schuldaten anderer Art, z.B. von Zensuren als Leistungsmessungen, können durch die Messung von Kompetenzen in eigenen Untersuchungen jeweiliger Forschungsprojekte kompensiert werden, wie das etwa in den PISA-Forschungen seitens der OECD erfolgte. Auch das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) an der Universität Bamberg arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Kompetenzmessungen. Am bekanntesten ist hier das Nationale Bildungspanel (NEPS), das Längsschnittdaten zu Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklung im Lebensverlauf in Deutschland erhebt.
Bei der Analyse von Daten zu migrationsbezogenen Annäherungen oder Auseinanderentwicklungen im Bereich der Bildung muss weiterhin beachtet werden, dass es bei der starken Flüchtlingsaufnahme mit vielen Kindern und Jugendlichen seit 2015 und erneut mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine nach 2022 zu einer Vergrößerung und vor allem zu einer Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gekommen ist. Beträchtliche Teile haben nur relativ kurze Aufenthaltszeiten, was sich stark auf den Stand ihrer Integration und ihre Bildungslage auswirkt. Wenn Daten für ganze Kohorten nur nach Migrationshintergrund erfasst werden, indizieren sie also scheinbar eine »Verschlechterung« des erreichten Integrationsstandes der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. So bleibt etwa die Quote des Krippenbesuchs von Migrantenkindern trotz einer starken Zunahme des Krippenbesuchs dieser Kinder in den letzten Jahren fast konstant (Abbildung 3.1). Solche Sonderentwicklungen wie die Flüchtlingskrise oder der Ukrainekrieg müssen bei der Interpretation von Zeitreihendaten berücksichtigt werden, die nicht nach Aufenthaltszeit der Befragten differenzieren.
Eine weitere Differenzierung des Migrationshintergrunds lässt sich nach sogenanntem einseitigen oder zweiseitigen Migrationshintergrund durchführen. Mit der Zunahme interethnischer Ehen- und Familienbildung wird interessant, welcher Einfluss hiervon auf die Bildung der Kinder ausgeht. Ist ein Elternteil eingewandert, ein anderer nicht, stellt sich die Frage, ob es in der zweiten Generation Unterschiede im Bildungserfolg zwischen »einseitigem« oder »zweiseitigem« Migrationshintergrund gibt. Beachtet werden müssen auch interethnische Unterschiede innerhalb der Migrationsbevölkerung. Zwar zeigt das Gesamtbild der Bildungslandschaft eine Benachteiligung von Migrantenkindern, es gibt aber gleichzeitig starke nationale bzw. interethnische Unterschiede im Bildungsverhalten und den Schulleistungen. So erreichen etwa Kinder aus Familien jüdischer Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion und Kinder aus vietnamesischen Familien bei vergleichbaren Voraussetzungen bessere Schulabschlüsse als einheimische Kinder (Ben-Rafael et al. 2006; Walter 2011).
Bei der Interpretation von Bildungsdaten von Migrantenkindern sollte weiterhin immer gefragt werden, ob es sich bei Unterschieden um die Wirkung von mit Migration und ethnischer Zugehörigkeit zusammenhängenden Einflüssen handelt oder Unterschiede durch Einflüsse des sozioökonomischen Status und des kulturellen Kapitals von Familien erklärt werden können. Sozioökonomischer Status und kulturelles Kapital sind als Determinanten von Bildungserfolg oft eng miteinander verbunden, allerdings nicht ohne Ausnahme, wie Modood in Großbritannien fand. Bildungserfolge der Kinder von südostasiatischen und chinesischen Unterschichtenfamilien erklärt er mit einer spezifisch ethnisch-kulturellen Konstellation von familialen Bildungsaspirationen und durchgesetztem Verhalten: »… the motor of the British South Asians and Chinese overcoming disadvantage lies in the immigrant parents‹ getting to internalize high educational ambition and to enforce appropriate behaviour« (Modood 2004, 87).
Im Folgenden gehe ich zunächst in kompakter Form auf Entwicklungen bei frühkindlicher Bildung ein, sodann auf Aspekte schulischer und beruflicher Bildung sowie des Studiums.
Frühkindliche Bildung
In der frühkindlichen Phase lässt sich bei Kindern mit und ohne Migrationsgeschichte eine erste Phase von null bis unter drei Jahren unterscheiden, in der die Mehrheit aller Kinder nach wie vor nur familial betreut wird und eine zweite Phase von drei bis sechs Jahren, in der die Mehrheit aller Kinder Kitas besucht. In beiden Phasen nähern sich die nach Migrationsstatus unterschiedenen Betreuungsquoten bis 2016 an (Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen 2019, 104). Mit der großen Flüchtlingszuwanderung seit 2015 steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen plötzlich stark an, was in statistischer Gesamtbetrachtung den Annäherungstrend trotz gestiegener Investitionen in den Bereich vorschulischer Bildung25 unterbricht (Abbildung 3.1).
Abbildung 3.1:Betreuungsquoten in Krippe und Kita 2014-2020 nach Migrationshintergrund
Quelle: Sachverständigenrat für Integration und Migration (2021, 2)