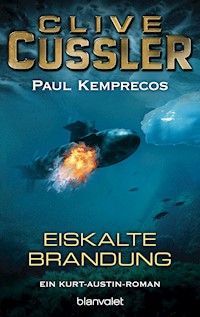
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Eben noch schien mit dem geheimen medizinischen Unterwasserlabor alles in Ordnung zu sein. Im nächsten Moment ist es einfach verschwunden! Kurt Austin von der NUMA setzt sofort alles daran, es wieder aufzuspüren. Denn dort wurde der einzige Impfstoff entwickelt, der eine Pandemie in China noch verhindern könnte, die Millionen den Tod bringen wird. Dabei kommt er einem chinesischen Verbrecherkartell auf die Spur, das weit mehr anstrebt als nur Geld – und nur Austin steht noch zwischen ihm und seinem Ziel …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Paul Kemprecos
Eiskalte Brandung
Roman
Aus dem Englischen
von Michael Kubiak
»Wenn sich die Epidemie mit gleichbleibender
Geschwindigkeit ausbreitet, könnte das rein rechnerisch
durchaus den Untergang der Menschheit zur Folge haben.«
– Dr. Vince Vaughn,
– The American Experience, »Influenza 1918«
»Empfohlen werden morgendliche und abendliche Nasenspülungen mit Seifenwasser; zwingen Sie sich, abends und morgens heftig zu niesen, dann machen Sie einige tiefe Atemzüge; tragen Sie keinen dicken Schal; unternehmen Sie regelmäßig lange Spaziergänge, und gehen Sie von der Arbeit zu Fuß nach Hause; essen Sie viel Haferbrei.«
Empfehlungen zur Grippe-Vorbeugung in
der Zeitung News of the World, 1918
Prolog
Pazifischer Ozean, 1848
In all den Jahren, die er die Ozeane der Welt befuhr, hatte Kapitän Horatio Dobbs das Meer noch nie so öde und leer erlebt. Der Kapitän ging auf dem Achterdeck des New Bedforder Walfangschiffes Princess auf und ab. Seine grauen Augen blickten wie die Doppelstrahlen eines Leuchtturms in alle vier Himmelsrichtungen. Der Pazifik war eine scheibenförmige blaue Wüste. Keine Blasfahnen befiederten den Horizont. Keine grinsenden Delfine tanzten vor dem Schiffsbug. Kein fliegender Fisch stieg zappelnd über den Wellenkämmen hoch. Es war, als sei jedes Leben im Meer ausgestorben.
Dobbs war in der New Bedforder Walfängergilde eine herausragende Erscheinung. In den Hafenbars, in denen sich gewöhnlich scharfäugige Harpuniere trafen, oder in den Salons der reichen Schiffseigner der Quäkergemeinde auf dem Johnny Cake Hill erzählte man sich, Dobbs könne einen Pottwal auf fünfzig Meilen wittern. Doch seit einiger Zeit drang nur noch der üble Gestank einer schwelenden Meuterei in die Nase des Kapitäns.
Mittlerweile hatte Dobbs eine regelrechte Furcht davor entwickelt, jeden verlorenen Tag im Logbuch des Schiffes zu vermerken. Der Eintrag, den er am Vorabend in sein Logbuch geschrieben hatte, fasste die Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen musste, treffend zusammen.
Er hatte notiert:
27. März 1848. Frische Brise, SW. Nicht ein einziger Wal in Sicht. Das Pech liegt wie ein stinkender Nebel auf dieser Reise. Im gesamten Pazifik kein Tran für die arme Princess. Im Vorschiff braut sich schon was zusammen.
Vom erhöhten Achterdeck aus hatte Dobbs einen ungehinderten Blick auf die gesamte Länge des Schiffes, und er hätte blind sein müssen, um die verstohlenen Blicke und das Lauern in den Augen der Männer seiner Mannschaft nicht zu bemerken. Die Offiziere hatten voller Besorgnis gemeldet, dass das übliche Murren unter der Mannschaft im Vorschiff häufiger und vor allem heftiger geworden sei. Der Kapitän hatte seine Maate angewiesen, ihre Pistolen stets schussbereit zu halten und das Deck niemals unbewacht zu lassen. Noch hatte sich keine Hand zur Meuterei erhoben, aber im dunklen und stickigen Vorschiff, wo sich die Quartiere befanden und der Schiffsrumpf sich zum Bug verengte, hörte man Männer davon flüstern, dass sich das Glück des Schiffes gewiss wenden würde, wenn dem Kapitän ein Unfall zustieße.
Dobbs maß sechs Fuß und hatte ein Profil wie eine Felsenklippe. Er vertraute darauf, eine Meuterei wohl niederschlagen zu können. Doch das war die geringste seiner Sorgen. Ein Kapitän, der ohne eine profitable Ölladung in den Hafen zurückkehrte, beging die unverzeihliche Sünde, die Schiffseigner um ihre Investition zu bringen. Keine Mannschaft, die auch nur ein Körnchen Salz wert war, würde dann jemals wieder mit ihm fahren. Eine einzige Fahrt konnte über den Ruf, die Karriere und das persönliche Schicksal entscheiden.
Je länger ein Schiff auf See unterwegs war, desto größer war auch die Gefahr eines Misserfolgs. Der Proviant wurde knapp. Skorbut und Krankheiten drohten. Der Zustand des Schiffes verschlechterte sich, die Mannschaft verlor ihren Elan. Einen Hafen anzulaufen, um Reparaturen auszuführen und Nachschub aufzunehmen, barg ein Risiko: Männer konnten das Schiff verlassen, um auf einem anderen – erfolgreicheren – Walfänger anzuheuern.
Mit dem Walfangunternehmen war es bergab gegangen, seit das funkelnagelneue Schiff an einem sonnig frischen Herbsttag unter lautem Abschiedsjubel von dem Kai abgelegt hatte, auf dem es vor Menschen nur so gewimmelt hatte. Seitdem verfolgte Dobbs verwirrt, wie das Schiff vom Glück im Stich gelassen wurde. Dabei konnte kein Schiff für seine Jungfernfahrt besser vorbereitet sein. Die Princess hatte einen erfahrenen Kapitän, eine handverlesene Mannschaft und neue, sorgfältig geschmiedete rasiermesserscharfe Harpunen.
Die dreihundert Tonnen verdrängende Princess war auf einer der angesehensten Werften in New Bedford gebaut worden. Knapp über einhundert Fuß lang, wies das Schiff eine Breite von fast dreißig Fuß auf, was genügend Laderaum für dreitausend Fässer schuf, die an die neunzigtausend Gallonen Tran fassten. Es war aus massivem Eichenholz gebaut, das den schwersten Seen standzuhalten vermochte. Vier Walfangboote hingen in hölzernen Davits über der Decksreling. Andere Seefahrer favorisierten die dickbäuchigen Neu-England-Walfänger mit ihren kantigen Heckaufbauten, aber das robuste Schiff konnte jahrelang durch die widrigsten Verhältnisse segeln, die ihre schlankeren Mitbewerber schon bald an den Nähten leck geschlagen hätten.
Als die Princess das Dock verließ, füllte eine mächtige Brise die großen Rahsegel an den drei Masten. Der Steuermann wählte einen Kurs nach Osten über den Acushnet River und von dort in den Atlantischen Ozean hinein. Angetrieben von stetigen Winden hatte die Princess den Ozean dann schnell überquert und die Azoren erreicht. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Fayal, um Früchte zu laden, die vor Skorbut schützen sollten, hatte das Schiff Kurs auf die Südspitze Afrikas genommen und das Kap der Guten Hoffnung ohne Unfälle umrundet.
Doch in den darauf folgenden Wochen war die Princess in einem Zickzackkurs über den Pazifik gekreuzt und hatte nicht einen einzigen Wal gesichtet. Dobbs wusste, dass für die Suche und das erfolgreiche Aufspüren von Walen eher solide Kenntnisse der Wetterverhältnisse und des Wanderverhaltens der Tiere als reines Glück notwendig waren. Doch während sein Blick den fernen Horizont ringsum verzweifelt absuchte, begann er sich allmählich zu fragen, ob sein Schiff wohl doch vielleicht verflucht war. Er drängte diesen gefährlichen Gedanken jedoch wieder aus seinem Bewusstsein, schlenderte zum Schiffskoch hinüber, der gerade seinen Herd säuberte, und sagte: »Spiel uns was auf deiner Fiedel.«
In der Hoffnung, die allgemeine Moral ein wenig zu heben, hatte der Kapitän den Koch angewiesen, jeden Tag bei Sonnenuntergang zur Fiedel zu greifen. Aber diese fröhliche Musik schien die düstere Stimmung an Bord nur zu unterstreichen.
»Ich warte damit immer bis zum Sonnenuntergang«, sagte der Koch mürrisch.
»Nicht heute, Koch. Sieh zu, ob du uns einen Wal herbeifiedeln kannst.«
Der Koch legte seinen Putzlappen beiseite und wickelte widerstrebend das Tuch auseinander, das seine wettergegerbte Violine schützte. Er klemmte sich die Fiedel unters Kinn, ergriff den ausgefransten Bogen und sägte drauflos, ohne das Instrument vorher gestimmt zu haben. An ihren düsteren Blicken erkannte er, dass die Mannschaft glaubte, seine Fiedelei schrecke die Wale eher ab, und jedes Mal, wenn der Koch musizierte, fürchtete er aus gutem Grund, dass ihn gleich jemand über Bord werfen werde. Außerdem waren nur noch zwei Saiten übrig, und sein Repertoire schien ihm äußerst begrenzt, daher spielte er immer wieder die gleichen Melodien, die die Mannschaft ohnehin schon ein Dutzend Mal gehört hatte.
Während der Koch den Bogen tanzen ließ, befahl der Kapitän dem ersten Maat, die Aufsicht über das Achterdeck zu übernehmen. Er stieg den schmalen Gang zu seiner Kabine hinunter, warf den verwitterten schwarzen Zylinder auf seine Schlafpritsche und setzte sich an den Schreibtisch. Zwar studierte er noch einmal die Seekarten, doch hatte er sein Glück bereits in sämtlichen Walgründen versucht und nicht den geringsten Erfolg gehabt. Nun lehnte er sich in seinem Sessel zurück, schloss die Augen und ließ das Kinn auf die Brust sinken.
Er war erst für einige wenige Minuten eingedöst, als die wunderbaren Worte, die er seit Monaten nicht mehr gehört hatte, den Schleier seines Schlafs durchdrangen.
»Wal bläst!«, rief eine Stimme. »Da bläst er!«
Die Augen des Kapitäns sprangen auf, dann kam er wie ein Geschoss aus seinem Sessel hoch, schnappte sich seinen Hut und turnte die Leiter zum Deck hinauf. Er blickte gegen die grelle Sonne zur mittleren Mastspitze, die sich etwa einhundert Fuß hoch über dem Deck befand. Drei Mastspitzen wurden im Zwei-Stunden-Rhythmus besetzt, wobei die Ausgucker in eisernen Ringen auf kleinen Plattformen standen.
»Wie weit entfernt?«, rief der Kapitän dem Ausguck auf dem Hauptmast zu.
»Viertel Steuerbord, Sir.« Der Ausguck deutete vom Bug weg. »Dort. Er taucht gerade auf.«
Ein mächtiger hammerförmiger Schädel durchbrach die Meeresoberfläche in einer Viertelmeile Entfernung und schlug in einer aufwallenden Gischtwolke wieder auf. Ein Pottwal. Dobbs bellte dem Steuermann einen Befehl zu, Kurs auf den atmenden Wal zu nehmen. Mit der Behändigkeit von Affen verteilten sich Matrosen im Tauwerk und entfalteten jeden Quadratzoll Segeltuch.
Während das Schiff langsam herumkam, machte sich mit einem lauten Ruf auch ein zweiter Ausguck in seinem Krähennest bemerkbar.
»Ein zweiter, Kapitän!« Die Stimme des Ausgucks war heiser vor Erregung. »Bei Gott, noch einer!«
Dobbs blickte durch sein Fernglas auf eine glänzende graue Rückenwölbung, die gerade aus dem Meer auftauchte. Der Blas war kurz und buschig und bildete einen Winkel von fünfundvierzig Grad zur Wasseroberfläche. Der Kapitän schwenkte das Fernglas erst nach links und dann nach rechts. Noch mehr Wasserfontänen. Eine ganze Walherde. Er stieß einen lauten Freudenschrei aus. Was er da vor sich sah, war ein ziemlich großes Vermögen an Waltran.
Der Koch hatte beim ersten Sichten aufgehört zu spielen. Nun stand er wie benommen auf dem Deck, die Fiedel in der Hand. Schlaff hing sie an seiner Seite herab.
»Du hast es geschafft, Koch!«, rief der Kapitän. »Du hast genug Walrat herbeigefiedelt, um unsere Lagerräume unter Deck zu füllen. Spiel weiter, verdammt noch mal!«
Der Koch zeigte dem Kapitän in einem breiten Grinsen seine Zahnlücken, zog den Bogen über die Violinsaiten und intonierte ein fröhliches Seemannslied, während der Steuermann das Schiff in den Wind drehte. Die Segel wurden getrimmt. Das Schiff stieg leicht hoch und stoppte.
»Fiert die Boote an Backbord weg!«, brüllte der Kapitän mit einer unbändigen Begeisterung, die sich während der langen Wal-Dürre aufgestaut hatte. »Bewegt euch, Männer, wenn ihr Geld sehen wollt!«
Dobbs befahl, drei Boote zu Wasser zu lassen. Jedes der dreißig Fuß langen Walboote stand unter dem Kommando eines Maats, der sowohl befehlshabender Offizier als auch Steuermann war. Eine Notbesatzung blieb auf der Princess zurück, um notfalls mit dem Schiff zu manövrieren. Der Kapitän behielt das vierte Walboot in Reserve.
Der gesamte Vorgang des Ausbringens der Boote dauerte kaum länger als eine Minute. Die schlanken Boote klatschten fast gleichzeitig ins Meer. Die Bootsbesatzungen kletterten am Schiffsrumpf hinab, nahmen ihre Plätze auf den Bänken ein und tauchten die Ruder ins Wasser. Sobald sich jedes Walboot weit genug vom Schiff entfernt hatte, zog seine Besatzung ein Segel auf, um ein paar weitere Knoten an Geschwindigkeit zu gewinnen.
Dobbs beobachtete, wie die Boote, einer Salve von Pfeilen nicht unähnlich, ihren Zielen entgegenflogen.
»Immer sachte, Jungs«, murmelte er. »Zieht einen Takt schneller, haltet den Kurs.«
»Wie viele, Käpt’n?«, rief der Koch.
»Mehr als genug, um für jeden Mann an Bord ein Zehn-Pfund-Steak zu braten. Du kannst das Salzfleisch über Bord werfen«, brüllte Dobbs.
Das Gelächter des Kapitäns rollte wie ein Orkan über das Deck.
Caleb Nye ruderte im führenden Boot auf Teufel komm raus. Seine Handflächen waren aufgesprungen und bluteten, seine Schultern schmerzten. Schweiß rann über seine Stirn, doch er wagte es nicht, eine Hand von seinem Riemen zu lösen, um sich die Augen zu wischen.
Caleb war achtzehn Jahre alt, ein drahtiger, gutmütiger Bauernjunge aus Concord, Massachusetts, auf seiner ersten Seefahrt. Mit seinem 1/210-Anteil, auch lay genannt, rangierte er am untersten Ende der Lohnskala. Er wusste, dass er von Glück reden konnte, wenn er gerade noch einen Gewinn machte, aber er hätte ohnehin angeheuert, angelockt durch die Aussicht auf Abenteuer und den Reiz exotischer Länder.
Der diensteifrige Bursche erinnerte den Kapitän an seine erste eigene Walfangfahrt. Dobbs erklärte dem Bauernjungen, dass er seinen Weg sicher gehen würde, wenn er seine Befehle schnell ausführte und hart arbeitete. Seine Bereitschaft, jede Aufgabe auszuführen und jeden Spott an sich abperlen zu lassen, hatte ihm den Respekt der harten Waljäger eingebracht, die ihn mittlerweile wie ein lieb gewordenes Maskottchen behandelten.
Das Boot stand unter dem Kommando des Ersten Maats, eines narbenübersäten Veteranen vieler Walfangexpeditionen. Ruderer wurden stets daran erinnert, genauestens auf den Maat und seine Befehle zu achten, aber Caleb, als Grünschnabel des Schiffes, musste die Hauptlast der ständigen Tiraden des Offiziers ertragen.
»Komm, beweg dich, Caleb«, rief der Maat. »Spann den Rücken, Bursche, du ziehst doch nicht an einem Kuhschwanz. Und guck immer schön auf meine liebliche Visage – ich such dir auch eine schöne Meerjungfrau.«
Der Maat, der als Einziger nach vorne blicken durfte, beobachtete einen massigen Walbullen, der sich auf Kollisionskurs mit dem Boot befand. Sonnenstrahlen brachen sich auf der glänzenden schwarzen Haut. Der Maat gab dem Harpunier einen leisen Befehl.
»Steh auf und halte dich bereit.«
Zwei sieben Fuß lange Harpunen lagen in entsprechenden Mulden am Bug bereit. Ihre rasiermesserscharfen Widerhaken waren so konstruiert, dass sie den Schaft beim Eindringen in die Jagdbeute in eine leichte Drehung versetzen konnten. Diese tödliche Vorrichtung machte es fast unmöglich, dass sich die Harpune löste, sobald sie im Walfleisch steckte.
Der Bugmann erhob sich und zog den Riemen ein, dann nahm er die Harpune aus der Mulde. Er zog die Hülle ab, die die Spitze mit dem Widerhaken schützte. Das Gleiche machte er dann auch mit der zweiten Harpune.
Achtzehnhundert Fuß Leine waren sorgfältig in einer Kiste aufgeschossen, liefen durch einen V-förmigen Einschnitt am Bug und waren mit der Harpune verknotet. Von der Harpune verlief die Schnur über die gesamte Länge des Bootes bis zum Heck, wo sie zweimal um einen kurzen Pfosten, Loggerhead genannt, geschlungen war, dann verlief sie weiter nach vorne bis zu einer Wanne.
Der Maat zog die Pinne herum, richtete den Bug des Bootes auf die linke Flanke des Wals aus und brachte so den rechtshändigen Harpunier in die Position, seine Waffe zu benutzen. Als der Wal nur noch etwa zwanzig Fuß vom Boot entfernt war, rief der Maat dem Harpunier einen Befehl zu.
»Gib’s ihm!«
Indem er sich mit dem Knie im Boot abstützte, schleuderte der Harpunier die Lanze wie einen Speer, und die Spitze drang einen Zoll hinter dem Auge des Wals in seine Haut ein. Dann ergriff er sofort die zweite Harpune und platzierte sie etwa einen Fuß weit hinter der ersten.
»Fier weg!«, rief der Maat.
Die Riemen tauchten ins Wasser, das Boot schoss mehrere Yards zurück.
Der Wal stieß Dampf aus dem Blasloch aus, hob die großen Fluken hoch in die Luft und schlug damit wuchtig dort aufs Wasser, wo sich das Boot noch Sekunden zuvor befunden hatte. Der Wal reckte den Schwanz ein zweites Mal in die Luft, grub den Schädel ins Meer und tauchte. Ein tauchender Pottwal kann mit einer Geschwindigkeit von fünfundzwanzig Knoten bis auf tausend Fuß absinken. Die Leine lief mit rasendem Tempo aus der Wanne aus. Der Mann an der Wanne spritzte Meerwasser auf die Leine, um sie zu kühlen, doch trotz seiner Bemühungen begann sie bereits von der Reibung, während sie um den Loggerhead raste, zu qualmen.
Das Boot jagte nun in einem wilden Tanz, der von Walfängern nur Nantucketer Schlittenfahrt genannt wurde, über die Wellenkämme. Die Ruderer stießen zwar laute Jubelrufe aus, doch sie spannten sich an, als das Boot zur Ruhe kam und sich nicht weiter bewegte. Der Wal war dabei aufzutauchen. Dann durchbrach das gigantische Säugetier, begleitet von einer regelrechten Gischtexplosion, die Wasseroberfläche und warf sich wie eine Forelle an einer Angelschnur herum, um abermals in die Tiefe hinunterzusteigen und nach zwanzig Minuten erneut aufzutauchen. Dieser Vorgang wiederholte sich immer wieder. Und jedes Mal wurde mehr Leine eingeholt und die Entfernung verkürzt, bis Wal und Boot nur noch durch ungefähr einhundert Fuß Abstand voneinander getrennt wurden.
Der große stumpfe Kopf schwang zu seinem Quälgeist herum. Der Maat verfolgte dieses aggressive Verhalten und wusste, dass es die Vorbereitung eines Angriffs war. Er gab dem Harpunier brüllend zu verstehen, er solle nach achtern kommen. Die beiden Männer tauschten in dem schaukelnden Boot die Plätze, stolperten über Riemen, Ruderer und Leinen und boten damit einen Anblick, der spaßig hätte sein können, wären da nicht die möglicherweise tödlichen Folgen gewesen.
Der Maat packte die Lanze, einen langen Holzschaft mit einer scharfkantigen, löffelförmigen Spitze, und baute sich im Bug wie ein Matador auf, der sich bereit macht, den Kampfstier zu töten. Der Maat rechnete damit, dass sich das Tier auf die Seite wälzte, ein Manöver, das dem Wal erlauben würde, die scharfen Zähne, die seinen schlauchartigen Unterkiefer säumten, höchst wirkungsvoll zu benutzen.
Der Harpunier schwang die Ruderpinne herum. Wal und Boot passierten einander mit wenigen Yards Abstand. Der Wal begann herumzurollen und entblößte seine verletzliche Körperseite. Der Maat stieß die Lanze mit aller Kraft in den Wal. Er drückte auf den Schaft, zerrte ihn hin und her, bis die Spitze sechs Fuß tief im Fleisch des Tieres steckte und sein Herz durchbohrt hatte. Er brüllte der Mannschaft zu, sie solle auf entgegengesetzten Kurs gehen. Zu spät. In seinem Todeskampf nahm der Wal den mittleren Abschnitt des träge reagierenden Bootes zwischen seine Kiefer.
Die Ruderer stolperten in panischer Angst übereinander, während sie den scharfen Zähnen zu entgehen versuchten. Der Wal schüttelte das Boot wie ein Hund einen Knochen, dann klappten seine Kiefer auf, das Säugetier entfernte sich, und der große Schwanz schlug aufs Wasser. Eine Fontäne aus blutgetränktem Wasserdampf drang aus dem Blasloch.
»Feuer im Loch!«, rief ein Ruderer.
Die Lanze hatte bereits ihr tödliches Werk vollbracht. Der Wal zuckte noch eine Minute lang, ehe er untertauchte und eine rote Pfütze Blut zurückließ.
Die Ruderer legten ihre Riemen über die Dollborde, um das sinkende Boot zu stabilisieren, dann verstopften sie die Lecks mit ihren Hemden. Trotz ihrer Bemühungen befand sich das Boot kaum noch in einem schwimmfähigen Zustand, als der tote Wal auftauchte und sich mit einer Finne in der Luft auf die Seite rollte.
»Gute Arbeit, Leute!«, brüllte der Maat. »Den hat’s erwischt. Noch so ein Fisch, und wir segeln zurück nach New Bedford, um unseren Liebsten was Schönes zu kaufen.« Er deutete auf die herannahende Princess. »Seht mal, Jungs, der alte Mann kommt, um uns aufzufischen und euch ins Bettchen zu legen. Wie ich sehe, sind alle okay.«
»Nicht alle«, meldete sich der Harpunier mit heiserer Stimme. »Caleb ist verschwunden.«
Das Schiff ging in kurzer Entfernung vor Anker, und ein Reserveboot wurde zu Wasser gelassen. Nach einer erfolglosen Suche nach Caleb im blutigen Wasser wurde der erlegte Wal mit einer Fahne markiert und das beschädigte Walboot zum Schiff zurückgeschleppt.
»Wo ist der Grünschnabel?«, fragte der Kapitän, als die durchnässte und schmutzige Mannschaft an Bord der Princess kletterte.
Der erste Maat antwortete: »Der arme Kerl ging über Bord, als der Wal angriff.«
Die Augen des Kapitäns waren von Traurigkeit überschattet, aber Tod und Waljagd waren einander eben nicht fremd. Er wandte seine Aufmerksamkeit der unmittelbar anstehenden Aufgabe zu und befahl seinen Männern, den Walkadaver unter ein Gerüst auf der Steuerbordseite zu manövrieren. Mit Hilfe langer Haken rollten sie den Kadaver herum und hievten ihn in eine aufrechte Haltung hoch. Sie schnitten den Kopf ab und benutzten, ehe sie begannen, den Blubber abzuschneiden, einen eisernen Haken, um die Innereien herauszureißen. Sie hievten sie auf das Deck und durchsuchten sie nach Ambra, dem wertvollen Grundstoff für Parfüm, der im Magen eines kranken Wals entstehen kann.
Irgendetwas bewegte sich in dem großen Magensack. Ein Matrose vermutete einen riesigen Tintenfisch, eine beliebte Beute von Pottwalen. Mit einem scharfkantigen Spaten schnitt er den Sack auf, aber statt Tentakeln rutschte ein menschliches Bein aus der Öffnung heraus. Er schlug die Magenwände zurück und befreite so jemanden, der sich in fetaler Haltung zusammengerollt hatte. Der Mann mit dem Spatenmesser und ein anderer Matrose ergriffen die Füße des Mannes und zerrten seine schlaffe Gestalt auf das Deck. Eine milchige schleimige Substanz umhüllte den Kopf des Mannes. Der erste Maat kam herüber und wusch den Schleim mit einem Eimer Wasser ab.
»Es ist Caleb!«, rief der Maat. »Es ist unser Grünschnabel!«
Calebs Lippen bewegten sich zwar, aber kein Laut drang aus seinem Mund.
Dobbs hatte das Abschneiden des Blubbers vom Walskelett beaufsichtigt. Er kam herüber und betrachtete Caleb einige Sekunden lang, ehe er den Matrosen befahl, den Grünschnabel in seine Kabine zu tragen. Sie legten den jungen Mann auf die Pritsche des Kapitäns, zogen ihm seine ebenfalls mit Schleim verklebten Kleider aus und wickelten ihn in Decken ein.
»Lieber Gott, so etwas habe ich noch nie gesehen«, murmelte der Erste Maat.
Der hübsche achtzehnjährige Bauernjunge hatte sich in einen verschrumpelten alten Mann von achtzig Jahren verwandelt. Seine Haut war geisterhaft bleich. Ein Netz von Runzeln überzog die Haut seiner Hände und seines Gesichts, als hätte sie tagelang im Wasser gelegen. Sein Haar ähnelte den Strähnen einer Baumwollpflanze.
Dobbs legte eine Hand auf Calebs Arm und erwartete, dass er genauso eiskalt war wie der gesamte leichenähnliche Körper.
»Er ist glühend heiß«, murmelte er verblüfft.
Da er auch als Schiffsarzt fungierte, deckte Dobbs Calebs Körper mit nassen Handtüchern zu, um das Fieber zu senken. Aus einer schwarzledernen Arzttasche holte er ein Fläschchen mit einer starken Medizin hervor, die eine hohe Dosis an Opium enthielt, und schaffte es, ein paar Tropfen in Calebs Mund zu träufeln. Der junge Mann wälzte sich einige Minuten lang unruhig herum, ehe er in einen tiefen Schlaf fiel. In diesem Zustand blieb er für mehr als vierundzwanzig Stunden. Als Calebs Augenlider irgendwann zu flattern begannen und sich schließlich ganz öffneten, sah der Gerettete den Kapitän an seinem Schreibtisch sitzen, wo er etwas in sein Logbuch schrieb.
»Wo bin ich?«, murmelte er mit trockenen, verkrusteten Lippen.
»In meiner Koje«, knurrte Dobbs. »Und mir wird verdammt schlecht davon.«
»Tut mir leid, Sir.« Caleb runzelte die Stirn. »Ich habe geträumt, ich wäre gestorben und in die Hölle gefahren.«
»So viel Glück hast du nicht gehabt, mein Junge, es scheint eher, als hätte der Wal einen besonderen Appetit auf Bauernjungen gehabt. Wir haben dich aus seinem Bauch geholt.«
Caleb erinnerte sich an das runde Auge des Wals, dann in die Luft geschleudert worden zu sein, wobei er wild mit den Armen und Beinen gerudert hatte, und schließlich an den eisigen Schock, als er ins Wasser tauchte. Er konnte sich auch entsinnen, durch einen dunklen, engen Gang gerutscht zu sein und in der stickigen, feuchten Luft würgend nach Atem gerungen zu haben. Die Hitze war nahezu unerträglich gewesen. Schnell hatte er das Bewusstsein verloren.
Ein Ausdruck des Grauens verzerrte sein bleiches, runzliges Gesicht. »Der Wal hat mich gefressen!«
Der Kapitän nickte. »Ich sage dem Koch, dass er dir etwas Suppe holt. Dann heißt es für dich aber wieder: zurück ins Vorschiff.«
Der Kapitän lenkte jedoch mitleidig ein und ließ Caleb in seiner Kabine liegen, bis der Blubber zu Tran gekocht und in Fässer gefüllt worden war. Anschließend ließ er die Matrosen aus dem Vorschiff an Deck antreten. Er lobte sie für ihre harte Arbeit und fuhr fort:
»Ihr alle wisst, dass der Wal den Grünschnabel verschluckt hat wie weiland Jonas in der Bibel. Ich kann euch zum Glück verkünden, dass unser junger Freund schon bald wieder seine Arbeit aufnehmen kann. Ich ziehe ihm die verlorene Zeit eher von seinem Lohn ab. Nur ein Toter darf sich auf diesem Schiff vor seiner Arbeit drücken.«
Diese Bemerkung rief bei den versammelten Matrosen beifällige Bemerkungen und ein zufriedenes Grinsen hervor.
Dobbs war noch nicht fertig. »Ich muss euch allerdings sagen, dass Caleb ein wenig anders aussieht, als ihr ihn in Erinnerung habt. Die fauligen Säfte im Bauch des Wals haben ihn weißer gebleicht als eine gekochte Steckrübe.« Er musterte die Mannschaft mit ernstem Blick. »Ich lasse es nicht zu, dass sich irgendjemand auf diesem Schiff über das Missgeschick eines Gefährten lustig macht. Das wäre erstmal alles.«
Die Schiffsoffiziere halfen Caleb, an Deck zu steigen. Der Kapitän bat Caleb, einen Zipfel von dem Tuch zurückzuschlagen, das sein Gesicht wie eine Mönchskapuze bedeckte. Die Mannschaft reagierte mit einem vielstimmigen erschrockenen Seufzen.
»Seht euch unseren Jonas gut an, und ihr habt etwas, das ihr noch euren Enkelkindern erzählen könnt«, sagte der Kapitän. »Unter seiner weißen Haut ist er aber keinen Deut anders als wir alle. Und jetzt lasst uns noch ein paar Wale jagen.«
Der Kapitän hatte Caleb mit voller Absicht Jonas genannt. Dies war der Name für einen Matrosen, der das Unglück anlockte. Indem er damit scherzte, hoffte er, jeden abfälligen Vergleich mit der gleichnamigen Bibelgestalt, die von einem großen Fisch verschlungen worden war, zu vermeiden. Ein paar Matrosen empfahlen murmelnd, Caleb über Bord zu werfen. Glücklicherweise waren aber alle für einen derartigen Unfug zu beschäftigt. Das Meer, das lange so öde gewesen war, wimmelte nun von Walen. Zweifellos hatte das Schicksal des Schiffes sich zum Guten gewendet. Es schien geradezu, als sei die Princess zu einem Magneten für jeden Wal im Ozean geworden.
Jeden Tag wurden die Boote nach lauten Rufen von den Ausgucken zu Wasser gelassen. Die eisernen Siedetöpfe blubberten wie Hexenkessel. Eine ölige Wolke schwarzen Qualms verdeckte die Sterne und die Sonne und färbte die Segel dunkelgrau. Der Koch sägte fröhlich auf seiner Fiedel. Wenige Monate nach Calebs Begegnung mit dem Wal waren die Laderäume des Schiffes bis zum Rand gefüllt.
Vor der langen Heimreise musste das Schiff erst neuen Proviant aufnehmen, und die erschöpfte Mannschaft brauchte einen Landurlaub. Dobbs lief Pohnpei an, eine idyllische Insel, die für ihre gut aussehenden Männer, ihre schönen Frauen und ihre Bereitschaft, Walfänger mit allen Gütern und Annehmlichkeiten zu versorgen, nach denen ihnen der Sinn stand, berühmt war. Walfangschiffe aus jedem Winkel der Erde drängten sich im Hafen.
Dobbs war als Quäker aufgewachsen und hatte für Alkohol und eingeborene Frauen wenig übrig. Jedoch betrachtete er seine Glaubensregeln als zweitrangig gegenüber seinen Pflichten als Seemann, die besagten, unter seinen Männern Frieden und Harmonie zu erhalten und mit einer Schiffsladung Tran heimzukehren. Wie er diese Aufgaben löste, blieb ihm überlassen. Er verfolgte mit herzlichem Lachen, wenn Bootsladungen betrunkener und lärmender Matrosen an Bord kletterten und über das Schiff stolperten oder aus dem Wasser gefischt wurden, mit dem sie, weil sie zu berauscht waren, hatten Bekanntschaft machen müssen.
Caleb blieb an Bord und verfolgte das Kommen und Gehen seiner Gefährten mit einem milden Lächeln. Der Kapitän war erleichtert, dass Caleb kein Interesse zeigte, an Land zu gehen. Die Eingeborenen galten als freundlich und umgänglich, doch Calebs seltsam strähniges Haar und seine gebleichte Haut hätten Probleme mit den abergläubischen Inselbewohnern auslösen können.
Dobbs stattete dem amerikanischen Konsul, einem Neu-Engländer wie er selbst, einen Höflichkeitsbesuch ab. Während des Besuchs erhielt der Konsul die Nachricht, dass auf der Insel eine Tropenkrankheit ausgebrochen sei. Daraufhin strich Dobbs seinen Männern den Landurlaub. In sein Logbuch trug er ein:
Letzter Tag des Landurlaubs. Kapitän besucht US-Konsul A. Markham, der zu einer Besichtigung der altertümlichen Stadt Nan Madol einlud. Nach Rückkehr erhielt Konsul Meldung von einer Seuche auf der Insel. Habe Urlaub gestrichen und eilig die Insel verlassen.
Die restlichen Angehörigen der Mannschaft taumelten zurück an Bord und fielen sofort in einen rumseligen Schlaf. Den ausgenüchterten Matrosen gab der Kapitän den Befehl, den Anker zu lichten und die Segel zu setzen. Als die rotäugigen Männer aus ihren Kojen gescheucht wurden und auf ihre Posten zurückkehrten, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen, befand sich das Schiff bereits auf hoher See. Bei stetigem Wind würden Dobbs und seine Männer schon in wenigen Monaten wieder in ihren eigenen Betten schlafen.
Weniger als vierundzwanzig Stunden nach Verlassen des Hafens brach auf der Princess jedoch die Krankheit aus.
Ein Vorschiffmatrose namens Stokes wachte gegen zwei Uhr morgens auf und rannte zur Reling, um sich zu übergeben. Mehrere Stunden später bekam er Fieber, und auf seinem Körper bildete sich ein rötlicher Ausschlag. Braunrote Flecken erschienen in seinem Gesicht und wurden ständig größer, bis er wie aus Mahagoni geschnitzt aussah.
Der Kapitän behandelte Stokes mit nassen Tüchern und regelmäßigen Schlucken aus einer seiner Medizinflaschen. Dobbs ließ ihn auf das Vordeck schaffen und in ein behelfsmäßiges Zelt legen. Das Vorschiff war auch unter günstigen Bedingungen ein wahres Pestloch. Frische Luft und Sonnenschein würden die Leiden des Mannes wahrscheinlich lindern, und ihn zu isolieren würde eine Ausbreitung der Krankheit möglicherweise verhindern.
Doch die Krankheit breitete sich unter den Fockmastmatrosen wie ein windgepeitschtes Buschfeuer aus. Männer brachen auf Deck zusammen. Ein Takler stürzte von einer Rah auf einen Haufen Segel, der seinen Aufprall glücklicherweise dämpfte. Eine behelfsmäßige Krankenstation wurde auf dem Vordeck eingerichtet. Der Kapitän leerte seinen Medizinkoffer. Er befürchtete, dass es nur noch eine Frage von Stunden war, bis auch er und seine Offiziere erkrankten. Die Princess würde zu einem Geisterschiff, so lange der Willkür des Windes und der Wellen ausgesetzt, bis es verfaulte.
Der Kapitän zog seine Seekarten zu Rate. Das nächste Festland hieß Trouble Island. Normalerweise mieden Walfänger diesen Ort. Nach einem Streit über ein Fass Nägel hatte eine Walfängermannschaft ein Dorf niedergebrannt und einige Eingeborene getötet. Seitdem hatten die Bewohner der Insel mehrere Walfangschiffe überfallen. Aber er hatte keine Wahl. Dobbs übernahm das Steuer und brachte das Schiff auf direkten Kurs zu der Insel.
Schon bald schleppte sich die Princess in eine Bucht, die von weißen Sandstränden gesäumt wurde, und der Anker rauschte unter lautem Kettenklirren ins glasklare grüne Wasser. Die Insel wurde von einem Vulkankegel beherrscht. Rauchwolken stiegen aus dem Krater auf. Dobbs und der Erste Maat ruderten mit einem kleinen Boot an Land, um den Trinkwasservorrat aufzufüllen – zumindest so gut es ging. Ein kleines Stück landeinwärts fanden sie eine Quelle und befanden sich bereits wieder auf dem Rückweg, als sie auf eine Tempelruine stießen. Der Kapitän betrachtete die mit Schlingpflanzen überwucherten Tempelmauern und meinte: »Dieser Ort erinnert mich an Nan Madol.«
»Was meinen Sie, Sir?«, fragte der Erste Maat.
Der Kapitän schüttelte den Kopf. »Vergessen Sie’s. Wir sollten lieber zum Schiff zurückkehren, solange wir noch laufen können.«
Nicht lange nach Anbruch der Nacht erkrankten die Maate, und auch Dobbs wurde von der Krankheit ereilt. Mit Calebs Hilfe schleppte der Kapitän seine Matratze auf das Achterdeck. Er wies den Grünschnabel an, sich um das Wohl des Schiffes zu kümmern, so gut es eben ging.
Aus irgendeinem Grund wurde Caleb von der Krankheit verschont. Eimerweise schleppte er Wasser auf das Vordeck, um den quälenden Durst seiner Mannschaftskameraden zu stillen, und versorgte Dobbs und die Offiziere. Dobbs schwankte zwischen Schüttelfrost und Fieberschüben. Er verlor das Bewusstsein und sah, als er wieder aufwachte, Fackeln über das Deck wandern. Eine Fackel kam näher, und ihre zuckende Flamme beleuchtete das grässlich tätowierte Gesicht eines Mannes, der zu einem guten Dutzend Eingeborener gehörte, die mit Speeren und Schneidwerkzeugen zur Blubberverarbeitung bewaffnet waren.
»Hallo?«, sagte der Inselbewohner. Er hatte ausgeprägte Wangenknochen und langes schwarzes Haar.
»Du sprichst Englisch?«, brachte Dobbs mühsam hervor.
Der Mann hob den Speer. »Gute Harpune, Mann.«
In Dobbs regte sich Hoffnung. Trotz seines wilden Aussehens war der Eingeborene offensichtlich ebenfalls ein Walfänger. »Meine Männer sind krank. Kannst du uns helfen?«
»Klar«, sagte der Eingeborene. »Wir haben gute Medizin. Machen euch gesund. Du aus New Bedford?«
Dobbs nickte.
»Schade«, sagte der Eingeborene. »Männer aus New Bedford haben mich mitgenommen. Bin vom Schiff geflüchtet. Nach Hause zurückgekommen.« Er lächelte und zeigte dabei spitz gefeilte Zähne. »Keine Medizin. Wir sehen zu, wie Feuer von Krankheit euch verbrennt.«
Eine ruhige Stimme fragte: »Geht es Ihnen gut, Käpt’n?«
Caleb war aus dem Dunkel aufgetaucht und stand nun im Schein der Fackel auf dem Deck.
Der Anführer der Eingeborenen bekam große Augen und stieß ein einzelnes Wort hervor.
»Atua!«
Der Kapitän hatte genügend ozeanische Brocken aufgeschnappt und wusste, dass atua das Wort der Inselbewohner für böser Geist war. Während er sich auf die Ellbogen stützte und sich halb aufrichtete, sagte Dobbs: »Ja. Das ist mein atua. Tu, was er sagt, oder er wird dich und all deine Gefährten auf der Insel verfluchen.«
Caleb schätzte die Lage sofort richtig ein und spielte bei dem Bluff des Kapitäns mit.
Er hob die Arme zu einer dramatischen Geste und befahl: »Legt eure Waffen nieder, oder ich werde meine Macht benutzen.«
Der Anführer der Eingeborenen sagte etwas in seiner Sprache, und die anderen Männer ließen ihre Mordwerkzeuge auf die Decksplanken fallen.
»Ihr sagtet, ihr könnt etwas gegen die Feuerkrankheit tun«, erklärte der Kapitän. »Ihr habt Medizin. Helft meinen Männern, oder der atua wird zornig.«
Der Inselbewohner schien unsicher zu sein, was er tun sollte, doch seine Zweifel verflogen, als Caleb seinen Hut abnahm und sein seidiges weißes Haar in der warmen Brise flatterte. Der Inselbewohner gab den anderen einen knappen Befehl.
Wieder wurde der Kapitän ohnmächtig. Sein Schlaf war mit unheimlichen Träumen erfüllt, darunter auch einer, in dem er etwas Kaltes, Nasses und einen Stich in seiner Brust spürte. Als er die Augen wieder aufschlug, war es taghell, Matrosen gingen auf dem Deck umher. Die Segel des Schiffes standen in voller Pracht vor dem klaren blauen Himmel, Wellen schlugen gegen den Schiffsrumpf. Weiß gefiederte Vögel zogen darüber ihre Kreise.
Der Erste Maat beobachtete, wie Dobbs Mühe hatte, sich aufzurichten, und kam mit einem Krug Wasser zu ihm. »Geht es Ihnen besser, Käpt’n?«
»Aye«, krächzte Dobbs zwischen zwei Schlucken Wasser. Das Fieber war abgeklungen, und sein Magen fühlte sich abgesehen von nagendem Hunger wieder halbwegs normal an. »Helfen Sie mir mal auf die Füße.«
Schließlich stand der Kapitän auf wackligen Beinen und stützte sich auf den Arm des Maats. Das Schiff befand sich auf dem offenen Meer, und weit und breit war keine Insel zu sehen.
»Wie lange sind wir schon unterwegs?«
»Fünf Stunden«, antwortete der Maat. »Es ist ein Wunder. Die Männer haben kein Fieber mehr. Der Ausschlag ist verschwunden. Der Koch hat Suppe zubereitet, und sie haben das Schiff in Fahrt gebracht.«
Der Kapitän spürte ein Jucken auf der Brust und zog sein Hemd hoch. Der Ausschlag hatte sich zurückgebildet und wurde durch einen kleinen roten Punkt und durch einen kleinen roten Kreis ein paar Zoll über seinem Bauchnabel ersetzt.
»Was ist mit den Eingeborenen?«, wollte Dobbs wissen.
»Eingeborene? Wir haben keine Eingeborenen gesehen.«
Dobbs schüttelte den Kopf. Hatte er all das in seinem Fieberwahn nur geträumt? Er bat den Maat, Caleb zu holen. Der Grünschnabel kam aufs Achterdeck. Er trug einen Strohhut, um seine bleiche Haut vor der Sonne zu schützen. Ein Lächeln huschte über sein fahles, runzliges Gesicht, als er sah, dass sich der Kapitän erholt hatte.
»Was ist vergangene Nacht passiert?«, fragte Dobbs.
Caleb berichtete dem Kapitän, dass kurz nachdem Dobbs das Bewusstsein verloren hatte, die Eingeborenen das Schiff verlassen hätten und mit Holzeimern zurückgekehrt seien, von denen ein mattes bläuliches Leuchten ausging. Die Eingeborenen gingen von Mann zu Mann. Er hatte nicht erkennen können, was sie taten. Dann hätten sie das Schiff wieder verlassen. Kurz darauf war die Mannschaft nach und nach aufgewacht. Der Kapitän bat Caleb, ihn nach unten in seine Kabine zu bringen. Er ließ sich in seinen Sessel sinken und schlug das Logbuch auf.
»Eine seltsame Geschichte«, begann der Kapitän. Obwohl seine Hände zitterten, schrieb er jede Einzelheit auf, so wie er sie in Erinnerung hatte. Dann warf er einen sehnsüchtigen Blick auf ein kleines Porträt seiner hübschen jungen Ehefrau und beendete den Eintrag mit dem knappen Hinweis: »Wir kehren heim!«
Fairhaven, Massachusetts, 1878
Das Herrenhaus mit dem charakteristischen französischen Mansardendach, das von den Stadtbewohnern Ghost House genannt wurde, stand in einer abgeschiedenen Straße ein wenig zurückgesetzt hinter einem Schutzwall dunkel belaubter Buchen. Die lange Auffahrt wurde von den gebleichten Kieferknochen eines Pottwals bewacht. Sie waren aufrecht in den Erdboden gerammt, so dass ihre sich verjüngenden Enden in einem gotischen Spitzbogen aufeinandertrafen.
An einem goldenen Oktobertag standen zwei Jungen unter dem Bogen aus Walknochen und forderten sich gegenseitig heraus, die Auffahrt hinaufzuschleichen und einen Blick durch die Fenster des Hauses zu werfen. Keiner der beiden wollte den ersten Schritt tun, und sie tauschten noch immer Sticheleien aus, als sich ein glänzend schwarzer Einspänner rasselnd dem Tor näherte.
Der Kutscher war ein massiger Mann, dessen teurem rostbraunem Anzug und Derbyhut es nicht gelang, sein gaunerhaftes Aussehen zu kaschieren. Das kantige Gesicht war von den Knöcheln der Gegner geformt worden, gegen die er in seiner Preisboxerzeit angetreten war. Das Alter war mit der missgestalteten Nase, den Blumenkohlohren und den mit Narbengewebe fast vollständig zugewucherten Augen nicht sehr freundlich umgegangen.
Der Mann beugte sich vom Kutschbock herab und funkelte die Jungen drohend an. »Was führt ihr Früchtchen hier im Schilde«, knurrte er und machte so seiner Ähnlichkeit mit einem Kampfhund alle Ehre. »Nichts Gutes, nehme ich an.«
»Nichts«, brachte einer der Jungen mit gesenktem Blick hervor.
»Tatsächlich?«, fragte er spöttisch. »Nun, ich würde mich an eurer Stelle lieber nicht hier herumtreiben. In diesem Haus lebt nämlich ein alter böser Geist.«
»Siehst du!« Der andere Junge sah seinen Freund herausfordernd an »Ich hab’s dir doch gesagt.«
»Hör auf deinen Freund. Der Geist ist sieben Fuß groß. Er hat Hände wie Mistgabeln«, berichtete der Mann und verlieh seiner Stimme ein dramatisches Zittern. »Er hat Fangzähne, mit denen er Jungen wie euch aufreißen kann, um euch die Eingeweide auszusaugen.« Er deutete mit seiner Peitsche zum Haus und riss vor Entsetzen den Mund weit auf. »Er kommt! Bei Gott, da kommt er auf uns zu! Rennt los. Rennt um euer Leben!«
Der Mann brach in ein brüllendes Gelächter aus, während die Jungen wie aufgescheuchte Kaninchen davongaloppierten. Er zog kurz an den Zügeln und lenkte das Pferd durch das Walknochentor. Dann band er es vor dem großen Haus an, das einem achteckigen Hochzeitskuchen mit roter und gelber Glasur glich. Er kicherte noch immer vor sich hin, während er die Eingangsstufen hinaufstieg und auf seine Ankunft aufmerksam machte, indem er den Türklopfer aus Messing betätigte, der wie der Schwanz eines Wals geformt war.
Schritte näherten sich. Ein Mann öffnete die Tür, und ein Lächeln huschte über sein bleiches Gesicht.
»Strater, was für eine nette Überraschung«, sagte Caleb Nye.
»Es tut gut, dich zu sehen, Caleb. Hatte längst vor, mal vorbeizuschauen, aber du weißt ja, wie es ist.«
»Natürlich«, sagte Caleb und trat beiseite. »Komm nur herein.«
Calebs Haut war im Laufe der Jahre noch weißer geworden. Das Alter hatte seiner Haut, die wie Pergament aussah, weitere Runzeln und Falten hinzugefügt. Aber trotz seines frühzeitigen Alterns legte er immer noch dieses jungenhafte Lächeln und den ungestümen Eifer, womit er sich bei seinen Walfanggefährten so beliebt gemacht hatte, an den Tag.
Er ging in eine geräumige Bibliothek voraus, deren Wände aus deckenhohen Bücherschränken bestanden. Die Wände, die nicht für Regale mit Büchern über den Walfang reserviert waren, wurden von großen, farbenfrohen Plakaten verziert, die ähnliche Motive hatten: wie zum Beispiel einen Mann, der sich zwischen den Kiefern eines Pottwals windet.
Strater ging an dieses besonders schreiende Plakat heran. Der Künstler hatte reichlich rote Farbe benutzt, um das Blut darzustellen, das von den Harpunentreffern ins Wasser strömte. »Wir haben mit dieser Show in Philadelphia einen ganzen Batzen Geld gemacht.«
Caleb nickte. »Nur noch Stehplätze, Abend für Abend, dank deiner Fähigkeiten als Showmaster.«
»Ohne meine Hauptattraktion wäre ich aber nichts gewesen«, sagte Strater und wandte sich um.
»Und ich muss dir für dieses Haus danken und für alles, das ich besitze«, sagte Caleb.
Lächelnd entblößte Strater eine Zahnlücke. »Wenn es etwas gibt, worin ich gut bin, dann darin, eine Show abzuziehen. Als ich dich das erste Mal sah, erkannte ich sofort die Riesenchance zu Ruhm und Reichtum.«
Ihre Partnerschaft hatte einige Tage nach Ankunft der Princess im Hafen von New Bedford begonnen. Die Tranfässer waren ausgeladen worden, die Eigner hatten die Ausbeute gezählt und berechneten nun die Heueranteile. Mannschaftsangehörige, die keine Ehefrauen oder Geliebten hatten, zu denen sie hätten heimkehren können, zogen danach als wilder Haufen los, um in den Hafenbars zu feiern, wo man nur darauf lauerte, den Walfängern ihren schwer verdienten Lohn wieder abzuknöpfen.
Caleb war auf dem Schiff geblieben. Er war auch dort gewesen, als der Kapitän mit Calebs Heuer auf die Princess kam und sich erkundigte, ob er auf die Farm seiner Familie zurückkehren wolle.
»Nicht so«, hatte Caleb mit einem traurigen Lächeln erwidert und auf sein Gesicht gedeutet.
Der Kapitän reichte dem jungen Mann einen armseligen Geldbetrag, den er in seinen Jahren auf See verdient hatte. »Du hast meine Erlaubnis, auf dem Schiff zu bleiben, bis wir wieder auslaufen.«
Während er über die Gangway schritt, verspürte der Kapitän großes Mitleid mit dem so sehr von seinem Pech gezeichneten Jungen. Doch er verdrängte diesen Gedanken schon bald und beschäftigte sich lieber mit seiner vielversprechenden Zukunft.
Etwa zur gleichen Zeit hatte Strater über weitaus düsterere Perspektiven nachgedacht, während er ein paar Straßen vom Schiff entfernt in einer heruntergekommenen Bar saß. Der ehemalige Marktschreier war endgültig vom Glück verlassen worden. Er hatte sich soeben ein frisches Bier bestellt, als die Männer der Princess in die Bar stürmten und begannen, sich mit der gleichen Energie zu betrinken, mit der sie vor nicht allzu langer Zeit noch Wale gejagt und getötet hatten. Strater spitzte die Ohren und lauschte voller Interesse der Geschichte von Caleb Nye, dem Grünschnabel, der von einem Wal verschluckt worden war. Die anderen Gäste in der Bar hörten sich den Bericht mit unverhohlener Skepsis an.
»Wo ist euer Jonas denn im Augenblick?«, übertönte ein Säufer mit seiner Frage den Lärm.
»Auf dem Schiff, wo er ganz im Dunkeln hockt«, erfuhr er. »Sieh es dir selbst an.«
»Das Einzige, was ich jetzt will, ist ein frisches Bier«, sagte der Säufer.
Strater war aus der lauten Bar in die stille Nacht hinausgeschlüpft und war dann durch eine enge Straße zum Hafen hinuntergelaufen. Über die Gangway erreichte er das von Laternen erhellte Deck der Princess. Caleb hatte an der Reling gestanden und zu den funkelnden Lichtern von New Bedford hinübergeblickt. Sein Gesicht und seine gesamte Erscheinung wirkten eher unauffällig, aber er schien von innen zu leuchten. Sofort rührte sich Straters marktschreierischer Instinkt.
»Ich habe ein Angebot für dich«, sagte Strater zu dem jungen Mann. »Wenn du es annimmst, kann ich dich zu einem reichen Mann machen.«
Caleb hörte sich Straters Vorschlag an und erkannte sofort die Möglichkeiten, die darin lagen. Innerhalb weniger Wochen wurden rund um New Bedford zahllose Plakate geklebt und Handzettel verteilt, auf denen in fetter Schrift zu lesen war:
Verschlungen von einem Wal.
Ein lebender Jonas erzählt seine Geschichte.
Strater mietete für die erste Veranstaltung einen Saal und musste Hunderte von Interessierten abweisen. Zwei Stunden lang erzählte Caleb seine aufregende Geschichte, wobei er mit einer Harpune in der Hand vor einem beweglichen Diorama stand.
Mit Calebs Walfangheuer hatte Strater einen Künstler engagiert, der einigermaßen akkurate Bilder auf einen mehrere Fuß hohen langen Streifen Leinwand gemalt hatte. Die von hinten beleuchtete Leinwand wurde langsam abgerollt und zeigte Bilder von Caleb im Walfangboot, vom Angriff des Wals, und dann eine fantasievolle Darstellung seiner Beine, wie sie aus dem Maul des Säugetiers herausragten. Außerdem gab es noch Bilder von exotischen, mit Palmen bewachsenen Orten und ihren Bewohnern.
Die Show wurde vor einem gebannten Publikum aufgeführt, vor allem in Kirchen und Stadthallen in Städten und Ortschaften an der Ostküste. Strater verkaufte gedruckte Broschüren und fügte Bilder von halbnackten tanzenden Eingeborenenmädchen hinzu, um die Schilderung ein wenig interessanter zu gestalten. Nach ein paar Jahren zogen sich Strater und Caleb ebenso reich wie die erfolgreichsten Walfangkapitäne aus dem öffentlichen Leben zurück und setzten sich zur Ruhe.
Strater kaufte eine Villa in New Bedford, und Caleb baute sein Hochzeitskuchenhaus im Fischerdorf Fairhaven auf der anderen Seite des Hafens gegenüber der Walfängerstadt. Vom Turm auf dem Dach aus beobachtete er jeden Tag, wie die Schiffe kamen und gingen. Er führte das Leben eines Einsiedlers und wagte sich kaum einmal bei Tageslicht nach draußen. Und wenn er sein Haus verließ, dann bedeckte er den Kopf und das Gesicht mit einer Kapuze.
Für seine Nachbarn war er schon bald nur noch der Geist. Und im Laufe der Zeit wurde er zu einem großzügigen Wohltäter, der seinen Reichtum dafür verwandte, Schulen und Bibliotheken für die Allgemeinheit zu bauen. Dafür schützten die Stadtbewohner die Privatsphäre ihres eigenen Jonas.
Caleb geleitete Strater in einen großen Raum, der bis auf einen gemütlichen Drehsessel in der Mitte völlig leer war. Das Diorama von Calebs Bühnenshow bedeckte ringsum die Wände. Jeder, der sich im Sessel niederließ, konnte sich drehen und auf diese Art und Weise die Geschichte des lebenden Jonas vom Anfang bis zum Ende verfolgen.
»Nun, wie findest du das?«, fragte Caleb seinen Freund.
Strater schüttelte den Kopf. »Wenn ich es sehe, bekomme ich fast wieder Lust, mit der Show auf Reisen zu gehen.«
»Unterhalten wir uns bei einem Glas Wein darüber«, sagte Caleb.
»Ich fürchte, dazu haben wir keine Zeit«, erwiderte Strater. »Ich habe eine Nachricht von Nathan Dobbs für dich.«
»Dem ältesten Sohn des Kapitäns?«
»Richtig. Sein Vater liegt im Sterben und möchte dich gerne noch einmal sehen.«
»Im Sterben? Das ist nicht möglich! Du hast mir doch selbst erzählt, der Kapitän sei so gesund und kräftig wie ein junger Bulle.«
»Es ist keine Krankheit, die ihn aufs Lager geworfen hat, Caleb. Er hatte einen Unfall … in einer seiner Fabriken. Ein Balken ist umgekippt und hat ihm den Brustkorb zerquetscht.«
Calebs Greisengesicht verlor auch noch den letzten Rest von Farbe. »Wann kann ich zu ihm?«, fragte er.
»Wir müssen auf der Stelle aufbrechen«, erwiderte Strater. »Ihm bleibt wohl nicht mehr viel Zeit.«
Caleb erhob sich aus dem Sessel. »Ich hole Mantel und Hut.«
Die Straße zur Dobbs-Villa wand sich um den Hafen von New Bedford und stieg dann zur Country Street an. Kutschen säumten die Auffahrt und die Straße vor dem in griechischem Stil erbauten Wohnsitz. Nathan Dobbs begrüßte Strater und Caleb an der Haustür und bedankte sich überschwänglich für ihr Kommen. Er war hochgewachsen, schlank und in jeder Hinsicht das jüngere Abbild seines Vaters.
»Was mit Ihrem Vater geschehen ist, tut mir aufrichtig leid«, sagte Caleb. »Wie geht es Kapitän Dobbs?«
»Er wird nicht mehr sehr lange auf dieser Welt bleiben, fürchte ich. Ich bringe Sie zu ihm.«
Der geräumige Salon und die angrenzenden Flure des Hauses wurden von den zehn Kindern des Kapitäns und unzähligen Enkelkindern bevölkert. Lautes Murmeln setzte ein, als Nathan Dobbs den Salon in Begleitung Straters und der seltsamen – mit einer Kapuze verhüllten – Gestalt betrat. Nathan lud Strater ein, es sich gemütlich zu machen, und begleitete Caleb ins Zimmer des Kapitäns.
Kapitän Dobbs lag in seinem Bett, umhegt von seiner Ehefrau und dem Hausarzt der Familie. Sie hatten das Krankenzimmer eigentlich verdunkeln wollen, wie es in jener Zeit üblich war. Doch er hatte darauf bestanden, dass die Vorhänge aufgezogen wurden, damit das Sonnenlicht eindringen konnte.
Ein Balken honigfarbenen herbstlichen Sonnenlichts lag auf dem verwitterten Gesicht des Kapitäns. Obwohl seine Löwenmähne inzwischen silbergrau war, erschienen seine Gesichtszüge viel jugendlicher, als man bei einem Mann Mitte sechzig hätte erwarten können. Doch in seinen Augen lag ein Ausdruck von weiter Entfernung, als könne er bereits sehen, wie sich der Tod anschlich. Die Frau des Kapitäns zog sich mit dem Arzt zurück, und auch Nathan hielt sich in der Nähe des Arztes.
Dobbs erkannte Caleb und brachte ein Lächeln zustande.
»Danke, dass du hergekommen bist, Caleb«, sagte der Kapitän. Die Stimme, die einst wie ein Donnerhall über die Schiffsdecks gerollt war, hörte sich nun nicht lauter als ein heiseres Flüstern an.
Caleb schlug die Kapuze von seinem Gesicht zurück. »Sie haben mir mal erklärt, ich dürfe niemals die Befehle des Kapitäns missachten.«
»Aye«, keuchte Dobbs. »Und ich gebe dir noch einen guten Rat, Grünschnabel. Steck deine Nase niemals in Angelegenheiten, in denen sie nichts zu suchen hat. Ich wollte einen wackligen Webstuhl reparieren. War nicht schnell genug, als er umkippte.«
»Ihr Unfall tut mir … entsetzlich leid, Käpt’n.«
»Das muss er nicht. Ich habe eine treue Ehefrau, hübsche Kinder und Enkelkinder, die meinen Namen weitertragen werden.«
»Ich wünschte, ich könnte das Gleiche von mir sagen«, erwiderte Caleb mit trauriger Stimme.
»Du hast eine Menge Gutes getan, Caleb. Ich weiß von deiner Großzügigkeit.«
»Großzügig zu sein fällt leicht, wenn es niemanden gibt, mit dem man sein Vermögen teilen kann.«
»Du hast es mit deinen Nachbarn geteilt. Und ich habe von deiner wunderbaren Bibliothek mit Büchern über unser altes Gewerbe gehört.«
»Ich rauche und trinke nicht. Mein einziges Laster sind Bücher. Der Walfang hat mir zu dem Leben verholfen, das ich nun führe. Ich sammle jedes Buch über den Walfang, das ich finden kann.«
Der Kapitän schloss die Augen und schien einzudösen, aber nach wenigen Sekunden öffneten sich die Lider flatternd. »Ich besitze etwas, das ich mit dir teilen möchte.«
Der Sohn des Kapitäns trat vor und reichte Caleb einen Kasten aus Mahagoniholz. Caleb klappte den Deckel auf. In dem Kasten lag ein Buch. Caleb erkannte den abgewetzten blauen Einband.
»Das Logbuch der Princess, Käpt’n?«
»Aye, und es gehört jetzt dir«, sagte der Kapitän. »Für deine große Bibliothek.«
Caleb wich zurück. »Das kann ich nicht von Ihnen annehmen, Sir.«
»Du wirst das tun, was dein Kapitän dir befiehlt«, knurrte Dobbs ungehalten. »Meine Familie ist damit einverstanden, dass du es haben sollst. Ist es nicht so, Nathan?«
Der Sohn des Kapitäns nickte bejahend. »Es ist auch der Wunsch der Familie, Mr Nye. Wir wüssten niemanden, der würdiger wäre, es zu besitzen.«
Der Kapitän legte eine Hand auf das Logbuch. »Eine seltsame Geschichte«, sagte er. »Irgendetwas muss auf dieser Insel mit den Wilden geschehen sein. Bis heute weiß ich nicht, ob es Gottes Werk … oder das des Teufels war.«
Der Kapitän schloss die Augen. Sein Atem ging schwerfälliger, mühsamer, ein Rasseln drang aus seiner Kehle. Er rief den Namen seiner Frau.
Behutsam ergriff Nathan Calebs Arm und geleitete ihn aus dem Raum. Er bedankte sich bei ihm für seinen Besuch und sagte dann seiner Mutter Bescheid, die Zeit des Kapitäns sei gekommen. Die Familie drängte sich ins Krankenzimmer und in die angrenzenden Flure und ließ Strater und Caleb allein im Salon zurück.
»Ist er tot?«, fragte Strater.
»Noch nicht, aber sicher bald.« Caleb zeigte Strater das Logbuch.
»Mir wäre ein wenig von Dobbs’ Vermögen lieber«, schnaubte Strater.
»Dies ist für mich ein wahrer Schatz«, sagte Caleb. »Außerdem hast du doch mehr Geld, als du in deinem Leben ausgeben kannst, mein Freund.«
»Dann muss ich eben länger leben«, sagte Strater mit einem Blick zum Krankenzimmer.
Sie verließen das Haus und stiegen in Straters Einspänner. Caleb drückte das Logbuch an seine Brust und kehrte in Gedanken auf die einsame Insel und zu ihren Bewohnern, zu seiner Maskerade als atua, zu der Krankheit und dem seltsamen blauen Leuchten zurück. Er wandte sich zu einem letzten Blick auf die Villa um und rief sich die Worte des sterbenden Kapitäns in Erinnerung.
Dobbs hatte recht. Es war in der Tat seine seltsame Geschichte.
1
Murmansk, Russland, heute/Gegenwart
Als Kommandant einer der furchteinflößendsten Tötungsmaschinen, die je konstruiert wurden, hatte Andrei Vasilevich einst die Macht in Händen gehabt, ganze Städte und Millionen von Menschen auszulöschen. Wenn jemals zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten ein Krieg ausgebrochen wäre, hätte das U-Boot der Typhoon-Klasse, das Vasilevich befehligte, zwanzig ballistische Langstreckenraketen auf die Vereinigten Staaten abgefeuert und zweihundert Atomsprengköpfe auf amerikanisches Terrain herabregnen lassen.
In den Jahren, seit er aus der Marine ausgeschieden war, hatte Vasilevich sehr oft eine tiefe Erleichterung darüber verspürt, dass er nie den Befehl erhalten hatte, eine solche Salve nuklearer Vernichtung auszulösen. Als Kapitän und Politoffizier hätte er die Befehle seiner Regierung ohne zu zögern ausgeführt. Befehl war Befehl, ganz gleich wie schrecklich er auch sein mochte. Ein U-Boot-Kommandant war ein verlängerter Arm des Staates und konnte sich keine Gefühle leisten. Aber als sich der zähe alte Kalte Krieger von seinem Kommandoposten, dem U-Boot mit dem inoffiziellen Namen Bear verabschiedete, konnte er die Tränen doch nicht zurückhalten, die ihm über die Wangen rannen.
Er stand auf dem Kai des Hafens von Murmansk und sah dem U-Boot nach, das langsam zur Hafenausfahrt glitt. Er hob eine silberne Taschenflasche, mit Wodka gefüllt, zu einem letzten Toast hoch in die Luft, ehe er einen Schluck trank, und seine Gedanken kehrten in die Zeit zurück, die er damit verbracht hatte, auf dem Monsterschiff im Nordatlantik zu kreuzen. Mit einer Länge von fünfhundertsiebzig Fuß und einer Breite von fünfundsiebzig Fuß war das Typhoon-Schiff das größte U-Boot, das jemals gebaut worden war. Das lange Vorderdeck erstreckte sich unter dem zweiundvierzig Fuß hohen Kommandoturm, auch Segel genannt, und bot zwanzig großen Raketensilos Platz, die in zwei Reihen angeordnet waren. Diese Konstruktion verlieh dem Typhoon sein charakteristisches Profil.
Die einzigartige Rumpfkonstruktion setzte sich von der stählernen Außenhülle nach innen fort. Im Gegensatz zu einem einzigen Druckkörper, wie die meisten U-Boote sie besaßen, verfügte das Typhoon über zwei parallel verlaufende. Diese Anordnung verlieh dem Typhoon eine Ladekapazität von fünfzehntausend Tonnen und genügend Raum an Steuerbord, um einen kleinen Turnsaal und eine Sauna unterzubringen. Fluchtkammern befanden sich über jedem Rumpf. Der Kontrollraum und das Gefechtszentrum waren in Abteilen unterhalb des Segels versteckt worden.
Die Bear war eins von sechs U-Booten der 941 Typhoon-Klasse, deren Bau in den 1980ern zur Aufstockung der Nordmeer-Flotte in Auftrag gegeben und die als Teil der ersten Flotille atomgetriebener Unterseeboote mit Stützpunkt Nerpichya in Dienst gestellt wurden. Leonid Breschnew hatte den Namen Taifun in einer Rede verwendet, und dieser Name blieb bestehen. Sie gehörten zur russischen Akula-Klasse, was so viel wie Haifisch bedeutet. Diesen Namen verwendete die U. S. Navy für sie.
Trotz seiner Größe erreichte das Typhoon-Schiff bei Unterwasserfahrt eine Geschwindigkeit von siebenundzwanzig Knoten und bei Überwasserfahrt immerhin noch die Hälfte. Es konnte auf einem Rubel wenden, bis in fünfhundert Meter Tiefe tauchen und hundertachtzig Tage auf Tauchfahrt bleiben. Ausgeführt wurden diese Manöver mit Hilfe eines der leisesten Antriebssysteme, die je gebaut worden waren. Das U-Boot hatte eine Besatzung von mehr als hundertsechzig Mann. Jeder Rumpf verfügte über einen Atomreaktor zum Antrieb einer Dampfturbine, die eine Leistung von fünfzigtausend PS entwickelte und zwei große Propellerschrauben antrieb. Eine Querstrom-Strahlruderanlage, die aus zwei schwenkbaren Antriebssäulen mit Elektromotoren im Bug und im Heck bestand, ermöglichte dem U-Boot ein genaues Manövrieren in getauchtem Zustand.
Die Typhoon-U-Boote verloren jedoch ihren militärischen und politischen Nutzen und wurden Ende der 1990er außer Dienst gestellt. Jemand machte den Vorschlag, sie zu Frachtschiffen umzubauen, die unter dem arktischen Eis operieren konnten, indem die Raketensilos durch Frachträume ersetzt wurden. Dann aber wurde bekanntgegeben, dass die Typhoons gegen Höchstgebot zum Verkauf standen.
Der Kapitän hätte es lieber gesehen, wenn die U-Boote verschrottet worden wären, als in Unterwasser-Lastkähne umgewandelt zu werden. Was für ein unwürdiges Ende für eine so exzellente Kriegsmaschine! Zu ihrer Zeit war der schreckliche Typhoon-Schiffstyp häufig zum Thema von Büchern und Kinofilmen geworden. Er hatte längst vergessen, wie oft er sich Jagd auf Roter Oktober angesehen hatte.
Vasilevich war vom Zentralen Konstruktionsbüro für Marinetechnik engagiert worden, um den Umbau zu überwachen. Die Atomraketen waren im Zuge eines gegenseitigen Abkommens mit den Vereinigten Staaten schon lange abgebaut worden, die ihrerseits zugesagt hatten, ihre eigenen Langstreckenraketen zu verschrotten.
Vasilevich hatte den Ausbau der Raketensilos in die Wege geleitet, um einen geräumigen Frachtraum zu schaffen. Die Silos wurden verschlossen, und es wurden Umbauten vorgenommen, die ein einfacheres Laden und Entladen von Fracht erlaubten. Eine etwa halb so große Mannschaft wie zur Zeit seines militärischen Einsatzes würde das U-Boot an seine neuen Eigentümer ausliefern.
Der Kapitän trank einen weiteren Schluck Wodka und verstaute die Flasche dann wieder in der Tasche. Ehe er das Dock verließ, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, sich für einen letzten Blick noch einmal umzudrehen. Das U-Boot hatte den Hafen verlassen und befand sich nun auf dem offenen Meer, unterwegs zu einem bislang noch unbekannten Schicksal. Der Kapitän verkroch sich tiefer in seinen Mantel, um vor der feuchten Brise, die vom Meer heranwehte, Schutz zu suchen, und kehrte zu seinem Wagen zurück.
Vasilevich war schon zu lange im Geschäft, um offiziellen Verlautbarungen unbesehen zu glauben. Das Unterseeboot war angeblich an eine in Hongkong ansässige internationale Frachtgesellschaft verkauft worden, doch die Details dieses Handels wirkten doch sehr vage, und das Geschäft war so verschachtelt wie ein Satz Matrjoschka-Puppen.
Der Kapitän hatte seine eigene Theorie, was die Zukunft des Unterseebootes betraf. Ein U-Boot mit der Langstreckenleistung und Ladekapazität der Typhoon wäre das ideale Transportmittel für jede Art von wertvollem Schmuggelgut. Aber Vasilevich behielt seine Überlegungen für sich. Das moderne Russland konnte für diejenigen gefährlich werden, die zu viel wussten. Was die neuen Eigentümer unternahmen, nachdem sie dieses Relikt des Kalten Krieges erworben hatten, ging ihn einfach nichts an. Die Warnzeichen, die diese geschäftliche Transaktion begleiteten, waren zahlreich und unübersehbar. Doch der Kapitän wusste, dass es klug war, deswegen keine Fragen zu stellen, und sogar noch klüger, nichts darüber zu wissen.
2
Provinz Anhui, Volksrepublik China
Der Hubschrauber tauchte aus dem Nichts auf und kreiste wie eine lärmende Libelle über dem Dorf. Dr. Song Lee blickte von dem Verband hoch, mit dem sie soeben die Schnittwunde am Arm eines kleinen Jungen versorgte, und beobachtete, wie der Hubschrauber in der Luft stehen blieb und dann senkrecht auf ein Feld am Rand der Siedlung herabsank.
Die Ärztin tätschelte den Kopf des Jungen und nahm als Bezahlung von den dankbaren Eltern ein halbes Dutzend frischer Eier an. Sie hatte die Wunde mit Seife, warmem Wasser und einem Kräuterumschlag behandelt – und sie heilte zufriedenstellend. Da ihr an Medizin und Ausrüstung nur wenig zur Verfügung stand, bemühte sie sich, mit dem, was sie hatte, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Dr. Lee brachte die Eier in die Hütte und schloss sich dann den laut durcheinanderrufenden Schaulustigen an, die zum Feld rannten. Aufgeregte Dorfbewohner, darunter viele, die noch nie zuvor ein Flugzeug aus dieser Nähe gesehen hatten, umringten den Helikopter. Lee erkannte die Hoheitszeichen der Regierung auf dem Rumpf und fragte sich, wer es wohl sein mochte, den das Gesundheitsministerium in ihr abgelegenes Dorf geschickt hatte.
Die Helikoptertür schwang auf, und ein kleiner, rundlicher Mann in Straßenanzug und Krawatte stieg aus. Er warf einen Blick auf die Ansammlung wild plappernder Dorfbewohner, und ein Ausdruck des Schreckens erschien auf seinem breitflächigen Gesicht. Er wäre sicherlich sofort wieder in den Hubschrauber zurückgekehrt, wenn sich Lee nicht durch die Menge gedrängt hätte, um ihn zu begrüßen.
»Guten Tag, Dr. Huang«, rief sie laut genug, um über dem Lärm auch noch gehört zu werden. »Das ist aber eine Überraschung.«
Der Mann warf einen wachsamen Blick auf die Menschenmenge. »Mit einem derart rauschenden Empfang hatte ich nicht gerechnet.«
Dr. Lee lachte. »Keine Sorge, Doktor. Die meisten dieser Leute sind mit mir verwandt.« Sie deutete auf ein Ehepaar, dessen verwitterte braune Gesichter strahlend lachten. »Dies sind meine Eltern. Wie Sie sehen können, sind sie völlig harmlos.«
Sie fasste Dr. Huang bei der Hand und führte ihn durch den Schwarm Schaulustiger. Die Dorfbewohner machten Anstalten, ihnen zu folgen, aber die junge Ärztin stoppte sie mit einer Handbewegung und erklärte ihnen behutsam, dass sie mit dem Mann allein zu sprechen wünsche.
In ihrer Hütte bot sie dem Besucher den ramponierten Klappsessel an, in dem sie immer saß, wenn sie ihre Patienten behandelte. Huang wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von seinem kahlen Schädel und entfernte dann einige Lehmspritzer von seinen glänzenden schwarzen Lederschuhen damit.
Auf einem Campingherd brachte sie Wasser zum Kochen, bereitete Tee zu und schenkte eine Tasse voll für ihren Gast ein. Huang trank einen vorsichtigen Schluck, als habe er Bedenken, dass das Getränk nicht hygienisch sauber war.
Lee ließ sich auf den alten Esszimmerstuhl sinken, den die Patienten immer benutzten. »Wie gefällt Ihnen mein Freiluft-Behandlungszimmer? Meine sittsameren Patienten untersuche ich in der Hütte. Tiere behandle ich auf ihrem eigenen Territorium.«
»Das ist weit entfernt von der Harvard Medical School«, sagte Huang und sah sich fasziniert in der Hütte mit ihren Lehmwänden und dem strohgedeckten Dach um.
»Das ist weit entfernt von allem«,





























