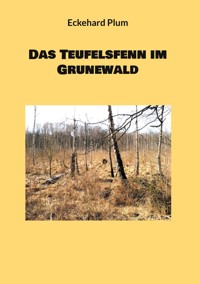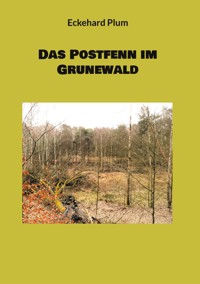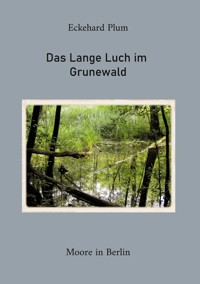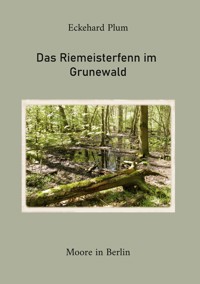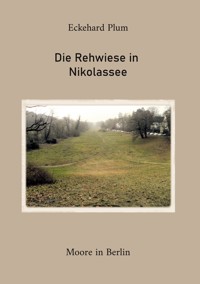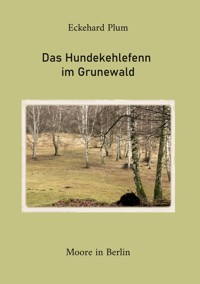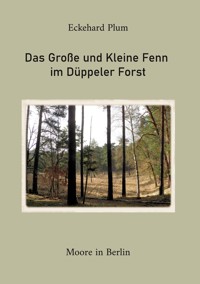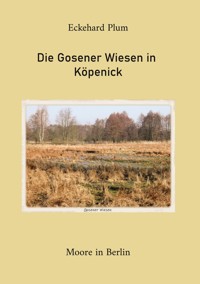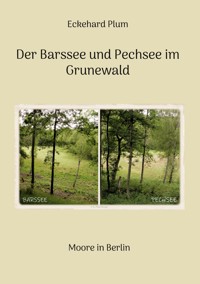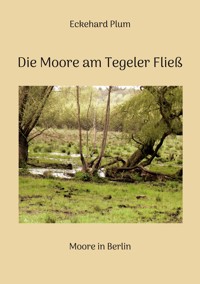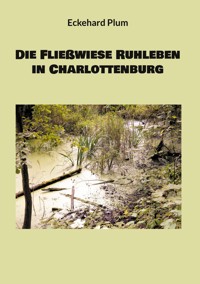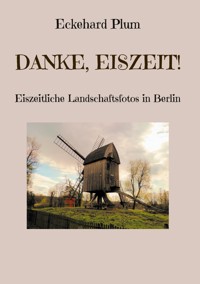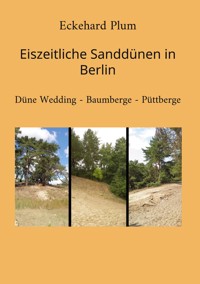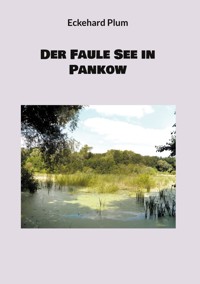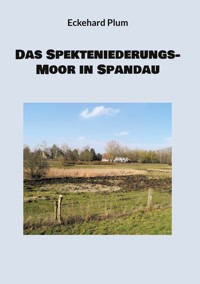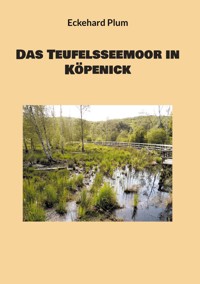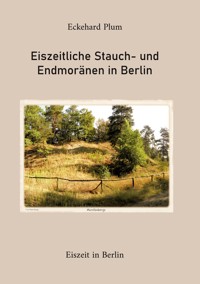
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Als Teil der sogenannten Glazialen Serie gibt es in Berlin unter anderem Stauch- und Endmoränen. Auch in diesem Bereich hat die Weichseleiszeit ihre geomorphologischen Spuren hinterlassen. Dieses Buch erklärt Ihnen, was es mit der Eiszeit in Berlin auf sich hat und wie es zu diesen speziellen Strukturen in der Hauptstadt gekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 29
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gestauchte Endmoräne am östlichen Havelufer mit dem Grunewaldturm
Der Müggelturm, der auf einer Endmoräne erbaut wurde
Der Müggelturm auf der bewaldeten Endmoräne
Stauchendmoräne Murellenberge
Aufstieg zu den Murellenbergen
In diesem Buch geht es um Teile der Glazialen Serie, die sozusagen die Insignien einer Eiszeit darstellen. Genauer gesagt geht es um die eiszeitlichen Stauch- und Endmoränen.
Mit der Elster, Saale- und der Weichseleiszeit, allesamt benannt nach europäischen Flüssen, lassen sich in Berlin drei Kaltzeiten sicher nachweisen. Ausschlaggebend für diese Stadt war aber schlussendlich die letzte, nämlich die Weichseleiszeit. Sie hat der Stadt ihr morphologisches Aussehen gegeben. Ohne diese Eiszeit wäre Berlin platt wie ein Pfannkuchen! Ohne sie gäbe es auch nicht die vielen Seen und Flüsse, die den ganz besonderen Charme dieser Metropole ausmachen. Und ohne sie gäbe es deshalb auch nicht die Stauch- und Endmoränen.
Verweilen wir noch ein wenig bei der Weichseleiszeit, die vor etwa 115.000 Jahren begann und vor ca. 11.700 Jahren endete. Ihre gewaltigen Eismassen und Gletscher – die bis etwa 45 Kilometer südlich von Berlin vordrangen – kamen aus dem hohen Norden, aus Skandinavien zu uns. Nach dem Abschmelzen der riesigen Eismassen blieben die mitgeführten Geschiebe einfach liegen. Ebenfalls zurück blieben Sand, Kies, Schluff und Ton. Daraus bildete sich unter dem Eis die Grundmoränenlandschaft mit ihren sanften Hügeln. Das charakteristische Sediment der Grundmoräne ist der fruchtbare Geschiebemergel, auch Till genannt.
Geologische Skizze von Berlin
Wie Sie anhand der geologischen Skizze1 (siehe oben) sehen können, zeigen sich mit der Barnim-Hochfläche im Nordosten, der Teltow-Hochfläche im Süden und der Nauener Platte im Südwesten Berlins drei ausgebildete Grundmoränenlandschaften. Weitere sichtbare Hinterlassenschaften der Eiszeiten sind sicherlich auch die vielen Seen (Wannsee, Müggelsee usw.) und Flüsse (Spree, Havel z. B.). Ich sprach eben von Geschieben, die in der Landschaft liegen geblieben sind. Ab einer Größe von 1 Kubikmeter spricht man nicht mehr von Geschieben, sondern von Findlingen. Und von diesen gibt es in Berlin unzählige.2 Dazu aber später mehr. Das also für Berlin wichtigste geologische Zeitalter wird Pleistozän (Zeitalter der Eiszeiten) genannt, das wiederum vom Holozän (Jetztzeit) abgelöst wird – beides geologische Unterstufen des Quartärs.
Die schmelzenden Eismassen gegen Ende der Weichseleiszeit flossen in Richtung Nordwesten ab und hinterließen so das Berliner Urstromtal als Teil des sogenannten Warschau-Berliner Urstromtals – das von Ost nach West quer durch die Stadt verläuft – und in dem heute die Spree fließt. Dabei trennt es die Barnim-Hochfläche von der Teltow-Hochfläche. Die dort vorhandenen Sande haben eine Mächtigkeit von mehr als 20 Metern ausgebildet und stellen die Grundwasser- und damit auch Trinkwasserspeicher der Stadt Berlin dar. Viele Teiche und Seen in Berlin sind Toteisseen, die sich erst nach dem Rückzug der Gletscher gebildet haben. Während des Pleistozäns fielen die Temperaturen deutlich, was zu immer größeren Schneemassen im Norden Europas führte. Irgendwann wurde der Druck von oben so stark, dass die darunter liegenden Schichten zu Eis umgeformt wurden. So bildeten sich im Norden die Gletscher, die enorme Kräfte ausbildeten und zähplastisch wurden. Und dann begannen sie nach Süden zu „fließen“. Auf ihrer langen Reise nahmen sie Unmengen von Gesteinen mit, vom kleinsten Kiesel bis zum hausgroßen Brocken, den Findlingen. Auf dem Weg der Gletscher