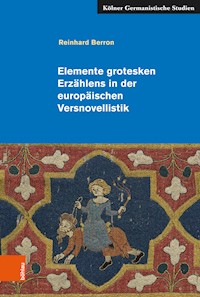
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Köln
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kölner Germanistische Studien. Neue Folge
- Sprache: Deutsch
Vor allem in den Fabliaux und in den Mären, aber auch in Giovanni Boccaccios Decameron, fiel schon früh die Präsenz des Grotesken auf, das sich vor allem in entfesselter Gewalt, sexueller Triebhaftigkeit und Verhöhnung geistlicher Institutionen äußert. Die Erscheinungsformen dieser als Teil der mittelalterlichen Komik zu verstehenden Elemente zeichnet die Studie über eine Wirkungszeit von ca. 500 Jahren in fünf verschiedenen europäischen Literaturräumen nach und fragt dabei nach den Zusammenhängen zwischen der Form der literarischen Kunstwerke und dem Grotesken. Dabei zeigt sich, dass die Chronologie des Grotesken durch die gegenseitige internationale Beeinflussung keineswegs eindeutig ist, was sich auch durch neuere Handschriftenfunde bestätigt. Allgemein scheinen Texte in Versen mehr zum Grotesken tendieren als solche in Prosa, was Rückschlüsse auf das Publikum zulässt. Doch auch die Themen, die groteske Elemente fördern, variieren von Sprachraum zu Sprachraum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KÖLNER GERMANISTISCHE STUDIEN
Herausgegeben Von
GÜNTER BLAMBERGER, RUDOLF DRUX,ERICH KLEINSCHMIDT UND HANS-JOACHIM ZIEGELER
Neue Folge
Band 13
Reinhard Berron
Elemente grotesken Erzählens in dereuropäischen Versnovellistik
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Zugl. Diss. Universität Tübingen 2016
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung:Augustinermuseum – Städtische Museen Freiburg,Leihgabe Adelhausenstiftung Freiburg i. Br., Foto: Axel Killian
© 2021 by Böhlau Verlag GmbH & Cie. KG, Lindenstraße 14, D-50674 Köln AlleRechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf dervorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Korrektorat: Felicitas Sedlmair, GöttingenEinbandgestaltung: Michael Haderer, WienSatz: le-tex publishing services, LeipzigEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-412-52171-4
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Grundpositionen der Groteskeforschung
1.2 Elemente des Grotesken
1.3 Gegenstände der Untersuchung
2. Exkurs: das Groteske vor 1500
2.1 Dionysoskult
2.2 Das griechische Theater
2.3 Die menippeische Satire
2.4 Die Carmina Priapea
2.5 Ovids Metamorphosen
2.6 Komik im lateinischen Mittelalter
2.7 Zusammenfassung
3. Elemente des Grotesken
3.1 Elemente des Grotesken im ‚Märe‘
3.1.1 Verkehrung im Märe
3.1.1.1 Sibotes Frauenerziehung
3.1.1.2 Parallelen in der deutschen Märenliteratur
3.1.1.3 Parallelen in der europäischen Novellistik
3.1.1.4 Weitere übel-wîp-Erzählungen
3.1.2 Verzerrung im Märe
3.1.2.1 Völlerei im Märe
3.1.2.2 Obszönität im Märe
3.1.2.3 Skatologie im Märe
3.1.2.4 Gewalt im Märe
3.1.3 Vermischung im Märe
3.1.3.1 Das Sakrament als Gegenstand grotesker Komik
3.1.3.2 Degradierung
3.1.4 Zusammenfassung Märe
3.2 Elemente des Grotesken im Fabliau
3.2.1 Verkehrung im Fabliau
3.2.2 Verzerrung im Fabliau
3.2.2.1 Völlerei im Fabliau
3.2.2.2 Obszönität im Fabliau
3.2.2.3 Skatologie im Fabliau
3.2.2.4 Gewalt im Fabliau
3.2.3 Vermischung im Fabliau
3.2.4 Zusammenfassung Fabliaux
3.3 Elemente des Grotesken in den provenzalischen Novas
3.4 Elemente des Grotesken in iberischen Erzählsammlungen
3.4.1 Juan Ruiz: El libro de buen amor
3.4.2 Don Juan Manuel: El conde Lucanor
3.4.3 Llibre dels set savis
3.4.4 Zusammenfassung iberische Erzählsammlungen
3.5 Elemente des Grotesken in der italienischen Novellistik
3.5.1 Il Novellino (Le Cento novelle antiche)
3.5.2 Giovanni Boccaccio: Il Decameron
3.5.2.1 Form und Struktur des Decameron
3.5.2.2. Groteske Elemente im Decameron
3.5.3 Die Cantari
3.5.3.1. Vorlage Decameron
3.5.3.2. Vorlage Fabliau
3.5.3.3. Weitere schwankhafte Cantari
3.5.4 Zusammenfassung italienische Novellistik
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis
5.1 Nachschlagewerke
5.2 Texte und Ausgaben
5.3 Verwendete Forschungsliteratur
Anhang I. Mären, in denen groteske Elemente gefunden wurden
Anhang II. Fabliaux, in denen groteske Elemente gefunden wurden
Register
Personenregister
Titelregister
1.Einleitung
Was ist grotesk an der mittelalterlichen Versnovellistik im europäischen Vergleich und inwieweit lässt sich der Begriff des Grotesken am Beispiel der Versnovellistik umreißen? Diese beiden Fragen stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit.
Die Konzepte des Grotesken und der Versnovellistik sind umstritten und standen bereits im Mittelpunkt zahlreicher Forschungskontroversen. Der Begriff des Grotesken stammt als ursprünglich ästhetischer Terminus aus dem Bereich der Architekturund Kunstgeschichte und etablierte sich als literaturwissenschaftlicher Terminus erst im zwanzigsten Jahrhundert; die Gattungsbezeichnung Novelle wird seit Giovanni Boccaccios Decameron in den romanischen Literaturen verwendet (italienisch ‚novella’, französisch ‚nouvelle’, spanisch ‚novela corta’, portugiesisch ‚novela’); seine Prosadichtung diente zahlreichen Werken zum Vorbild. Die Kenntnis im deutschen Sprachraum setzt mit den Übersetzungen Arigos und Heinrich Steinhöwels im 16. Jahrhundert ein; die Gattungsbezeichnung ist seit Wieland, Goethe und den Autorinnen und Autoren der Romantik in der deutschen Literatur im Gebrauch, wobei sich auch die Veröffentlichung einzelner Novellen einbürgerte.1
Der Begriff der Novellistik umfasst die Gesamtheit der Novellen in ihren einzelsprachlichen und formalen Ausprägungen. Die in dieser Arbeit vorgenommene Beschränkung auf die Versnovellistik begreift die beiden Hauptcorpora dieser Arbeit, das mittelhochdeutsche Märe und das altfranzösische Fabliau, mit ein. Der Begriff der Versnovelle wurde u. a. durch Karl-Heinz Schirmer als Synonym zum Terminus Märe verwendet.2 Im Hinblick auf die komparatistische Ausrichtung der vorliegenden Arbeit lässt dieser Begriff einen gewissen Spielraum bei der Auswahl der darunter zu fassenden Texte.
In dieser Arbeit wird weniger die Erarbeitung einer Definition des Grotesken zu erreichen versucht, als vielmehr das Phänomen des Grotesken auf der Grundlage eines komparatistisch definierten Corpus untersucht. Auch im Bereich der Novellistik wird weniger auf die Diskussion um das Wesen der Novelle eingegangen als vielmehr auf deren Ausprägungen in den Literaturen des Mittelalters, die den Gegenstand dieser Untersuchung bilden; am Ende der Darstellung wird hier das näher zu betrachtende Corpus präsentiert.
Lehre oder Unterhaltung?
Beide Komplexe, sowohl der des Grotesken als auch der das Wesen der Novellistik betreffende, wurden auch unter dem Bezug auf die Frage diskutiert, ob die gewählten literarischen Beispiele vorrangig der Lehre oder der Unterhaltung dienten. Dabei besteht über die Entstehung der mittelalterlichen Novellistik aus der Exempla-Literatur weitgehende Einigkeit; auch die orientalischen Erzählsammlungen, die als Vermittler zahlreicher novellistischer Stoffe angesehen werden, sind eher lehrhaften Charakters.
Die Unterscheidung von lehrhaften und unterhaltenden Geschichten scheint für die mittelalterlichen Rezipientinnen und Rezipienten zunächst kein Kriterium gewesen zu sein. Sie ist bei mittelhochdeutschen Mären und altfranzösischen Fabliaux selten eindeutig zu treffen, da in diesen Inhalt und Lehre, wie des Öfteren beobachtet, meist nicht zusammenstimmen: „Die explizit angehängte Lehre in ihrer Billigkeit ist typisch, sei diese nun mehr ein zynisches Mäntelchen, das, indem es Sinn vorspiegelt, die Sinnlosigkeit im Grunde noch höher treibt, oder sei es, daß man die Narratio an die Moral verrät und die Dialektik erzählerisch einebnet.“3 Die Mären- und die Fabliauxforschung sind dementsprechend schon immer in zwei Fraktionen gespalten:
Positionen der Forschung, die diesem Erzählen ein gewisses anarchisches Potential zubilligen, das gerade vor der Geschlechterordnung nicht Halt macht, stehen andere gegenüber, die jedem noch so provokanten – das heißt insbesondere mit (Sprach-) Gewalt und Obszönität gewürzten – Ansatz von Transgression nur negativdidaktische Funktionen zubilligen möchten.4
Übereinstimmend betonen in den meisten Fällen die VertreterInnen der einen Fraktion die lehrhafte Funktion und beantworten demgemäß die Gattungsfrage zurückhaltend, indem sie die Versnovelle dem Komplex der lehrhaften mittelalterlichen Kurzerzählungen eingliedern. Die gesellschaftliche Situierung erfolgt entsprechend: Die Erschaffung und Hauptrezeption der Versnovelle wird eher dem Klerus und dem Adel zugeschrieben.5
Die Fraktion, die in Märe und Fabliau ausschließlich Gattungen zum Zweck der Unterhaltung zu sehen bereit ist, betont demgegenüber diese Funktion und schließt auf andere Rezipientenkreise, auf fahrende Sänger als Urheber und auf mündliche Herausbildung der Erzählungen:
Die deutsche Schwankliteratur als autonome Gattung ist eine Schöpfung des 13. Jh., und sie steht nicht isoliert da. Zur gleichen Zeit, etwas früher oder später, entsteht eine Schwankliteratur in Frankreich, in Italien und England. In diesem literarhistorischen Prozeß findet sich die deutsche Dichtung nicht an letzter, sondern mit an vorderer Stelle.6
Wie später noch diskutiert wird, ist ein Problem der Vergleichbarkeit von Märe und Fabliau die nur teilweise vorhandene Überschneidung ihrer Erzählintentionen. Verkürzt gesprochen sind alle Fabliaux Schwankdichtungen, nicht aber alle Mären. Durch den Rückgriff auf den neutralen Terminus Versnovelle können verschiedene Erzähltraditionen daraufhin überprüft werden, inwiefern groteske Elemente eher mit lehrhafter oder mit unterhaltender Erzählintention einhergehen.
In Verbindung gesetzt wurde das Groteske mit der Versnovelle dennoch vor allem in deren schwankhaften Vertretern, als Teilaspekt des Komischen. Die ersten Überlegungen dazu, welche Erzählverfahren als groteske Elemente zu betrachten seien, erfolgen daher in der Auseinandersetzung mit diesen.
Überblick über das Programm der vorliegenden Arbeit
Untersuchungen des literarischen Phänomens des Grotesken beziehen sich meist auf einen bestimmten Ansatz der Groteskeforschung, dessen Methoden und Prämissen übernommen und auf den eigenen Gegenstand bezogen werden. Der Weg, den diese Ansätze gehen, um zu einer Definition des Grotesken zu gelangen, verläuft jedoch ebenfalls über eine Vorauswahl an als grotesk geltenden Texten und/oder Kunstwerken, woraus sich je unterschiedliche Schlussfolgerungen ergeben. Diese Grundpositionen werden im 1. Kapitel der Einleitung vorgestellt (1.1).
Auf der Basis der Forschungsergebnisse und in Vorgriff auf die Ergebnisse der textnahen Untersuchung ergibt sich die Konzeption des Grotesken, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Sie konstituiert eine Gruppe an Elementen des Grotesken, deren Auftreten im Corpus den Hauptteil dieser Arbeit bilden. Sie werden im 2. Kapitel der Einleitung präsentiert (1.2).
In Kapitel 1.3 wird sich in der Auseinandersetz- ung mit literaturund gattungsgeschichtlichen Positionen das Corpus formieren, das zur Untersuchung im analytischen Teil herangezogen wird. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ohne den Anspruch, eine neue Gattungsgeschichte zusammenzustellen, obwohl damit auch die kleine Hoffnung verbunden ist, diese zumindest ein wenig zu erhellen oder jedenfalls in ihrer Vielfalt zu zeigen. Gattungsgeschichte im eigentlichen Sinne wird vor allem in den einleitenden Kapiteln zu den fünf Teilen, die den einzelsprachlichen Ausprägungen der Versnovellistik gewidmet sind, im Mittelpunkt stehen.
An die Einleitung schließt sich ein längerer Exkurs (2.) an, dessen Intention es ist, die gängige Auffassung, dass das Groteske ein neuzeitliches Phänomen sei, durch Beispiele aus der vormodernen Literatur, zuvorderst der griechisch-römischen, zu widerlegen.
Die eigentliche Analyse erfolgt in dem entsprechend den fünf untersuchten Literaturräumen gegliederten dritten Teil.
1.1Grundpositionen der Groteskeforschung
Am ausführlichsten mit dem Zusammenhang zwischen dem Grotesken und der Versnovellistik setzte sich der germanistische Mediävist Klaus Grubmüller auseinander. Am Beginn dieses Kapitels steht daher ein kurzer Überblick über seine Positionen. Im Anschluss daran werden knapp einige der wichtigsten Positionen der Groteskeforschung dargestellt, und zwar bezüglich ihrer allgemeinen Auffassung dessen, was grotesk ist, und in Bezug darauf, welche Elemente des Erzählens jeweils als grotesk angesehen werden.
Grubmüllers Verknüpfung von Märe und Groteskem
Klaus Grubmüller befasste sich mit dem Grotesken im Rahmen seiner Beschäftigung mit der Gattungsgeschichte der Versnovellistik. Bereits in seinem 1993 erschienenen Aufsatz Das Groteske im Märe als Element seiner Geschichte7 unternahm er es, die grotesken Vertreter des Märes, der mittelhochdeutschen Versnovelle, in einen gattungsgeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Dieser Beitrag kann rückblickend als eine Art Vorstudie zu der 2006 erschienenen literaturgeschichtlichen Darstellung Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichte der europäischen Novellistik im Mittelalter: Fabliau – Märe – Novelle8 gelten, in der Grubmüller auf ähnliche Weise eine Entwicklung der Gattung vom exemplarischen zum in der Handlung chaotischen, didaktischer Ansprüche enthobenen Erzählen darstellt.9 Demzufolge wandte sich das vom Stricker als didaktisches Genre begründete Märe10 dem Grotesken zu und gab in der Folge seine vormalige Hauptfunktion auf.
Unter dem Grotesken versteht Grubmüller v.a. ausufernde Gewaltdarstellungen, aber auch andere Erzählstrukturen und Motive, die „die strenge Funktionalität der Einzelelemente“11 auflösen. Diese Elemente dienen nach seiner Darstellung der Vorführung der Störung der Ordnung, die in der Folge, wie bspw. beim Stricker, wiederhergestellt werde. Je später die Erzählungen entstanden seien, desto mehr tendierten die Figuren in ihren Handlungen zu chaotischen und nicht mehr rational motivierten Ausbrüchen. Beispiele wie Das Nonnenturnier oder Der verklagte Zwetzler
bilde[te]n makabre ‚Höhepunkte‘ einer Gattung, in der das Scheitern der ihr von ihrer Frühgeschichte her […] eingeschriebenen Aufgabe, Ordnung zu stiften und gestiftete Ordnung vorzuführen, […] in wahnwitzige Bilder verdinglichter und sich ins Chaos vereinzelnder Triebe [mündet].12
Diese Argumentation erinnert zum Teil an die These Walter Haugs in seinem Entwurf zu einer Theorie der mittelalterlichen Kurzerzählung. Haug behauptet darin unter der Prämisse, dass das Erzählen im gattungsfreien Raum keinen Sinn stiften könne, die Mären bildeten keine eigene Gattung: Pro- und Epimythion seien der Kurzerzählung aufgesetzt und versuchten lediglich, deren Sinndefizit „dadurch zu beheben oder wenigstens abzumildern oder auch nur zu kaschieren, daß er [der Erzähler] ihr explizit einen Sinn in Form einer Moral mitgibt.“13 Wenn die Erzählung einmal nicht in Chaos und Brutalität ende, liege darin kein Programm, sondern eine willkürliche Entscheidung des Erzählers, die er treffen könne, eben weil dieses Erzählen im gattungsfreien Raum anzusiedeln sei.
Grubmüller geht nun seinerseits nicht von einem Erzählen im gattungsfreien Raum aus, sondern setzt die Haugschen Kategorien von Chaos und Brutalität mit dem Grotesken gleich. Im Gegensatz zu Haug ist ihm an der Darstellung einer Entwicklung gelegen: Das Groteske der späteren Mären steht dem Erzählen des Strickers gegenüber, in dessen Erzählungen am Ende jegliches Chaos und Grauen (Groteskes?) wieder in eine gewisse Ordnung überführt wird.14 Der letzte Punkt der Sinnlosigkeit, die Grubmüller ebenfalls mit dem Grotesken in eins zu setzen scheint, ist ihm bei Hans Rosenplüt erreicht; in der Erzählung Der fahrende Schüler sei kein Sinn mehr zu finden, – sie zeige nur das Sinnlose als „Zeichen einer aus den Fugen geratenen Welt, einer Welt, die sich dem ordnenden Zugriff entzieht und nur noch in ihrer grotesken Vereinzelung anschaubar wird.“15 Damit stellt auch Grubmüller letzten Endes seine Beobachtungen in einen kulturgeschichtlichen Kontext. Den angesprochenen Punkt sieht er im 15. Jahrhundert als erreicht an; das von ihm auf Mitte des 14. Jahrhunderts datierte Märe Die drei Mönche zu Kolmar sei „isoliert und noch scheinbar folgenlos, aber in die Zukunft vorausweisend“.16
Den Arbeiten Grubmüllers gegenüber verfolgt die vorliegende Studie einige abweichende Ziele:
1)Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Entwicklung der Gattung, sondern auf dem Auftreten des Grotesken. Durch eine intensive Beschäftigung mit den Texten unter der Berücksichtigung weiterer Ansätze zur Definition des Grotesken wird erhellt, welche Formen das Groteske in einer allgemein als grotesk-affin bewerteten Textgruppe annimmt.
2)Eine größere Durchschlagskraft erhält die Argumentation durch die breitere Einbeziehung romanischer Texte, begründet durch deren formale und stoffliche Bedeutung für die Ausformung der Novellistik, aber auch des Grotesken.17
3)Durch eine Auffassung der Präsenz des Grotesken als auch vereinzelt auftretender Elemente sowie eine stärkere Miteinbeziehung der anderssprachigen Literaturen ergibt sich ein anderes Bild des chronologischen Verlaufs. Dabei sind die Möglichkeiten, eine konsistente Abfolge der Ausbildung der Novellistik darzustellen, durch die Zufälle der Überlieferung ohnehin stark eingeschränkt. Eine gattungsgeschichtliche Argumentation wird somit nur bei vorsichtiger Interpretation der Datierungen auf der Basis der Überlieferung erfolgen.18
Frühe Arbeiten zum Grotesken
Die Forschungsgeschichte zum Grotesken in der Literatur beginnt mit den Arbeiten Mösers und Flögels.19 Beide Werke behandeln das Groteske als Erscheinungsform des Komischen. Als Untersuchungsgegenstand wählt Möser die Commedia dell’arte, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in Italien aufgeführt wurde. Flögels Studie ist dagegen „zum größten Teil den Erscheinungsformen der mittelalterlichen Groteske gewidmet“20, dabei aber hauptsächlich in ihren nichtliterarischen Ausprägungen. Die etwa hundert Jahre später erschienene Arbeit des Romanisten Heinrich Schneegans21 enthält dagegen u. a. ein Kapitel mit dem Titel „Die Keime der grotesken Satire im Mittelalter“22, in dem sich der Verfasser auch mit dem Fabliaux-Dichter Rutebeuf auseinandersetzt.
Wolfgang Kayser23 dagegen nähert sich dem Grotesken über die Etymologie und schließt daher alle vorneuzeitlichen Zeugnisse als Untersuchungsgegenstand aus.24 Er konzentriert sich auf die Epochen von Romantik und Moderne und analysiert v.a. Werke von E.T.A. Hoffmann, Gottfried Keller und Franz Kafka.25
Das Groteske als kritische Äußerung einer Volkskultur bei Michail Bachtin
In Absetzung zu Kayser wird das komische Element durch den russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin wieder stark gemacht.26 Für ihn stehen Verkehrung und Degradierung im Zentrum seines Konzepts des Karnevalismus, dessen wichtigster Bereich die mittelalterliche Groteske ist. Er geht von dem viel interpretierten Romanzyklus Gargantua und Pantagruel des Renaissance-Autors François Rabelais aus. Um diesen richtig zu verstehen, bedürfe es der Kenntnis seiner mittelalterlichen Grundlagen, der Volks- und Lachkultur, deren Ästhetik das Groteske und vor allem die groteske Körperkonzeption darstelle. Diese seien das Ergebnis einer dichotomen Kulturstruktur: Bachtin stellt der offiziellen Kultur, worunter er die herrschende Schicht und den hohen Klerus versteht, die die kulturelle Ausrichtung der Gesellschaft bestimmt hätten, die Volkskultur als Gegenkultur gegenüber (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1
Diese Gegenkultur äußere sich vor allem im Karneval, dessen Entstehung aus heidnischer Tradition Bachtin annimmt. Er sei, wie auch die römischen Bacchanalien, ein Beispiel für rituell-szenische Formen, die seiner Auffassung nach gemeinsam mit Formen der familiären Rede und komischen Texten die drei „Ausdrucksformen der volkstümlichen Lachkultur“27 darstellen. Diese Ausdrucksformen beeinflussten sich dabei gegenseitig: Für die volkstümlichen Feste sei die Aufhebung der Grenze zwischen Spieler und Zuschauer und auch die Logik der Umkehrung (des Auf-den-Kopf-Stellens) zentral. Ihren kollektiven Charakter gewännen sie aus dem Karnevalslachen, das nicht als individuelle Reaktion zu verstehen, sondern universal, d. h. auf alle und alles gerichtet, und überdies ambivalent, nämlich heiter und spöttisch zugleich sei. Die komischen Texte wüssten dagegen von der Festtagsfreiheit zu profitieren, sie erzeugten ambivalentes Lachen; dabei denkt Bachtin u. a. auch an die französische Versnovellistik: „Das Karnevalslachen klingt auch aus dem Fabliau und der Lachlyrik der Vaganten.“28 Die Formen der familiären Rede richteten sich gegen die von der offiziellen Kultur vorgegebenen Verhaltensregeln, was sich z. B. in Schimpfkanonaden zeige. Sie fungierten als Teil sowohl der rituellszenischen Formen, also bei Festen wie dem Karneval, als auch der komischen Texte:
Schimpfworte, Grobheiten, Flüche und Obszönitäten […] werden immer als wissentlicher Verstoß gegen die sprachlichen Normen bewertet, als eine bewußte Weigerung, die Redekonventionen einzuhalten, sich an Etikette, Höflichkeit, Respekt, Anstand und Rangordnung zu orientieren.29
Daraus ergebe sich das ästhetische ‚Konzept‘ der volkstümlichen Lachkultur, das Bachtin auch als grotesken Realismus bezeichnet. Ohne die Kenntnis dieser historisch-gesellschaftlichen Gegebenheiten kann seiner Darstellung zufolge die gesamte Literatur der Renaissance nicht verstanden werden. Die zentralen Eigenschaften des grotesken Realismus seien Einheitlichkeit, Degradierung und Ambivalenz.
Einheitlichkeit bedeute die Auffassung des Komischen, Sozialen und Körperlichen und somit des Volkskörpers der volkstümlichen Lachkultur als Einheit. Im Gegensatz zu späteren Ästhetiken, v.a. der sogenannten klassischen Ästhetik, sei der groteske Realismus nicht körperfeindlich. Die groteske Körperkonzeption zeige gerade keine abgeschlossenen Körper. Sie betone diejenigen Körperteile, die entweder für die äußere Welt geöffnet sind, d. h. durch die die Welt in den Körper eindringen oder aus ihm heraustreten kann, oder mit denen er selbst in die Welt vordringt, also die Öffnungen, die Wölbungen, die Verzweigungen und Auswüchse: der aufgesperrte Mund, die Scheide, die Brüste, der Phallus, der dicke Bauch, die Nase.30 Die „Grenze zwischen zwei Körpern oder Körper und Welt“31 werde u. a. durch Essen, Trinken, Verdauung und Beischlaf überwunden. Als Quelle für Festmahlmotive nennt Bachtin „einen populären Legendenzyklus, der von einem utopischen Land der Völlerei und des Nichtstuns handelte“32; dazu zähle auch das Fabliau Pay de cocagne.33
Die Degradierung werde durch die in der mittelalterlichen Raumvorstellung begründete starke Hierarchisierung in Oben und Unten verursacht: je höher sich etwas befinde, desto näher sei es dem Ersten Beweger. Als körperliche Repräsentanten des Hohen gälten bspw. Himmel, Kopf und Gesicht. Degradierung bedeute in der Folge Annäherung an die Erde und Umkehrung. Sie könne jedoch auch ideell erfolgen, „in der Übersetzung alles Hohen, Geistigen, Idealen und Abstrakten auf die materiell-leibliche Ebene, in die Sphäre der untrennbaren Einheit von Körper und Erde.“34 Ein Beispiel dafür sei die Gefräßigkeit und Lüsternheit der Geistlichen, wie sie auch in Rabelais‘ Figur Frère Jean durchgespielt werde:
In der lateinischen Unterhaltungsliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts sind die Festmahlmotive und die Motive, die mit der Zeugungskraft zu tun haben, gewöhnlich um die Figur des Mönchs zentriert, der als Säufer, Vielfraß und Lüstling dargestellt wird.35
Die Ambivalenz des grotesken Realismus äußere sich in mehreren Bereichen: Sie werde von der verschlingenden und gebärenden Erde, von Bauch, Hintern und Geschlechtsorganen vertreten, gelte aber auch für die Zeit, die für Altes und Neues, Sterbendes und Entstehendes stehe. Die Zeit werde ambivalent repräsentiert von Koitus und Zerfall, Schwangerschaft und Alter. Dies stehe wiederum dem klassischen Ästhetikbegriff des fertigen und vollendeten Lebens entgegen. Ambivalenz in der Sprache klinge auch in den Superlativen der Marktschreier mit an, in denen der Fluch und die Beschimpfung stets mitschwängen: „Sie sind zu jedem Moment bereit, ihre Kehrseite zu zeigen, d. h., sich in Verwünschungen und Beschimpfungen zu verwandeln.“36 Aus dem Inhalt der Flüche bei verschiedenen Gliedern von Heiligen und Märtyrern leitet Bachtin als typisches Thema des Fluches die Zerstückelung ab. Deren Nähe zur Küchensphäre führe wieder zum Marktplatz und zum grotesken Körper. Für Schläge gelte innerhalb des grotesken Realismus dieselbe ambivalente Bedeutung wie für Beschimpfungen.
Die Rolle des Lachens ist folglich für das Verständnis des grotesken Realismus zentral: Das Lachen komme erst mit dem Erstarken der Volkssprachen aus dem Bereich des Inoffiziellen heraus: „Das Vordringen der Volkssprache in die Literatur und einige andere Bereiche der Ideologie hob den Unterschied zwischen offizieller und nichtoffizieller Rede für eine gewisse Zeit auf oder milderte ihn zumindest.“37 Die Lachtheorie der Renaissance stamme aus der Antike, die Lachpraxis aus dem Mittelalter. Im Mittelalter sei das Lachen noch aus dem offiziellen Kirchen- und Feudalstaatsbereich verbannt gewesen. Es habe jedoch stets auch Ausnahmen gegeben, wie groteske Darstellungen in Legendaren, von der Kirche legitimierten Festen, aber auch solche literarischer Art. So sei konventionsloses Erzählen möglich im Karneval wie auch angesichts der Pest: „Das Decamerone ist die italienische Vollendung des – allerdings bei Boccaccio relativ gemäßigten – grotesken Realismus.“38
Bachtin behandelt das Groteske als ein Ausdrucksmittel der Volkskultur, die sich gegen die offizielle Kultur der Adelsherrschaft und der Kirche richte. Das Groteske leiste die Enttabuisierung der durch die offizielle oder klassische Kultur aufgestellten Tabus. Teil der Lachkultur, die den Angehörigen der Volkskultur eine Befreiung von der propagierten Ernsthaftigkeit verschaffen soll, seien Schilderungen von Zerstückelungen und Gewaltausbrüchen, von skatologischen und obszönen Szenen.
Dass auf der Grundlage von Bachtins Groteske-Konzeption Werke der mittelalterlichen Literatur analysiert werden können, hat z. B. Jean-Paul Soule-Tholy für das deutsche Fastnachtspiel gezeigt.39 Dennoch muss der Einwand erhoben werden, dass Bachtins in Rabelais und seine Welt gezogene Schlüsse des Öfteren apodiktisch erscheinen. Er führt außer dem Werk Rabelais‘ nahezu keine direkten Zeugnisse für seine Beobachtungen an. Dies bezieht sich auch auf den für diese Arbeit interessanten Bereich der mittelalterlichen Literatur: Bachtin nennt zwar die Fabliaux als Belege für seine Thesen, liefert aber keine Interpretation eines mittelalterlichen Textes. Sein Zugang sind neben dem Karneval, über dessen genaue Formen vor dem 15. Jahrhundert die Quellen nahezu keine Auskunft geben, v.a. sonstige volkstümliche Feste oder auch der ‚risus paschalis‘. An diesen richtet er seinen Entwurf von Lachkultur und Volkskultur aus.
Aus der eingeschränkten Auswahl von literarischen Quellen, anhand derer er seine Thesen entwirft, ergibt sich für die Arbeit mit Bachtins Groteske-Konzeption eine gewisse Einengung, die den meisten mit Bachtin operierenden Arbeiten eigen ist.40 Auf seine Beobachtungen zum Grotesken als einer ästhetischen Kategorie, die bevorzugt von Gegenkulturen eingesetzt worden sei, wird dennoch mehrfach verwiesen.
Versöhnung der Vorläufer bei Peter Fuß
Der letzte große Entwurf zur Konzeption des Grotesken stammt von Peter Fuß.41 Er wirft seinen Vorgängern v.a. vor, den Begriff des Grotesken jeweils zu stark eingeschränkt verwendet zu haben, indem sie ihn als nur satirisch-didaktisch, unheimlich-verstörend, obszön-subversiv oder aufrüttelnd etikettierten.42 Das Verbindende der vorgenannten Ansätze bestehe darin, dass das Groteske ein ambivalentes Phänomen sei, das, wenn auch auf verschiedene Weise, „Brüche mit je spezifischen Aspekten ihrer Kulturordnung“43 darstelle.
Die Funktion des Grotesken sei stets die groteske Liquidation symbolisch kultureller Ordnungsstrukturen, deren Ergebnis eine Veränderung der Gesellschaft sein könne und somit deren Verkrustung verhindere.44 Das Groteske liquidiere drei kulturell instituierte Ordnungen: 1. die Verhaltensordnung, nämlich Sitte, Moral und Recht; 2. die Sprachordnung, da sich der Gegensatz apollinisch-klassisch – dionysisch-grotesk auch in der Sprache manifestiere; und 3. die Erkenntnisordnung: Das Groteske behandle die Konventionen der Erkenntnis wie alle anderen Konventionen: so als ob sie „auch anders möglich wären.“45 Nach Fuß‘ Auffassung findet vom Mittelalter zur Aufklärung hin eine Verschiebung der Priorität der Verhaltensordnung hin zur Erkenntnisordnung statt, dergestalt, dass sich der mittelalterliche Mensch vor allem davor gefürchtet habe, bei einem Verstoß gegen Sitte und Moral ertappt zu werden, während ein Vertreter der Aufklärung seinerseits in erster Linie besorgt gewesen sei, dass ihm ein Verstoß gegen die Logik nachgewiesen würde.
Als entscheidenden Vorgang des Grotesken arbeitet Fuß die Anamorphose heraus. Deren Hauptmechanismen seien Verkehrung, Verzerrung und Vermischung, ihre Produkte das Inverse, Monströse und Chimärische. Die inverse Anamorphose stelle die einfachste Technik dar, da hierbei stets ein Bezug zum Ausgangszustand Komponente in Bachtins Konzept; er schwäche das Groteske zum Ventil ab – „ein Ventil hat jedoch ordnungsstabilisierende Funktion.“ (S. 78). Als Ventil könnte es von der Obrigkeit eingesetzt worden sein, so wie z. B. Dietz-Rüdiger Moser in seiner stark umstrittenen Position zum Karneval als von der Kirche instituiertes Fest annimmt (z. B. in: Fastnachtsbrauch und Fastnachtsspiel im Kontext liturgischer Vorgaben, in: Klaus Ridder [Hg.], Fastnachtspiele. Weltliches Schauspiel in literarischen und kulturellen Kontexten, Tübingen 2009, S. 151–166), das die civitas diaboli nach Augustinus‘ Lehre von den zwei Reichen darstellt. Die Möglichkeit zur Triebabfuhr des Volkes ist dann der angenehme Nebeneffekt; jedenfalls spricht Moser der Fastnacht jeden archaisch-paganen Ursprung im Sinne Rainer Warnings (bezogen auf das geistliche Spiel: Rainer Warning, Funktion und Struktur – Die Ambivalenzen des geistlichen Spiels [Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste Bd. 35], München 1974) ab. Pietzcker hingegen zeigt nach Fuß durch seinen Versuch, das Groteske vom Absurden zu unterscheiden, dass er beide als ähnliche Phänomene sehe. Er komme wieder zu einer Annäherung ans Satirische. Für ihn sei das Groteske eine Erwartungsenttäuschung – auch i.S.v. sittlich-moralischen Verhaltensnormen. erkennbar bestehen bleibe. Aus diesem Grunde sei die Verkehrung ein beliebtes satirisches Stilmittel.46 Komplexere Verkehrung sei beispielsweise in rituellen Inversionen wie dem Karneval zu finden, anlässlich dessen üblicherweise ernsthaft konnotierte Orte durch die Komik okkupiert würden. Während die Satire aber stets nur gleichermaßen dogmatische Positionen austausche, werde durch das Groteske keine Entscheidung getroffen und somit ein Anreiz zur Reflexion und zur Ablehnung und Abschaffung des entsprechenden Dogmatismus gegeben.47
Die monströse Anamorphose wirke grotesk durch Änderung der gewohnten Dimensionen. Ihre einfachsten Formen seien Vergrößerung und Verkleinerung; die komplexe Verzerrung dagegen bewirke eine Veränderung der Proportionen. So sei die Deformation ein groteskes Ergebnis von monströser Verzerrung. Diese stelle aber eine Abweichung von der Norm dar, wodurch wiederum die Willkürlichkeit der Festsetzung von Normen gezeigt werde.
Wie die Verkehrung dienen jedoch Vergrößerung und Verkleinerung nicht ausschließlich der Liquidation kultureller Ordnungsstrukturen, sondern auch ihrer Stabilisation durch die Konstruktion des Fremden, in der eine Kultur sich konstituiert, indem sie sich von ihm abgrenzt.48
In der chimärischen Anamorphose werden mehrere Objekte vermischt. Sie kann die verschiedensten Bereiche betreffen, z. B. auch kulturelle Formationen.49 Durch den Rückgriff auf die Vergangenheit, der auf die aktuelle Kultur treffe, sei beispielsweise die Renaissance eine Mischkultur. „Sie entsteht durch das ‚Recycling’ der Elemente kultureller Formationen, die bereits auf dem Abfallhaufen der Geschichte gelandet waren.“50
Die verschiedenen anamorphotischen Techniken haben nach Fuß unterschiedliche Verwendungsweisen; so werde die Verkehrung eher auf gesellschaftliche Strukturen angewandt, die Verzerrung dagegen eher auf Einzelpersonen: „Während die Verkehrung vor allem dichotomische und hierarchische Strukturen und die Verzerrung in erster Linie Hierarchien, Normen und Maßstäbe liquidiert, liquidiert die Vermischung kategoriale Strukturen.“51
Bei alledem sieht Fuß im Grotesken eine komische Kategorie, er meint „eine schwindelerregende Form des Komischen.“52 Das Lachen übers Groteske sei ein Lachen, bei dem man sich nicht sicher sein könne, ob es erlaubt ist zu lachen. Es stehe damit in der Nähe des schwarzen Humors.
Eine mediävistische Stimme: Walter Blank zu einem Reinmar-Gedicht
Walter Blanks relativ wenig beachteter Aufsatz Zur Entstehung des Grotesken53 ist m.W. der erste Beitrag aus der germanistischen Mediävistik zur Diskussion um das Wesen des Grotesken. Am Beispiel des Gedichts Und solt ich mâlen einen man von Reinmar von Zweter54, in dem ein Mann durch tierische Attribute beschrieben wird und das dadurch grotesk erscheinen könne, zeigt Blank, dass dieses Stilmittel dem mittelalterlichen Rezipienten wohl als allegorisch geläufig gewesen sei: Die Beschreibung der möglichen grotesken Abweichungen eines Bildes von der Erfahrungswelt zeige „Gestaltungsmittel, deren sich Groteske bedient, und führt zur Struktur der Bildebene, aber noch nicht zum Grotesken selbst.“55 Um daraus zum Grotesken zu werden, müsse ein Bewusstseinsvorgang umgesetzt werden, der gesellschaftsbezogen sei: „Eine allgemeingültige groteske Struktur und Beurteilung gibt es daher nicht, da der jeweilige Bewußtseinsstand sich ändert.“56 Das groteske Bild eines mit tierischen Merkmalen versehenen Mannes werde im mittelalterlichen Bewusstsein nicht als grotesk empfunden, da es als allegorisch verstanden wird.
Damit ist klar, dass eine Vermischung von Sachbereichen nicht zur Eingrenzung des Phänomens des Grotesken genügt; es bedarf der Vermischung von Darstellungsebenen (Assoziationsbereich, Erwartungshorizont): „Die Folge davon ist der Verlust der Orientierung des Lesers.“57 Damit möchte Blank nichts über Sinn und Funktion des Grotesken, sondern nur über dessen Erscheinungsmöglichkeit aussagen.
Reinmar kündigt in seinem Gedicht Und solt ich mâlen einen man allerdings die Beschreibung des Mannes explizit als „wunderlich getân“ (V. 2) an. Außerdem existiert eine spätere Fassung, in der die allegorische Erklärung jeweils nachgereicht wird.58 Dass eine solche Fassung nötig geworden ist, könnte darauf schließen lassen, dass allegorische Darstellungen nicht mehr ohne Weiteres verstanden wurden.
Zusammenfassung der Positionen und Verhältnis zur Komikforschung
Auch wenn die skizzierten Grundpositionen sich in Vielem unterscheiden, gibt es doch in den verschiedenen Konzeptionen immer wieder Übereinstimmungen. So geht es letztlich Bachtin um ein Hinterfragen der herrschenden Ordnung, so wie auch Grubmüller eine Auflösung derselben konstatiert. Fuß‘ Techniken der Verkehrung und Verzerrung werden auf unterschiedliche Art und Weise in allen Konzeptionen angesprochen, besonders explizit bei Bachtin; die Technik der Vermischung findet sich in Kaysers Chimären und Fledermäusen ebenso wie in Blanks Reinmar-Gedicht.
Gemeinsam ist den meisten Konzeptionen auch, dass in ihnen das Groteske als Teil des Komischen gesehen wurde.59 Um die Nähe mancher Position aus der Groteskeforschung zu solchen der Komikforschung zu belegen, werden im Folgenden einige Übereinstimmungen vorgestellt.
Wie bei Bachtin und Fuß spielt auch in der Arbeit Henri Bergsons zum Lachen die Empathielosigkeit gegenüber den komischen Figuren eine zentrale Rolle, könne das Komische nur empathielos genossen werden: „Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion. […] Le comique […] s’adresse à l’intelligence pure.“60 Wie das Groteske bedürfe es einer sozialen Einbettung, also der Gesellschaft: „Le comique naîtra, semble-t-il, quand des hommes réunis en groupe dirigeront tous leur attention et exerçant leur seule intelligence.“61 Die groteske Technik der Verzerrung wird laut Bergson in der Darstellung komischer Physiognomie durch einen Karikaturisten verwendet: „Peut devenir comique toute difformité qu’une personne bien conformée arriverait à contrefaire.“62 Auch das Prinzip der verkehrten Welt wird als Möglichkeit des Komischen angesprochen: „C’est ainsi que nous rions du prévenu qui fait de la morale au juge, de l’enfant qui prétend donner des leçons à ses parents, enfin de ce qui vient se classer sous la rubrique du ‚monde renversé‘.“63 Die verbreitete Vorstellung, Komik bedeute immer Degradierung, ist nach Bergson auf das Mittel der Parodie zurückzuführen: „C’est sans aucun doute, le comique de la parodie qui a suggéré à quelques philosophes […] l’idée de définir le comique en général par la dégradation.“64
Auch Joachim Ritter, der sich in seiner 1940 erschienenen Schrift Über das Lachen65 mit allen Phänomenen des Komischen und des Humors befasst, erkennt im Lachen einen Zusammenhang mit der Gewalt. „Das Lachen erscheint als Ausdruck der Brutalität, die sich über den Menschen und die gute Welt erheben will.“66 Der Anlass zum Lachen sei ebenso wenig per se heiter wie das Ende einer lustigen Erzählung zwangsläufig gut. Über die Frage nach dem Anlass des Lachens, den er in der Begegnung mit dem Lächerlichen lokalisiert, kommt Ritter zu dem Schluss, dass das Lächerliche immer eine Negation des Bekannten bzw. ein dem Bekannten Entgegenstehendes sei. Die Versuche, das Lächerliche und mit ihm das Lachen „aus dem Wesen des Kontrastes und aus der Lust am Kontrast und am Ausspielen des Kontrastierenden herzuleiten“, scheinen es als „Zeichen der Lust am Nichtigen und an der Verneinung“67 zu erweisen. Das Lächerliche ist
nie das Geordnet-Vollendete oder das für das Dasein je Maß gebende Schöne und Gute, sondern immer von der Art dessen […], was herausfällt, dem Gehofften und Erwarteten entgegenläuft, was aus der Reihe tanzt und das, was sein will oder soll, zum Schein macht als das dem Ernst und der allgemeinen Ordnung der Dinge schlechthin Entgegenstehende.68
Als Mittel der Komik nennt Ritter „die Übertreibung, die Situationsverschachtelung, die Verzerrung, die Verwechslung und Verkehrung“69. Dazu scheint er auch die Mischung verschiedener Bereiche zu zählen, besonders anständiger und nichtanständiger. Wieder hängt das Unanständige vom Anständigen ab, d. h. die Frage nach dem Einen kann nur abhängig vom Anderen beantwortet werden. Die Aufgabe des Lachens ist somit, das Nichtige als zum Wesentlichen gehörig sichtbar zu machen.
Ritters Schüler, Odo Marquard, arbeitet mit dessen Komikkonzeption in seinem Aufsatz Exile der Heiterkeit und bewegt sich damit in ähnlichen Bereichen wie Bachtin mit seiner Dichotomie von offizieller und inoffizieller Kultur.70 Letztlich stellt Marquard darin die Kunst als einzige Fluchtmöglichkeit der Heiterkeit heraus: „Wo die Wirklichkeit offiziell zum nur noch Ernsten wird, emigriert ihre Heiterkeit in jenen Teil dieser Wirklichkeit, der kompensatorisch – sozusagen hilfsweise und statt dessen – ihre Heiterkeit bewahrt: in die Kunst.“71 Die Kunst muss die Wirklichkeit einschließen, und sie verfremdet sie auf unernste Weise „dadurch, daß die Kunst das, was in der Wirklichkeit des offiziellen Ernstes nichts gilt und das Nichtige ist, geltend macht, und indem sie das, was in dieser Wirklichkeit offiziell alles ist und totale Geltung beansprucht, in dieser totalen Geltung negiert.“72 Damit schaffe das Lachen einen inoffiziellen Raum, der von der ernsthaften Kritik bekämpft wird.
Hans-Robert Jauss nimmt eine Unterscheidung in gegenbildliche und groteske Komik vor und folgert, dass Erstere eine Herabsetzung des Idealen betreibe und somit eine Identifikation mit dem Helden „gegenüber dem Druck der Autorität als Entlastung, als Protest oder auch als Solidarisierung“ erfahrbar mache, Letztere dagegen durch die „Heraufsetzung des Kreatürlichen und Materiell-Leiblichen“ die Möglichkeit zur Identifikation mit dem Helden biete:
Die komische Katharsis ist dort als ersparter Gefühlsaufwand, hier als Intensitätsgewinn aus der Freisetzung unterdrückter Natur erklärbar; sie ist dort durch distanzschaffende Imagination vermittelt, hier durch distanzaufhebende Partizipation gefördert.73
Das sich aus der komischen Situation ergebende Lachen unterscheide sich durch die Gerichtetheit des Lachens: man lache über den Helden der gegenbildlichen Komik, aber mit dem Helden der grotesken Komik. Als Beispiele für diese grotesken Helden, die einen „Gegenpol zu Freuds Theorie des Lustgewinns aus erspartem Gefühlsaufwand“ bildeten, nennt Jauss u. a. „die unbefangenen Narren der mittelalterlichen Sotien“74.
Diese Einbettung des Grotesken in den Bereich des Komischen unterstützt auch Hermann Helmers, der das Groteske sogar neben der Verfremdung und dem Komischen im engeren Sinne als Kategorie des Komischen im weiteren Sinne sieht:75
Das Komische (im weiteren Sinne)
Das Komische (im engeren Sinne)
Das Groteske
Die Verfremdung
Er deutet das Groteske als Versuch, einen Zusammenhang zwischen dem Chaotischen in der Welt und dem spielerischen Auflösen der Ordnung herzustellen.76 Damit versucht er eine Antwort auf die Frage Wolfgang Kaysers nach der Rolle des Lachens im Grotesken zu geben.
*
Das Groteske teilt mit dem Komischen die Techniken der Darstellung: Die von Fuß zusammengestellten Techniken der grotesken Anamorphose (Vermischung, Verkehrung und Verzerrung) werden in Teilen immer wieder in den Komiktheorien genannt. Auch der kritische Bezug zur Gesellschaft ist beiden eigen: Ritter und Bergson betonen jeweils die Bedeutung des Gesellschaftlichen für den Witz oder das Lachen; dies trifft auch für das Groteske zu, das stets dazu tendiert, gegen gesellschaftliche Ordnungen zu verstoßen. Auch die von Bergson postulierte Mitleidslosigkeit ist für das Vergnügen an den teilweise grausamen Formen des Grotesken elementar.77 Besonders zu berücksichtigen ist für die Komik ebenso wie für das Groteske das Moment der Ambivalenz. Weder wäre das Komische weiter bemerkenswert, wenn es zu einem heiteren, unbeschwerten Lachen führte, noch das Groteske, wenn es stets nur das von Kayser in den Texten Bonaventuras und Kafkas festgestellte Grauen verursachte.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass das Groteske entscheidende Charakteristika mit dem Komischen teilt, die es erlauben, das Groteske als komische Kategorie aufzufassen. Dies betrifft neben den Techniken der Darstellung auch seine die Gesellschaft in Frage stellende Funktion. Das Groteske hebt sich aber vom nur Komischen durch seine Intensität ab: Diese kann durch stärkere Verzerrung oder durch größere Unvereinbarkeit der mit Hilfe der Vermischung zusammengestellten Bereiche ausgedrückt sein. Auch eine vermeintliche Zielungerichtetheit zeichnet das Groteske im Vergleich zum Komischen aus: Das Groteske kann Hierarchien sowohl stützen als auch stürzen; aus der Inversion des Verkehrten ergibt sich nicht zwangsläufig die Norm.
1.2Elemente des Grotesken
Die Auseinandersetzung mit den Vorläufern bereitet den Boden für die in dieser Arbeit unternommene Untersuchung, wo sich Elemente grotesken Erzählens in der Versnovellistik des Mittelalters, also einer mehr oder weniger klar umrissenen Textgruppe finden lassen.
Aus der Betrachtung verschiedener Forschungspositionen zum Grotesken ergibt sich, dass jeweils andere Charakteristika eines sprachlichen Kunstwerks dafür verantwortlich gemacht werden, dass es grotesk genannt wird. Grubmüller versteht unter dem Grotesken hauptsächlich ausufernde Gewaltdarstellungen, Chaos und Brutalität. Für Kayser ist das Groteske v.a. durch bildliche Parallelen beschreibbar wie durch bestimmte Tiere oder Fabelwesen. Beispiele Bachtins aus seinem Referenzwerk Gargantua und Pantagruel sind die Thematisierung von sonst verdrängten Bereichen, eine dezidierte Körper-Freundlichkeit sowie Hyperbolik und Übertreibung, auch und besonders in der Sprache. Blank diskutiert das Changieren zwischen Groteske und Allegorie anhand eines Reinmar-Gedichts, in dem ein Mensch durch Tiervergleiche beschrieben wird.
Es muss sich im Folgenden zeigen, welche diesen ähnliche Erzählformen sich in der Versnovellistik finden. Die von Grubmüller angeführten Fälle von Gewalt und Brutalität, die sich teils in ihrer Intensität, teils durch immer neue Wendungen steigern, lassen sich in der Tat in vielen Mären und Fabliaux finden. Auch die von Bachtin bei Rabelais gefundenen Thematisierungen des grotesken Körpers spielen als Beschreibungen des Sexuellen, Obszönen oder Fäkalen auf vielfältige Weise eine Rolle in zahlreichen mittelalterlichen Kurzerzählungen. Anders verhält es sich bei dem von Kayser und Blank geschilderten Chimärischen; dieses wird von Fuß zur Technik der Vermischung abstrahiert und dadurch zur Beschreibung mancher Erzählformen im untersuchten Corpus brauchbar. Ein ebenfalls bei Rabelais zu findendes Element ist der komisch-respektlose Umgang mit dem Christentum als besonders wichtigem Teil der Ordnungsstruktur mittelalterlicher Gesellschaften und damit auch eine Bestätigung von Fuß‘ These, das Groteske liquidiere „Hierarchien, Normen und Maßstäbe“78.
Als Folgerung aus dem vorstehenden Kapitel wird das Groteske hier in möglichst offener Weise als Form der mittelalterlichen Komik verstanden, die für einen Ordnungsverstoß steht, der auf verschiedene Weise (Verkehrung, Verzerrung, Vermischung/Degradierung) erfolgen kann, an dessen Ende aber zumeist entweder eine neue Ordnung entsteht oder die alte restituiert wird: „Es ist Teil jener Ordnung, deren (immanente) Dekomposition es betreibt. Es ist zugleich diesseits und jenseits der Grenzen seiner kulturellen Formation.“79
Die jeweilige Funktion der grotesken Elemente ist dabei nicht festgelegt: Sie werden auch in satirischen Texten verwendet, also in Texten, denen eine lehrhafte Intention zuzuschreiben ist.80 So scheint bspw. der Grobianus Friedrich Dedekinds (deutsche Übersetzung: Caspar Scheidt) unter dem Deckmäntelchen des Satirisch-Moralischen Gefallen an der Anpreisung des Unmoralischen zu finden: „Die Vermutung liegt nahe, daß die Behauptung einer moraldidaktischen Intention eine Markierung der Lust am Amoralischen ist, eine Schutzbehauptung, die erlaubt, ungestraft das Tabuisierte darzustellen.“81
Die Wirkung des Grotesken ist eine jeweils andere, je nachdem, ob sie die Verhaltensoder die Erkenntnisordnung in Frage stellt. Im ersten Fall handelt es sich laut Fuß um eine karnevalesk-grobianische Groteske, im zweiten Fall um eine absurdistisch-phantastische Groteske.82 „Die religiöse Kulturformation des Mittelalters, das Dekompositionsobjekt der Renaissancegroteske, schrieb den Normen des Verhaltens eine höhere Dignität zu als den Regeln des Erkennens.“83
Das Handeln gegen die Norm ist laut Joachim Ritter und Odo Marquard auch für das Komische konstitutiv. Ute von Bloh argumentiert in ihrer Untersuchung zu den Mären Nonnenturnier und Frauenturnier mit Slavoj Žižek dahingehend, dass das gelegentliche Übertreten der Ordnung für die Konstitution einer „einheitlichen“ Gesellschaft mindestens ebenso wichtig sei wie deren Einhaltung:
Es ist nämlich nicht so sehr die Identifikation mit dem öffentlichen Gesetz, die für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft sorgt, sondern mehr noch leistet dies die „Identifikation mit einer besonderen Form der Überschreitung, der Aussetzung des Gesetzes“.84
Diese Position kann für die Bewertung sowohl der Komik als auch der mittelalterlichen Novellistik bzgl. ihres didaktischen Anteils übernommen werden. Entgegen den Arbeiten von Suchomski und Strasser85 und der bestätigenden Aussage Heinzles, nach der „die Mären prinzipiell didaktisch ausgerichtet seien”86, scheint mir in der Mehrzahl der von Fischer ausgewählten Mären die Didaxe zumindest nicht im Vordergrund zu stehen. So sah es auch bereits Friedrich Heinrich von der Hagen, der sich im Vorwort zu seinem Gesammtabenteuer für die „unumwundenen Darstellungen“ entschuldigte: Die Zusammenstellung wolle nichts lehren: „sie enthält sich daher auch der verwandten Spruchgedichte und Fabeln.“87
Die Grundlage einer ersten Textbetrachtung der Mären bilden die verschiedenen Konzepten eignenden Gemeinsamkeiten, die sich in Anlehnung an Fuß in die drei Mechanismen der Anamorphose von Verkehrung, Verzerrung und Vermischung einordnen lassen. Die hieraus abgeleiteten grotesken Elemente werden zu Gruppen zusammengefasst, die die Möglichkeit zu einer Sortierung der weiteren europäischen Versnovellistik auf der Grundlage der an den Mären gemachten Beobachtungen bieten. Die Thematik der jeweiligen Gruppe wird als mögliche Realisierung des übergeordneten Prinzips des Grotesken verstanden.
Allerdings ist für das Groteske nicht nur wichtig, was, sondern auch wie erzählt wird: Das Groteske ist eine Kategorie, die „die klassische Unterscheidung von Form und Inhalt unterläuft“88. So kann die Schilderung einer Liebesszene auf groteske Weise erfolgen, oder auch nicht, Gleiches gilt für Gelage oder Schlachten. Es kommt grundsätzlich auf die Ausschmückung an, auf die Verwendung von obszönen Metaphern, auf wiederholendes insistierendes Erzählen oder die Verbindung von verschiedenen, nicht zueinander passenden Bereichen. Nur manche Motive wie zum Beispiel ein sprechendes oder wandelndes Geschlechtsorgan sind dagegen per se als grotesk zu identifizieren.
Die im Folgenden dargestellten Motiv-Gruppen des Grotesken sind das Ergebnis einer intensiven Lektüre der Primärtexte unter Rückgriff auf die entsprechende Forschung und deren Stellungnahmen zum grotesken Charakter bestimmter Motive. Sie bilden jeweils die Unterkapitel zu den drei Hauptkategorien. Eine Zuordnung zu einem der drei anamorphotischen Prinzipien ist dabei aber keine ausschließliche Festlegung auf nur dieses: Auch in Erzählungen mit obszön verzerrender Thematik können Elemente der grotesken Verkehrung enthalten sein.
Folgende Motive werden, bei Verwendung als Mittel der Komik, zum Grotesken gezählt: Der Teilbereich der Verkehrung wird v.a. durch Motive repräsentiert, die dem Bereich der verkehrten Welt angehören; sie finden sich vorrangig in Erzählungen von Frauen, die sich gegen die Herrschaft des Mannes und damit eine weitgehend gültige gesellschaftliche Norm auflehnen.
Der Teilbereich der Verzerrung wird durch vier Untergruppen repräsentiert, in denen sich Erzählmotive versammeln, die jeweils gesellschaftlich tabuisierte Abläufe thematisieren und diese dabei zugleich in hyperbolischer Weise schildern. Es handelt sich im Einzelnen um die Völlerei, die v.a. bei Frauen und Geistlichen als Beleg ihrer vermeintlich ungenügenden Triebbeherrschung herausgestellt wird; um die Schilderung sexueller, teils als abnorm empfundener Vorgänge, wobei ein wichtiger Faktor im Erfinden sexueller Metaphern besteht; um das Eintreten des Fäkalen in die Erzählsphäre, z. B. in Rätseloder Racheerzählungen, und um die exzessive Darstellung von Gewalt, die hauptsächlich gegen Ehebrecher eingesetzt wird und mitunter in die Nähe der Zerstückelung gerät.
Der Teilbereich der Vermischung findet sich v.a. in Erzählungen realisiert, in denen geistliche Themen in Zusammenhang mit dem Sexuellen gebracht werden, wodurch sich als unvereinbar gedachte Sphären begegnen, und in solchen, in denen hochgestellte Personen oder Ämter durch die Behandlung und Darstellung in der jeweiligen Erzählung lächerlich gemacht werden.
Die motivische Gliederung wurde am Corpus der mittelhochdeutschen Mären erarbeitet, wird auf das Corpus der Fabliaux übertragen und bildet, soweit möglich, auch den Hintergrund für die Analyse der Cantari und des Decameron.
Die große Anzahl der zu behandelnden Texte macht eine gewisse Schwerpunktsetzung unumgänglich. Wiewohl alle einschlägigen Texte zumindest kurz erwähnt werden, steht zumeist ein Text oder eine Textgruppe im Zentrum der Mären- und Fabliau-Kapitel.89
1.3Gegenstände der Untersuchung
Um den Begriff des Grotesken am Beispiel eines Genres zu klären, bietet sich, nicht erst im Anschluss an Grubmüllers Untersuchung, die Versnovellistik als Untersuchungsgegenstand an: Ihr wurde schon vor Grubmüller mehrfach, und nicht nur für den deutschen Bereich, groteskes Potential zugesprochen. So behandelt Heinrich Schneegans in seiner Darstellung der „grotesken Satire im Mittelalter“ u. a. das Fabliau Le Pet au Vilain, worin „der groteske Ton in den Satiren gegen die Geistlichkeit“90 gut getroffen sei. Über die Fabliaux im Allgemeinen, in denen das Groteske wegen der größeren Homogenität der unter dieser Bezeichnung versammelten komischen Texte vielleicht noch stärker hervortritt, urteilt Leonardo Olschki: „In der niedrigen Sphäre des Schwankes kann nur die Groteske gedeihen, die an und für sich nur ein beschränktes Feld sinnvoller Verwendung besitzen kann.“91
Im Bereich der deutschen Versnovellistik hat Heinrich Niewöhner bereits in seiner Dissertation zum Sperber auf einige groteske Elemente in den Mären hingewiesen; so erklärt er seine Beobachtung, als naive Protagonisten würden öfters Männer ausgewählt, folgendermaßen: „der Grund ist der, daß beim Manne die erotische Unerfahrenheit grotesker wirkt“92. Jürgen Schulz-Grobert führt den Gedanken aus, dass auch vordergründig didaktisch ausgerichtete Texte an der grotesken Komik teilhaben; so bezeichnet er den Stricker „als Meister der Schwankerzählung, deren bereits bei ihm teilweise recht grotesk ausgeprägtes Komikpotential im Dienste von Lebenslehren erscheint.“93
Auch einigen Novellen des Decameron94 und Cantari95 und selbst mancher spanischen Erzählsammlung werden in Literaturlexika und Literaturgeschichten groteske Elemente zugeschrieben.96
Dass das Groteske in der deutschsprachigen Literatur, wenn es für das Mittelalter bereits als existent angenommen wird, besonders in Texten des Spätmittelalters wie den Nürnberger Fastnachtspielen und Heinrich Wittenwilers Ring, verortet wird, erscheint angesichts der Herkunft zahlreicher Fastnachtspielstoffe aus dem Bereich der Mären und des Schwankes Die Bauernhochzeit als Vorlage für den Ring nur folgerichtig.97
Um herauszufinden, wo und in welchem Umfang sich in der Versnovellistik im Einzelnen groteske Elemente finden, soll zunächst der Untersuchungsgegenstand genauer eingegrenzt werden: Zu diesem Vorhaben wird der Begriff der ‚Novellistik‘ im Sinne Olschkis als Bezeichnung für kurze Erzählungen profanen Inhalts verwendet.98 Dieser Begriff wird im Folgenden als den spezifischen Termini übergeordnet verstanden, mit denen die entsprechenden Texte in den einzelsprachlichen Philologien meist bezeichnet werden.99
Die Begriffe ‚Versnovellistik‘ und ‚Versnovelle‘ bedeuten folglich eine Einschränkung auf formaler Ebene, die für alle behandelten novellistischen Gattungen in Versform Verwendung finden kann.100 Auf die Diskussion der ‚Novelle‘ als literarische Gattung im engeren Sinne, deren Geschichte nach weitverbreiteter Auffassung mit Giovanni Boccaccios Decameron als Gründungsdokument beginnt, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Die literaturgeschichtliche Forschung ist allerdings vorrangig durch die Frage nach der Genese der ‚Novelle‘ im Stile Boccaccios dazu angeregt worden, sich mit der mittelalterlichen Novellistik zu befassen. Die Darstellungen und Untersuchungen der mittelalterlichen Kurzerzählungen verfolgen überwiegend einen entsprechenden Ansatz, der sich vor allem nach der wissenschaftlichen Herkunft der Autoren aus Romanistik oder Germanistik und der Haltung zu den Thesen Hans-Jörg Neuschäfers, der die von Boccaccio geleisteten Umformungsprozesse von mittelalterlichen Formen zur Novelle nachzeichnet101, unterscheiden lässt. Diese Vorstellung von Alterität würdigt den literarischen Wert der Novellistik vor Boccaccio nur als Zwischenschritt zur Vollendung der Gattung ‚Novelle‘.102 Folglich lässt sich keine Einigkeit mit den Vertretern einer autonomen Forschung zu kleinepischen Formen erzielen, die ihren Forschungsgegenstand gegen dessen Instrumentalisierung zum Lieferanten von Erzählstoffen an Boccaccio schützen zu müssen glauben.
Die Hauptschwierigkeiten bieten aber einerseits die Uneinheitlichkeit der kleinepischen Erzählformen und andererseits das schwer fassbare Gattungsbewusstsein ihrer Verfasser. Zu dieser Frage führt Wolfram Krömer aus, dass ein übergeordnetes Gattungsbewusstsein für die Kurzfiktion wohl anzunehmen sei, innerhalb dessen die verschiedenen einzelnen Ausprägungen wieder charakteristische und eigene Züge trügen, ohne dass aber für die Fabliaux oder Novellen attestiert werden könne, dass sie „bloß Ausdruck eines Standes“103 seien. Die Vorstellung, Gattungen strebten zu einer möglichst reinen Form ihrer selbst, lehnt Krömer ab:
Wenn es nicht die in der Natur der Novelle liegenden Gesetze gibt, die von der Novellentheorie postuliert wurden, dann muß man auch nicht ihre ganze oder teilweise Verwirklichung oder die Tendenz zu ihrer Einhaltung im Mittelalter suchen. Die Entwicklung der Kurzerzählung des Mittelalters strebt nicht auf eine „reine“ Gattung Novelle hin. […] Von der Betrachtung des Fabliau, aber auch vom Überblick über die Novelle ausgehend, können wir daran zweifeln, daß Belehrung und Repräsentanz für die Wirklichkeit Kennzeichen einer angenommenen homogenen Gattung Fabliau und (annähernd) aller ihr angehörigen Werke wäre.104
Tatsächlich ist aber auch die angebliche Benennung (und damit Begründung) der Gattung ‚Novelle‘ durch Boccaccio selbst nicht so eindeutig wie von der Novellentheorie teilweise behauptet. Eine berühmte Passage im ‚Proemio‘ des Decameron nennt mehrere mögliche Bezeichnungen für die enthaltenen Erzählungen und lässt sich nicht auf die Novelle als einzig mögliche beschränken:
intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani […], e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto.105
Die Zuspitzung auf eine Gattungsperfektionierung soll in dieser Arbeit also vermieden werden. Der Gegenstand der Untersuchung ist die europäische Versnovellistik des Mittelalters; es besteht kein Bedarf, von einer sich auf einen literarischen Höhepunkt hinentwickelnden Gattung auszugehen. Auch die Überprüfung der Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, angesichts sehr unterschiedlicher Literaturräume ein problematisches Unterfangen, ist nicht als primäres Ziel der Untersuchung zu verstehen. Somit muss der angeblichen Verfeinerung mittelalterlicher Erzählmuster auf dem Weg zu neuzeitlicher Kongruenz und Glätte kein Vorrang eingeräumt werden.
Die Konzentration auf die Frage nach dem Wesen und der Entstehung der Novelle hat dazu geführt, dass es (m.W.) keine einzige umfassende Übersicht der mittelalterlichen Kurzerzählung in der Romania gibt, die nicht auf die Konstitution der Novelle hinausliefe.106 Dabei ist die Entfaltung der Novellistik als in ganz Europa auftretender Erzählform das Ergebnis von vielen teils einander beeinflussenden, teils voneinander unabhängigen Entwicklungen. Kurze epische Formen gibt es, sowohl einzeln als auch im Werkzusammenhang bezeugt, bereits in der Antike; zu denken ist hierbei an Ovids Metamorphosen (Metamorphoseon libri) oder Apuleius‘ Der goldene Esel (Metamorphoseon libri XI), Werke, in denen bereits eine werkübergreifende Verknüpfung von kurzen, in sich abgeschlossenen Erzählungen angelegt gewesen war.107
Zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung der mittelalterlichen Novellistik werden orientalische, über den arabischen Raum aus Indien vermittelte Erzählsammlungen wie das Buch von den sieben Weisen, der Papageienroman oder Tausendundeine Nacht gezählt. Diese versammeln meist eine große Anzahl von kurzen Erzählungen mit teils belehrendem aber auch unterhaltendem Anspruch, die in eine Rahmenhandlung eingefügt werden. Der sogenannten OrientalismusThese zufolge gelangten die Stoffe der europäischen Kurzerzählung aus dem Orient, d. h. durch persische und arabische Vermittlung aus Indien, über die iberische Halbinsel nach Europa.108 Dort entstand mit der Disciplina Clericalis die älteste Novellensammlung des Mittelalters.109
Doch auch ohne erkennbaren orientalischen Einfluss entwickelten sich im Abendland kleinepische Genres, wie die bereits in der griechischen und römischen Literatur etablierten Fabeln und Exempla, die später auch in den Dienst der Vermittlung des Christentums gestellt wurden. Als Gegenentwurf zur Orientalismus-These, auf deren Basis für nahezu jede europäische Kurzerzählung eine orientalische Vorstufe gesucht wurde, verstand Joseph Bédier sein Konzept der Fabliaux als Volkserzählgut.110
Es wird zumeist davon ausgegangen, dass die kleinen epischen Formen zu Beginn ihrer Geschichte vor allem moralisch-didaktische Funktionen erfüllten. Dies gilt für die Fabel und das Bispel ebenso wie für die Legende und das Mirakel. Die erste bekannte schwankhafte Form, das Fabliau, entwickelte sich im französischsprachigen Raum, neben der höfischen Form des Lai. Der Stricker begründete die Form des Märes, also der deutschsprachigen Form der Versnovellistik, das sich mit der Zeit (evtl. durch den Einfluss des Fabliau) in eine schwankhaftere Richtung bewegte. Im Rahmen der provenzalischen Troubadorlyrik waren die Textformen der (Vers-)Nova und der (Prosa-)Vida entstanden, die nach Neuschäfers Dafürhalten gemeinsam mit den didaktischen Formen und den Fabliaux auf die Entstehung der Boccaccio-Novelle einwirkten.111 Deren Wirkung führte in der französischen Literatur zu einer Abkehr vom Fabliau, während die späte Rezeption Boccaccios im deutschen Raum die lange Vormachtstellung des Märes ermöglichte. Im durch die Folgen der maurischen Expansion zerrissenen und nach der Reconquista christlich-fundamentalistischen Spanien und in Portugal scheint die Kleinepik dagegen weitgehend eine exemplarische Funktion erfüllt zu haben. Parallelen zu den Fabliaux oder der Boccaccio-Novelle bildeten sich nicht heraus oder sind nicht überliefert.
Diese stark verkürzte Darstellung der literarischen Entwicklungen in der europäischen Novellistik des Mittelalters muss zwangsläufig zahlreiche Aspekte unberücksichtigt lassen. Es sollen jedoch zumindest einige offene Fragen erwähnt werden, die sich bei der Darstellung dieser Entwicklung ergeben. So ist es zwar gut möglich, sich die Vermittlung orientalischer Stoffe über die lange unter arabischem Einfluss stehdende iberische Halbinsel vorzustellen; da diese Phase aber mit einer gewissen Randstellung innerhalb des christlichen Europas einherging, stellt sich die Frage, wie diese Übermittlung vonstattengegangen sein könnte. Der Austausch volkssprachlichen Erzählguts über die Sprachgrenzen hinweg ist nur in wenigen Fällen nachzuvollziehen. So scheinen wiederum die schwankhaften Stoffe der Fabliaux nur vereinzelt auf die iberische Halbinsel gelangt zu sein. Auch der Moment der volkssprachlichen Aneignung der Kleinepik ist nicht klar zu bestimmen. Für die Herausbildung der Novellistik scheint neben orientalischen und u.U. ‚volkskulturellen‘ Einflüssen auch die geistliche, vorwiegend lateinische Literatur eine gewichtige Rolle gespielt zu haben: Legenden und Mirakelerzählungen werden u. a. von Hans-Jörg Neuschäfer als Vorgänger der Novelle genannt112; diese Gattungen gibt es schon seit der Spätantike. Walter Pabst geht für die Exempla von einem zweipoligen Einfluss aus:
Neben den Beispielen christlich-dogmatischer Provenienz gab es die auf dem Umweg über Nordafrika, Spanien und Sizilien durch die Araber importierte orientalische Exemplaliteratur, die ihren ersten abendländischen Niederschlag in der Disciplina Clericalis des Petrus Alfonsi fand.113
Ob unter stärkerem orientalischen oder lateinischen Einfluss: Die vielgestaltige Novellistik erlebte in Europa je nach Sprachraum verschiedene Höhepunkte. Für den Verlauf der Gattungsgeschichte bleiben gewisse Zweifel bestehen, da die Datierung der Texte auf der Grundlage der handschriftlichen Überlieferung unsicher ist, und weil unbekannt bleiben muss, welcher Anteil des Geschriebenen überhaupt die Zeiten überdauert hat. Festzustehen scheint gleichwohl, dass bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts mit Fabliaux und Novas die ersten Versnovellen mit primärer Unterhaltungsfunktion gedichtet wurden. Nicht viel später werden das Schaffen des Strickers und damit die Anfänge der deutschen Märendichtung eingesetzt haben. In der ältesten Stricker-Handschrift (Wien, Cod. 2705, datiert auf ca. 1270) werden neben Bispeln, Fabeln und Mären des Strickers auch bereits einige Schwankmären überliefert.114
Im iberischen und italienischen Sprachraum wurde zumeist sowohl an der Prosaform als auch an dem Sammlungscharakter des lateinischen Pionierwerkes, der Disciplina Clericalis, festgehalten. Die volkssprachliche Novellistik setzt hier später ein; der Novellino wird auf etwa 1280 datiert; um 1350 erschien Boccaccios Decameron. Etwa zur gleichen Zeit entstanden auch Juan Ruiz‘ El libro de buen amor und der Conde Lucanor des Don Juan Manuel. Ihre geschlossenen Werkstrukturen115 und deutlich hervortretenden Erzählerfiguren korrespondieren mit der Überlieferung dieser Werke als Ganzem und mit der Bewahrung des Autornamens. Eine wie Mären und Fabliaux in Einzeltexten überlieferte und in gebundener Form verfasste Gattung stellen dagegen die italienischen Cantari dar, deren Überlieferung ebenfalls im 14. Jahrhundert einsetzt.
Während für das Märe durch Fischer eine Unterteilung in verschiedene Stoffkreise vorgeschlagen wurde, gilt das Fabliau als erste Ausprägung des Schwankes als Gattung.116 Interpreten wie Jürgen Beyer wiesen im Streit der genealogischen Theorien darauf hin, dass der Schwank als außerliterarisches Phänomen keiner wie auch immer gearteter literarischer Einflüsse von Komödie, Fabel oder aus dem Orient bedurfte, um zu seinem literarischen Ausdruck zu finden:
Die Konstruktionen überaus komplizierter Theorien erscheinen schon angesichts der Tatsache müßig, daß sich die Entstehung des Fabliau auf ‚natürlichem‘ Wege als jederzeit möglicher Selbstvollzug und literarische Selbstverwirklichung schwankhaften Geistes deuten läßt.117
Wir finden also in Bezug auf die beiden wichtigsten Corpora, die der deutschund der französischsprachigen Literatur, die merkwürdige Situation vor, dass das Fabliau laut der Forschung in Gänze die ‚schwankhafte Geisteshaltung‘ repräsentiert, während das Märe nur zu einem gewissen Teil an der Vielfalt des Schwankes partizipiert.
Abbildung 2
Gemäß der Fabliau-Definition von Joseph Bédier werden auch die Mären als „contes à rire“118 untersucht, also diejenigen, die als ‚deutsche Fabliaux‘ gelten können und von Fischer als „schwankhafte Märe[n]“119 bezeichnet werden. Für die provenzalischen, spanischen und italienischen Texte muss jeweils zunächst herausgearbeitet werden, inwieweit sie als „contes à rire“ bewertet werden können.
Durch die breite Erfassung v.a. der Mären und Fabliaux soll der Entwicklung entgegengesteuert werden, komparatistische Studien nur anhand einiger von der Forschung bevorzugter Erzählstoffe zu betreiben. Für die Fabliaux bedeutet dies, dass alle in der neuesten von Willem Noomen und Nico van den Boogaard als Nouveau Recueil Complet des Fabliaux herausgegebenen Gesamtausgabe enthaltenen Versnovellen untersucht werden. Da die Fabliaux zu einem großen Teil noch ins 13. Jahrhundert datiert werden, erscheint es sinnvoll, auch im deutschen Bereich frühere Texte miteinzubeziehen.
Um im deutschsprachigen Bereich ebenfalls ein umfassendes Corpus zu erhalten, zu dem auch Autorencorpora zu zählen sind, werden für die deutsche Versnovellistik die 220 Texte zugrunde gelegt, die Fischer im Zuge seiner Gattungskonzeption zusammenstellte.120 Die Gruppe der potentiell grotesken, der schwankhaften Mären macht nach Fischers Zählung etwa 80 Prozent des Märencorpus aus.121 Die meisten als Mären ohne groteske Elemente kategorisierten Texte gehören den „höfisch-galanten“ und „moralisch-exemplarischen“ Stoffkreisen an.122
Die weiteren Corpora, die den Gegenstand der Untersuchung bilden, werden jeweils zunächst nach ihren schwankhaften Teilen vorsortiert werden, um die Analyse auf einer gemeinsamen Basis beginnen zu können. Zur Versnovellistik sind die provenzalischen Novas, eine katalanische Versfassung des Buches von den sieben Weisen und die italienischen Cantari zu zählen. Aus Gründen der Repräsentation möglichst vieler romanischer Literaturen und aufgrund der unzweifelhaften Bedeutung für die europäische Novellistik kann auf eine kurze Besprechung von Prosawerken, nämlich erstens des Conde Lucanor, zweitens des Decameron und drittens des Novellino nicht verzichtet werden. Sie werden jeweils etwas knapper besprochen als Mären und Fabliaux, mit denen sie aber zahlreiche Motive teilen.
1Seit ihrem Eintritt in die deutsche Literatur entspann sich jedoch eine lebhafte Diskussion um eine genaue Definition der Gattung, die auch heute noch ihrer Klärung harrt, obwohl die Gattungsbezeichnung auch von zeitgenössischen Autoren wie Uwe Timm oder Martin Walser verwendet wird.
2Karl-Heinz Schirmer, Stil-und Motivuntersuchungen zur mittelhochdeutschen Versnovelle, Tübingen 1969, S. IX. Er schließt aber: „Sofern man sich der Problematik beider Begriffe bewußt ist, kann man beide mit gleichem Recht verwenden“ (ebd.).
3Walter Haug, Entwurf zu einer Theorie der mittelalterlichen Kurzerzählung, in: Walter Haug und Burghart Wachinger (Hgg.), Kleinere Erzählformen des 15. und 16. Jahrhunderts, Tübingen 1993, S. 1–36, hier S. 33.
4Jutta Eming, Kampf um den Phallus: Körperfragmentierung, Textbegehren und groteske Ästhetik im Nonnenturnier, in: The German Quarterly 85.4 (2012), S. 380–401, hier S. 381.
5Vertreter dieser Fraktion sind u. a. Per Nykrog für den französischen und Joachim Suchomski für den deutschen Bereich (Per Nykrog, Les Fabliaux. Etude d’histoire littéraire et de stylistique médiévale, Kopenhagen 1957; Joachim Suchomski, „Delectatio” und „Utilitas”. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalterlicher komischer Literatur, Bern; München 1975).
6Heinz Rupp, Schwank und Schwankdichtung in der deutschen Literatur des Mittelalters, in: Der Deutschunterricht 14.2 (1962), S. 29–48, hier S. 32.
7Klaus Grubmüller, Das Groteske im Märe als Element seiner Geschichte. Skizzen zu einer historischen Gattungspoetik, in: Walter Haug und Burghart Wachinger (Hgg.), Kleinere Erzählformen des 15. und 16. Jahrhunderts, Tübingen 1993, S. 37–54.
8Klaus Grubmüller, Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichte der europäischen Novellistik im Mittelalter: Fabliau – Märe – Novelle, Tübingen 2006.
9Diese Annahme spiegelt sich auch in der Gliederung der von Grubmüller verantworteten Ausgabe Novellistik des Mittelalters: Märendichtung (Frankfurt am Main 1996) wider, wobei der letzte Teil mit „Die Freisetzung des Bösen: der Weg ins Groteske“ überschrieben ist.
10Im Folgenden verwende ich diesen (problematischen und oft problematisierten) Begriff zur einfacheren Abgrenzung: In einer Arbeit, in der von zahlreichen europäischen Novellentraditionen die Rede ist, erscheinen mir Begriffe wie Fabliaux und Mären als der Übersichtlichkeit dienlich. Damit ist kein Statement in der Gattungsdiskussion verbunden; die Wahl der Terminologie erfolgt aus pragmatischen Gründen. Zur v.a. in den 1980er Jahren intensiv geführten Diskussion s. die Literaturangaben in: Haug, Theorie, S. 1 Fn. 2.
11Grubmüller, Das Groteske, S. 48.
12Ebd., S. 54.
13Haug, Theorie, S. 8.
14Auf Konzepte des Grotesken verweisen die Fußnoten 26 und 27 in Grubmüller, Das Groteske, S. 48 f. Darin wird Bachtins Konzept abgelehnt und stattdessen auf Kaysers und Heidsiecks aus literarischen Werken der Moderne gewonnene Auffassungen des Grotesken verwiesen (Wolfgang Kayser, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. Nachdruck der Ausgabe von 1957 mit einem Vorwort „Zur Intermedialität des Grotesken“ und mit einer aktuellen Auswahlbibliographie zum Grotesken, Monströsen und zur Karikatur von Günter Oesterle, Tübingen 2004; Arnold Heidsieck, Das Groteske und das Absurde im modernen Drama, Stuttgart 1969).
15Ebd., S. 51.
16Ebd., S. 53.
17Karin Becker lobt zwar in ihrer Rezension den komparatistischen Ansatz des Bandes, schränkt aber auch ein, dass Fabliau und Novelle durch Grubmüller „kursorischer abgehandelt werden als die Märendichtung“ (Karin Becker, Rezension Klaus Grubmüller, Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichte der europäischen Novellistik im Mittelalter: Fabliau – Märe – Novelle, Tübingen 2006, in: Romanische Forschungen 120 [2008], S. 242–245, hier S. 243). Der Nutzen der Arbeit sei auch für Romanisten v.a. in den Ausführungen zum Märe zu finden. Die Beschränkung auf die komischen Gattungen führe zu einer zu holzschnittartigen Behandlung der französischen Gattungen: Der Lai werde als höfisch, Dit und Fabel als lehrhaft angesehen, ohne auf ebenfalls auftretende Differenzen innerhalb der Gattungen einzugehen (z. B. schwankhafter Lai). Für die Frage nach dem Publikum seien die unterschiedlichen Fassungen der Fabliaux nicht berücksichtigt worden.
18Man beachte hierzu zwei Handschriftenfunde der letzten Jahre, in denen schwankhafte und groteske Elemente enthaltende Mären überliefert sind: Die zwei Beichten A und Rosendorn. Für beide Mären musste in der Folge der Terminus ante quem nach vorne verschoben werden. Nathanael Busch stellt in seinem Beitrag explizit die Verbindung zu Forschungspositionen her, die bisher die Existenz von Obszönes thematisierenden Mären vor 1400 ausschlossen, vgl. Nathanael Busch, Höfische Obszönitäten? Ein ‚Rosendorn‘-Fund und seine Folgen, in: ZfdA 148 (2019), S. 331–347. Für die Stellung der Handschrift und die Redaktion von Die zwei Beichten A vgl. Reinhard Berron und Christian Seebald, Die neue Berliner Handschrift mgo 1430. Ein bedeutendes Zeugnis zur Märenüberlieferung des 14. Jahrhunderts, in: ZfdA 145 (2016), S. 319–342, v.a. S. 335–341.
19Justus Möser, Harlekin oder Vertheidigung des Groteske-Komischen. Neue verbesserte Aufl. Bremen 1777; Carl Friedrich Flögel, Geschichte des Groteskekomischen. Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, Liegnitz 1788.
20





























