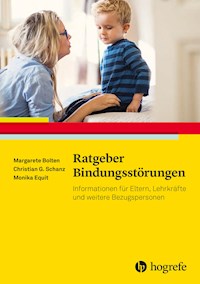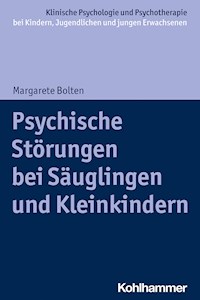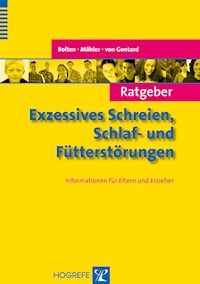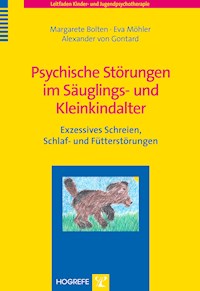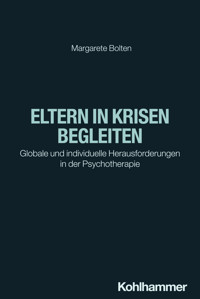
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Krise ist ein Wendepunkt im Leben, der weitreichende Konsequenzen für eine Person haben kann. Krisen können Menschen vor Herausforderungen stellen und zugleich ihre Bewältigungsmöglichkeiten überschreiten, so dass Gefühle der Überforderung, Angst oder Hilflosigkeit entstehen. Eltern sind von Krisen betroffen und in diesem Kontext erleben sie Stress und Leid. Elterliche Krisen können vielgestaltig sein und zu Belastungs- und Inkompetenzerleben führen, was sich jedoch negativ auf die Elternrolle und damit auch auf die Interaktionen zwischen Eltern und Kinder auswirken kann. Das Buch gibt einen Überblick über die aktuelle Forschung zu Elternschaft in verschiedenen Krisenformen. Dabei wird zwischen globalen und individuellen Krisen unterschieden. Thematisiert werden u. a. Krieg, Flucht, Klimawandel, Erkrankungen von Eltern und Kindern, Trennung. Ziel des Buches ist einen Überblick über die unterschiedlichen Auswirkungen von Krisen auf Eltern zu geben, aber auch individuelle Bewältigungsmöglichkeiten zu beleuchten und konkrete Vorschläge für die psychotherapeutische Begleitung von Familien aufzuzeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Zum Begriff der Krise
2 Historische, soziologische und philosophische Betrachtungen von Familie und Elternschaft
2.1 Zum Begriff der Elternschaft und der Familie
2.2 Familien und Elternschaft im gesellschaftlichen Wandel
2.3 Elternschaft in 21. Jahrhundert
2.4 Elternschaft im Spiegel kultureller Normen
2.5 Elternschaft und Lebenszufriedenheit
2.6 Die Entwicklung der elterlichen Identität
2.7 Zusammenfassung
Teil I: Globale Krisen
3 Krieg, Flucht und Vertreibung
3.1 Fallbeispiele
3.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
3.2.1 Hintergründe und Zahlen
3.2.2 Traumata und Belastungsfaktoren bei geflüchteten Eltern
3.2.3 Die Lebenssituation und Stressfaktoren geflüchteter Eltern
3.2.4 Psychische Probleme und Erkrankungen bei geflüchteten Eltern
3.2.5 Strukturelle Veränderungen im Gehirn
3.2.6 Folgen der Traumatisierungen auf das Familiensystem
3.2.7 Rollenkonflikte und neue Erziehungsnormen
3.2.8 Schutzfaktoren
3.2.9 Therapeutische Ansätze zur Förderung der psychischen Gesundheit geflüchteter Eltern
3.3 Zusammenfassung
3.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
3.4.1 Grundsätzliches
3.4.2 Schlafhygieneregeln
3.4.3 Imaginations- und Atemübungen
3.4.4 Kinderbücher zum Thema Krieg und Flucht
3.4.5 Kinderbücher zum Thema Trauma
4 COVID-19 und andere Pandemien
4.1 Fallbeispiele
4.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
4.2.1 Hintergründe und Zahlen
4.2.2 Soziale Sensoren in der COVID-19-Pandemie
4.2.3 COVID-19 und elterlicher Stress
4.2.4 Auswirkung elterlicher Belastungen auf die Eltern-Kind-Beziehung
4.2.5 Kita- und Schulschließungen als besondere Belastungen für Eltern
4.2.6 Geschlechts- und soziale Unterschiede
4.3 Zusammenfassung
4.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
4.4.1 Grundsätzliches
4.4.2 Dem Kind bei der Stressbewältigung helfen
4.4.3 Psychoedukative Webseiten für Familien
5 Umweltzerstörung und Klimawandel
5.1 Fallbeispiele
5.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
5.2.1 Hintergründe und Zahlen
5.2.2 Öko-Angst (Eco-Anxiety)
5.2.3 Bewältigungsversuche
5.2.4 Klimaaktivismus vs. Tatenlosigkeit
5.2.5 Lösungsorientierung vs. Katastrophisieren
5.2.6 Externalisierung des Problems
5.2.7 Menschliche Fehleinschätzungen
5.2.8 Auswirkungen der Umweltzerstörung auf die Elternschaft
5.2.9 Innerfamiliäre Kommunikation
5.3 Zusammenfassung
5.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
5.4.1 Grundsätzliches
5.4.2 Kinderbücher zum Thema Umweltzerstörung und Klimawandel
Teil II: Persönliche Krisen
6 Frühgeburt eines Kindes
6.1 Fallbeispiele
6.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
6.2.1 Hintergründe und Zahlen
6.2.2 Frühgeburtlichkeit und intensivmedizinische Behandlung als Entwicklungsrisiken
6.2.3 Stresserfahrungen von Frühgeborenen
6.2.4 Neurologische Folgen der Frühgeburtlichkeit
6.2.5 Multisensorische Integration von Frühgeborenen
6.2.6 Verhaltensprobleme von Frühgeborenen
6.2.7 Häufige somatische Erkrankungen bei Frühgeborenen
6.2.8 Die Psychische Situation von Eltern nach einer Frühgeburt
6.2.9 Eltern-Kind-Interaktionen und Bindungsentwicklung
6.2.10 Betreuung von Familien nach einer Frühgeburt
6.3 Zusammenfassung
6.4 Therapeutischer Werkzeugkoffer
6.4.1 Emotionale Unterstützung von Eltern nach einer Frühgeburt
6.4.2 Übungen
7 Kinder mit komplexen Bedürfnissen (chronische Gesundheitsprobleme und Behinderungen)
7.1 Fallbeispiele
7.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
7.2.1 »Guter Hoffnung sein«
7.2.2 Diagnoseverarbeitung durch die Eltern
7.2.3 Psychische, emotionale und soziale Herausforderungen für Eltern
7.2.4 Psychische Belastung von Eltern
7.2.5 Unterstützung für Eltern
7.2.6 Positive Aspekte der Erziehung eines Kindes mit komplexen Bedürfnissen
7.2.7 Beziehungsaufbau, Bindung und Eltern-Kind-Interaktionen bei Kindern mit komplexen Bedürfnissen
7.2.8 Partnerschaft
7.2.9 Eltern und das Helfersystem
7.2.10 Eltern und die Gesellschaft
7.3 Zusammenfassung
7.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
7.4.1 Grundsätzliches
7.4.2 Adaptiertes SPIKES-Protokoll zur Übermittlung der kindlichen Diagnose an die Eltern
7.4.3 Unterstützung der Verarbeitung der kindlichen Diagnose
7.4.4 Nützliche Webseiten für Eltern
8 Tod eines Kindes
8.1 Fallbeispiele
8.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
8.2.1 Der Tod von Kindern und Jugendlichen als Extremereignis
8.2.2 Trauer als emotionale Reaktion auf einen Verlust
8.2.3 Theoretische Trauermodelle
8.2.4 Der Trauerprozess und Trauerbewältigung der Eltern nach Verlust ihres Kindes
8.2.5 Einflussfaktoren auf die Trauerbewältigung
8.2.6 Positive Veränderungen im Trauerprozess
8.2.7 Trauerbegleitung in pädiatrischen Kontexten
8.2.8 Gesellschaftliche Aspekte der Trauer um ein verstorbenes Kind
8.3 Zusammenfassung
8.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
8.4.1 Grundsätzliches
8.4.2 Kreative Methoden für die Trauerarbeit mit Eltern
8.4.3 Empfehlungen für die Trauerbegleitung von Eltern von Neugeborenen
8.4.4 Empfehlungen zur informellen Unterstützung von trauernden Eltern nach Schoonover et al. (2022)
8.4.5 Hauptelemente der Behandlung komplizierter Trauer bei Eltern
9 Psychische Erkrankungen und Suizid in der Familie
9.1 Fallbeispiele
9.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
9.2.1 Epidemiologie und Prävalenzen
9.2.2 Psychische Störungen von Eltern als Risikofaktor für die kindliche Entwicklung
9.2.3 Belastungsfaktoren für die Kinder
9.2.4 Gefährdung des Kindeswohls
9.2.5 Präventive Maßnahmen
9.3 Zusammenfassung
9.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
9.4.1 Grundsätzliches
9.4.2 Kinderbücher über Psychische Erkrankungen und Suizid
9.4.3 Hilfreiche Formulierungen für das Gespräch über Tod und Suizid für Eltern
10 Trennung und Scheidung
10.1 Fallbeispiele
10.2 Zusammenfassung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
10.2.1 Hintergründe und Zahlen
10.2.2 Einelternfamilien
10.2.3 Betreuungsmodelle nach einer Trennung oder Scheidung
10.2.4 Scheidung und Trennung als Stressfaktor für Eltern
10.2.5 Gesundheitliche Folgen einer Trennung für Eltern
10.2.6 Psychologische Risiko- und Schutzfaktoren bei der Bewältigung einer Trennung
10.3 Zusammenfassung
10.4 »Therapeutischer Werkzeugkoffer«
10.4.1 Grundsätzliches
10.4.2 10 Leitsätze für Eltern während und nach einer Trennung
10.4.3 Kinder über die Trennung informieren
10.4.4 Elternratgeber zum Thema Scheidung und Trennung
10.4.5 Kinderbücher zum Thema Scheidung und Trennung
Verzeichnisse
Literatur
Stichworte
Die Autorin
PD Dr. Margarete Bolten ist Leitende Psychologin an der Klinik für Kinder und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPKKJ) und am Universitätskinderspital Beider Basel (UKBB) im Bereich der Säuglings- und Kleinkindpsychosomatik und Elternbegleitung. Neben der Weiterbildung in kognitiver Verhaltenstherapie und systemischer Therapie mit den Schwerpunkten Schwangerschaft, Übergang zur Elternschaft, Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder hat sie Zusatzqualifikationen in kognitiv-behavioraler Paartherapie und Paartherapie mit sexualtherapeutischem Schwerpunkt.
Margarete Bolten
Eltern in Krisen begleiten
Globale und individuelle Herausforderungen in der Psychotherapie
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043090-7
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043091-4epub: ISBN 978-3-17-043092-1
Vorwort
Moderne Menschen planen ihren Alltag, den nächsten Urlaub, die Familiengründung, ihr Leben. Das Ziel klar vor Augen fühlen sich Menschen auf sicherem Boden und für die Zukunft gerüstet. Doch manchmal kommt alles ganz anders: Der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit, eine Aufgabe, die uns überfordert, eine Trennung aus heiterem Himmel, ein Unfall oder der Verlust eines nahestehenden Menschen. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Krisen, also Situationen, in denen sich das Leben unerwartet verändert und nicht mehr wie gehabt verläuft. Individuelle Krisen können betreffen eine einzelne Person und ihr Umfeld. Jedoch erleben wir aktuell eine Vielzahl globaler Krisen, die für einen großen Anteil der Menschheit bedrohlich sind und gemeinsame Lösungen erfordern.
Das vorliegende Buch versucht sich der Thematik elterlicher Krisen sehr praxisnah unter Einbezug des aktuellen Stands wissenschaftlicher Forschung zu nähern. Dabei soll vor allem auch auf die Chancen, welche Krisen bieten können, Bezug genommen werden. Über Krisen in der Kindheitsentwicklung gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen und Publikationen. Das Wissen um die Bedeutung von elterlichen Krisen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist dagegen begrenzt. Trotzdem befasst sich dieser praxisorientierte Leitfaden mit den Herausforderungen und Krisen, denen Eltern begegnen und beleuchtet diese aus psychotherapeutischer Sicht. Dabei nehmen die Texte auch auf entwicklungspsychologische, soziologische und gesellschaftspolitische Aspekte Rücksicht. Neben den individuellen Handlungsmöglichkeiten wird außerdem dargestellt welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen besonders relevant sind. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Im vorliegenden Buch wird das generische Maskulinum verwendet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen verstehen sich jedoch für alle Geschlechter.
Zur Zielgruppe des Buches gehören neben Psychotherapeuten auch Kinderärzte, pädagogische und pflegerische Fachkräfte, sowie Fachkräfte der Familien-, Kinder und Jugendhilfe. Ihnen soll das Buch ermöglichen, den Blick auf Familien in herausfordernden und krisenhaften Situationen zu erweitern, indem wichtige Themen beleuchtet werden, die die Elternschaft nachhaltig aus dem Gleichgewicht bringen können. Am Ende jedes Kapitels werden alltagsnahe Lösungsansätze und Interventionsmöglichkeiten für Eltern dargestellt. Aufgrund der Vielfältigkeit der Themen, kann dieses Buch nur schlaglichtartig einzelne Aspekte dieser Krisen im Zusammenhang mit dem Elternsein beleuchten. Zur Vertiefung der verschiedenen Themenfelder empfehle ich weiterführende Fachliteratur.
Nach einer kurzen Begriffsbestimmung der »Krise« (▸ Kap. 1) erfolgt in einem Grundlagenkapitel (▸ Kap. 2) eine historische, soziologische und philosophische Betrachtung der Konstrukte Familie und Elternschaft, um den familialen Wandel und seine Herausforderungen in einen Gesamtkontext zu stellen. In den Folgekapiteln dieses Buches werden unterschiedliche globale (▸ Teil I) und individuelle (▸ Teil II) Krisen sowie ihre Bedeutung für Eltern bzw. elterliches Handeln dargestellt. Jedes Kapitel beginnt mit zwei Fallbespielen, um die Thematik zu illustrieren, und endet mit therapeutischen Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der jeweiligen Krisenart.
Basel, Juni 2024Margarete Bolten
1 Zum Begriff der Krise
Auch wenn wir aktuell den Eindruck haben, Krisen nehmen zu und die Lage wird immer bedrohlicher, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass Menschen schon immer Krisen bewältigen mussten. Die Generation meiner Großmutter erlebte zwei Weltkriege, die Nazidiktatur und den Wiederaufbau nach dem Krieg. Die Generation meiner Mutter lebte erneut in einer Diktatur, um nach dem Sturz des SED1-Regimes mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Herausforderungen zurechtkommen zu müssen. In Wirklichkeit geht es den meisten Menschen so, dass sie ihren Lebensweg gehen, auch wenn das Leben nicht in geregelten Bahnen verläuft.
In lexikalischen Definitionsversuchen (vgl. Duden 2020) wird die Krise meist als Wendepunkt beschrieben, als Höhepunkt oder Tiefpunkt einer Entwicklung in einem System psychischer, sozialer oder natürlicher Art. Aber auch als Moment der Ungewissheit, also der Gefahr, aber auch der Chance, die weitreichende positive oder negative Konsequenzen für die weitere Entwicklung des betreffenden Systems haben. Die Krise unterbricht bisherige Routinen eines Systems und leitet eine Transformation desselben ein. Manche Expertinnen (Gómez & Gasper, 2022; Von Uexküll, 1995) gehen sogar so weit zu behaupten, dass menschliche Entwicklung nur im Rahmen von Krisen stattfindet. Krisen synchronisieren und individualisieren uns zugleich und sind Treiber von Veränderung und Fortschritt.
Das Wort Krise wird seit dem 16. Jahrhundert in der medizinischen Fachsprache verwendet und stammt vom lateinischen »crisis« als entscheidende Wendung bei Krankheiten, gleichbedeutend mit dem griechischen Verb κρίνειν, was so viel wie scheiden oder trennen bedeutet (Gemoll & Vretska, 2006). Eine Krise evoziert existenzielle Entscheidungen. In einer Krise geraten Selbstverständlichkeiten unserer Wirklichkeit ins Wanken, der existenzielle Boden unter unseren Füßen wird zweifelhaft, brüchig oder entrinnt gar. Søren Kierkegaard sieht in der Krise einen Strudel aus Möglichkeit, Offenheit, Freiheit und Angst. Doch zu den Paradoxien der Krisenerfahrung gehört eben auch das Gegenteil des Erstarrens und der Lähmung, der Einengung und Ausweglosigkeit, der Trauer, der Wut und der Verzweiflung. Eine Krise ist also ein Wendepunkt im Leben, die uns vor Herausforderungen stellt und Gefühle der Überforderung, Angst oder Hilflosigkeit hervorrufen kann. Eine Krise ist also ein janusköpfiger Begriff, der eine Vielzahl semantisch synonymer bzw. verwandter Begriffe hat: Problemsituation, Scheidepunkt, Misere, Bredouille oder Notlage. Typologisch lassen sich erwartete, etwa zyklisch wiederkehrende oder für bestimmte Entwicklungsphasen des Menschen typische Krisen (z. B. Pubertätskrise), von unerwarteten, überraschend hereinbrechenden Krisen unterscheiden. Des Weiteren lassen sich kurze, eher ereignishafte, akute von chronischen Krisen differenzieren. Außerdem gilt es endogene, also die aus der Eigenentwicklung eines Systems entstehenden, von exogenen, d. h. von außen verursachten Krisen, und eng damit verwandt, selbst produzierte von passiv widerfahrenden Krisen zu unterscheiden. Schließlich können Krisen, welche ohne zu große Veränderungen vorübergehen von Krisen, welche zu tiefen Transformationen bis hin zum terminalen Systemkollaps führen, abgegrenzt werden.
In der Psychotherapie ist die Krise auf vielfältige Weise von grundlegender Bedeutung. Am offensichtlichsten ist dies bei psychischen und existenziellen Krisen von Patienten, denn meist sind sie der Auslöser, warum sich Patienten Hilfe holen. Derlei Krisen können vielgestaltig sein, etwa als Krisen durch eine psychische Erkrankung, als Beziehungs- oder Familienkrisen, Tod eines Familienmitglieds oder Krisen, die durch äußere Ereignisse wie politische, soziale, kulturelle und ökonomische Ereignisse hervorgerufen werden. Dabei ist diesen Krisen meist eigen, dass sie der betroffenen Person Leiden bereiten und zugleich ihre Bewältigungsmöglichkeiten überschreiten, so dass das psychische System und das Lebenssystem des jeweiligen Menschen aus dem Gleichgewicht geraten. Die Aufgabe der therapeutischen Arbeit wird es sodann, den Menschen durch diese Krise hin zu einem neuen Gleichgewicht zu begleiten und dabei Lösungen und Veränderungsschritte heranreifen zu lassen.
Endnoten
1Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)
2 Historische, soziologische und philosophische Betrachtungen von Familie und Elternschaft
2.1 Zum Begriff der Elternschaft und der Familie
Elternschaft und Familie sind normativ aufgeladene Konstrukte. Damit verbundene Vorstellungen sind im gesellschaftlichen und damit auch in allen psychosozialen Bereichen extrem wirksam. Idealisierte und ideologisch geprägte Vorstellungen von Elternschaft, welche mit gesellschaftlichen und alltäglichen Normalitätsvorstellungen interagieren, beeinflussen auch die psychotherapeutische Praxis. Schlagworte wie »Helikoptereltern« oder »Latte-Macchiato-Mütter« stehen symbolhaft für Diskurse rund um Elternschaft. Anthropologische Perspektiven der Elternschaft sehen die kulturelle Variabilität als historisch und sozial situiert. Babys werden geboren und benötigen Wärme, Nahrung, Schutz und eine Einführung in soziale Sitten und Systeme. Die Art und Weise, wie diese grundlegenden Aufgaben erfüllt werden, ist jedoch sehr unterschiedlich. Die Überblicksarbeit von Franco (2000) als auch die Zusammenfassung von Furedi und Füredi (2002) deuten darauf hin, dass sich die Rolle und Bedeutung der Elternschaft in letzter Zeit verändert hat und die Kindererziehung ein wachsendes Spektrum an Verantwortlichkeiten und Aktivitäten umfasst, die früher nicht als Dimensionen der Elternschaft angesehen wurden. Die zeitgenössische Elternschaft der westlichen Mittelschicht unterliegt einem ständigen Wandel, bei dem die traditionellen verwandtschaftlichen Rollen in den Hintergrund treten und die akademischen Leistungen der Kinder sowie außerschulische und soziale Aktivitäten in den Vordergrund rücken.
Kleinkinder haben universale biologische Bedürfnisse und müssen die gleichen Entwicklungsaufgaben bewältigen. Eltern helfen ihnen, erste soziale Bindungen aufzubauen, Emotionen auszudrücken und zu verstehen und die physische Welt zu begreifen. Der Umfang der Interaktion zwischen Eltern und Kindern ist im Säuglings- und Kleinkindalter am größten, einer Zeit, in der Menschen für die Einflüsse von Erfahrungen, d. h. Kultur, Sprache und Traumata, besonders anfällig sind (Bornstein, Putnick, Park, Suwalsky & Haynes, 2017). Nahezu das gesamte Weltwissen, aber auch soziale Kompetenzen, erwerben Kinder in dieser Lebensphase durch Interaktionserfahrungen mit ihren Eltern. (Gadaire, Henrich & Finn-Stevenson, 2017). Grusec und Davidov (2010) gehen in ihrer Sozialisierungstheorie davon aus, dass Elternsein in fünf verschiedene Domänen eingeteilt werden kann: Schutz, Reziprozität, Kontrolle, anleitendes Lernen und Teilhabe an einer Gruppe. Gemäß den Autoren birgt jede dieser Domänen spezifische Aufgaben und verlangt Eltern spezifische Verhaltensweisen ab. Eltern erleben immer dann vermehrte Belastungen und Stress, wenn sie nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um den verschiedenen elterlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei kann das Belastungserleben zum einen auf spezifische Charakteristika der Familienmitglieder (z. B. Persönlichkeit, Temperament), auf Beziehungsdynamiken zwischen Eltern und Kind, aber auch auf externe Stressoren zurückzuführen sein. Ein hohes Belastungsniveau wiederum kann sich negativ auf das Erziehungsverhalten auswirken, was wiederum negative Folgen für das kindliche Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern haben kann (Dillmann, Sensoy & Schwarzer, 2022).
Die Familie ist ein Sozialgebilde und steht entsprechend in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und normativen Leitbildern. Folglich wirken sich soziale und kulturelle Veränderungen auch auf die Elternschaft bzw. die Gestaltung von Familie aus. Dem Begriff der Familie als soziales Phänomen kann man sich aus unterschiedlichen Perspektiven annähern.
Definition der Familie gemäß dem statistischen Bundesamt in Deutschland (destatis, 2022)
Die Familie umfasst alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, das heißt Ehepaare, nichteheliche (gemischt geschlechtliche) und gleich geschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit Kindern im Haushalt. Einbezogen sind – neben leiblichen Kindern – auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung. Damit besteht eine Familie immer aus zwei Generationen: Eltern/-teile und im Haushalt lebende Kinder.
Definition der Familie nach Nave-Herz (2015)
Das zentrale Merkmal von Familien ist ihre »biologisch-soziale Doppelnatur«, die aus der Reproduktionsfunktion einerseits und Sozialisationsfunktion andererseits folgt. Weiterhin ist »ein besonderes Kooperations- und Solidaritätsverhältnis« der Familienmitglieder zu beobachten und es müsse immer eine »Generationsdifferenzierung« im Sinne eines Eltern-Kind-Verhältnisses vorliegen.
Elternschaft kann nach Vaskovics (2011) in vier Segmente unterteilt werden: die biologische, die genetische, die soziale und die rechtliche Elternschaft. Eine Differenzierung in biologische und genetische Elternschaft ist erst durch moderne reproduktionsmedizinische Verfahren wie Eizell- und Embryonenspende möglich geworden. In den Fällen von Eizell- und Embryonenspende sowie von Leihmutterschaft kommt es zu einer Trennung zwischen biologischer, genetischer und sozialer Mutterschaft. Durch verschiedene krisenhafte Lebensereignisse wie Tod, Trennung oder Scheidung können Mütter und Väter unterschiedliche Aspekte der Elternschaft, temporär oder langfristig, erfüllen.
Giesel (2007) fasst unter dem Begriff »Leitbild« die sozial geteilten Vorstellungen von einer erwünschten bzw. wünschenswerten und prinzipiell erreichbaren Zukunft zusammen, die durch entsprechendes Handeln realisiert werden soll. Die Leitbildforschung definiert ein Leitbild als ein Verbund kollektiv geteilter Vorstellungen des »Normalen«, das heißt von etwas Erstrebenswertem, sozial Erwünschtem und/oder mutmaßlich weit Verbreitetem, also Selbstverständlichem« (Lück & Diabaté, 2015). Leitbilder basieren entsprechend auf der Verbindung unterschiedlicher Facetten von Normen und Werten. Leitbilder sind komplexe Visualisierungen, die Menschen und auch Organisationen zur Orientierung dienen. Zentral ist, dass Familienleitbilder intersubjektiv geteilt werden und für unterschiedliche Kollektive jeweils charakteristisch beschaffen sind. Sie sind spezifisch für sozial und regional diversifizierte Milieus und können dort jeweils einen hohen Grad an Homogenität erreichen. Insgesamt betrachtet sind kulturelle Familienleitbilder nicht die Summe aller individuellen Leitbilder. Vielmehr gewinnen sie durch ihre Institutionalisierung und alltägliche soziale Reproduktion eine eigenständige Realität (Lück, Diabaté & Ruckdeschel, 2017). Leitbilder können Vorstellungen zu normativen Umständen beinhalten (z. B. Kinderzahl) oder »richtigen« Abläufen beinhalten (z. B. Alter bei der Familiengründung). Familienleitbilder stehen immer in Wechselwirkung mit dem individuell Erlebten und situativen Lebensumständen. Bisweilen werden Umstände angeglichen, etwa um kognitive Dissonanzen zu vermeiden, oder aber es wird an ihnen festgehalten, weil sie Orientierung und Sicherheit vermitteln. Auch auf gesellschaftlicher Ebene bewegen sich Leitbilder zwischen Stabilität und Wandel. Während manche Leitbilder in Teilen der Gesellschaft vergleichsweise stabil bleiben, etwa das Leitbild des männlichen Ernährers, haben sich andere wie das der komplementären Paarbeziehung stark gewandelt.
Individuelle und gesellschaftliche Leitbilder beeinflussen sich gegenseitig: So werden persönliche Leitbilder in der zwischenmenschlichen Interaktion ausgetauscht, woraus gesellschaftliche Leitbilder hervorgehen können. Insofern entstehen gesellschaftliche Leitbilder auch über die Häufigkeit ähnlich figurierter individueller Leitbilder. Gleichzeitig prägen kulturelle Leitbilder individuelle Leitbilder, in dem sie adaptiert oder in der Sozialisation gezielt vermittelt werden. Ihren Ursprung haben Familienleitbilder vornehmlich in der Herkunftsfamilie und im unmittelbaren sozialen Umfeld. Die Werte, Normen und daraus resultierendes Verhalten, welche regelmäßig beobachtet werden, erscheinen den Familienmitgliedern zunehmend selbstverständlich und es kann die Vorstellung entstehen, dass es ›alle so machen‹ und man es auch so machen sollte. Neben der Herkunftsfamilie, spielen auch die Medien eine große Rolle. Social Media, Fernsehserien, Filme und Werbung etwa vermitteln ein Bild, wie Familienleben normalerweise funktioniert.
Das Familienleben selbst unterliegt ebenfalls einem erheblichen Wandel. Das, in vielen westlichen Industrienationen lange Zeit verbreitete Ernährermodell, bei dem der Mann die finanzielle Grundlage der Familie mit außer familiärer Erwerbsarbeit sichert und die Frau für den Haushalt und die Versorgung der Kinder verantwortlich ist, wird zunehmend seltener. Mütter sind in wachsendem Maße durch berufliche Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig. Aber auch die Vaterrolle ist im Wandel. Väter engagieren sich heute wesentlich mehr in der Erziehung und der Fürsorge ihrer Kinder als es in der Generation ihrer Väter der Fall war. Allerdings wird die sogenannte Care-Arbeit2 überdurchschnittlich oft von Frauen geleistet.
Kulturhistorisch betrachtet wurden Eltern in unserer Gesellschaft lange vor allem als jene Personen definiert, die ein Kind zeugten und aufzogen (Schülein, 2002). Die Pluralisierung von Lebens- und Familienentwürfen beinhaltet auch Abweichungen von eher normativen Vorstellungen der biologisch-sozialen Doppelnatur der Familie in unserer Gesellschaft (Nave-Herz, 2015). Die modernen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bringen deshalb neben einer Vielfalt an Möglichkeiten, das eigene Familienleben zu gestalten, auch neue Fragen und Herausforderungen für Eltern mit sich. Gesellschaftlichen und sozialen Erwartungen an die Elternrolle stehen die eigenen Überzeugungen, Erfahrungen, Wünsche und Werte gegenüber. Aus kultursoziologischer Perspektive spielen die De-Institutionalisierung der Ehe, die sich wandelnden Geschlechterverhältnisse sowie der Wandel der sozialen Konstruktion von Elternschaft und Kindheit die größte Rolle in Bezug auf ihren Einfluss auf die gesellschaftlichen Leitbilder von Familie. Neu entstandene normative Konstrukte, etwa das der »verantworteten Elternschaft«3 (Kaufmann, 1990) haben die »Kosten« von Elternschaft deutlich erhöht. Von heutigen Eltern wird intensiver denn je erwartet, dass sie ganz für ihre Kinder da sind und ihre eigenen Bedürfnisse hinter die der Kinder zurückstellen. Im Zuge der immer stärker in den Vordergrund getretenen Norm der verantworteten Elternschaft wird häufig von Müttern erwartet, dass sie möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, was wiederum eine Reduktion der beruflichen Erwerbstätigkeit impliziert. Gesellschaftliche Veränderungen und Leitbilder beeinflussen das Handeln und Denken von Menschen, indem sich diese daran orientieren und dabei zu Habitualisierungen tendieren und entsprechend gewohnheitsmäßig agieren. Statt eine bewusste und rationale Abwägung von Kosten und Nutzen anzustellen, können Mitglieder einer Gruppe oder Gesellschaft auch auf unreflektiert ablaufende Handlungsroutinen zurückgreifen. Schwierigkeiten entstehen häufig dann, wenn widersprüchliche gesellschaftliche Erwartungen bestehen. Beispielsweise sollen Väter sich einerseits mehr in der Erziehung und Fürsorge ihrer Kinder engagieren und Elternzeit nehmen und andererseits wird oft selbstverständlich erwartet, dass sie das finanzielle Auskommen der Familie sichern (Diabaté et al., 2017). Aber auch die individuellen Erwartungen von Eltern an die Familie als ein Ort des Glücks und der Sinnerfüllung können zu hohe Anforderungen an sich und die Familienmitglieder stellen (Jurczyk, 2014). Demnach stehen Familien vor großen Herausforderungen, die sich durch gleichzeitige, aber nicht aufeinander abgestimmte Veränderungen der individuellen Entwicklungspfade, der Familienformen, der Geschlechterverhältnisse und der Erwerbsbedingungen ergeben und aktuell noch nicht ausreichend durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen aufgefangen werden. Die Folge kann eine strukturelle Überforderung von Familien sein, die teilweise nur durch individuelle Lösungen aufgefangen werden kann (Jurczyk, 2014).
2.2 Familien und Elternschaft im gesellschaftlichen Wandel
Elternschaft hat sich in den vergangenen Dekaden fundamental verändert. So hatten Kinder in der vorindustriellen Zeit mehrere Bezugspersonen, denn es gab keine räumliche Differenzierung zwischen Arbeit und Wohnen (Nave-Herz, 2014). Die Bauern- oder Handwerkerfamilie lebte häufig mit ihren Knechten, Gesellen oder Mägden und weiteren Familienmitgliedern unter einem Dach zusammen. Familien waren in erster Linie Zweckgemeinschaften mit dem Ziel der Sicherung der ökonomischen Lebensgrundlagen. Die Liebesheirat als heutiges Ideal in westlichen Industrienationen existierte noch nicht. Auch die komplementäre Aufgabenverteilung zwischen beruflicher Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses und familialer Sorgearbeit wurde nicht praktiziert. Erst im Zuge der Industrialisierung setzte sich die bis heute übliche Trennung der außerfamilialen Erwerbsarbeit von der Hausarbeit und Kinderbetreuung als Norm durch.
Besser verstehen lässt sich also der Wandel innerhalb von Familien vor dem Hintergrund allgemeiner gesellschaftlicher Veränderungen. Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Elternschaft und des Familienlebens sind in den letzten Jahrzehnten komplexer geworden. Hill und Kopp betonen die Bedeutung der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen, aber auch insgesamt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, welche bei einer Mehrheit der Bevölkerung in westlichen Nationen zu einer verbesserten ökonomischen Situation der Haushalte führte (Hill & Kopp, 2013). Durch verbesserte finanzielle Möglichkeiten reduziert sich der ökonomische Druck als wichtiges Kriterium für das Eingehen und den Erhalt einer Ehe als Grundlage für die Familie. Vielmehr zeichnet sich die bürgerliche Kernfamilie heute dadurch aus, dass nicht mehr der praktische Nutzen und ökonomische Zwänge das Zusammenleben begründen, sondern die romantische Liebe und geteilte Emotionen wichtige bestimmende Merkmale sind (Peuckert, 2012). Die Familie ist heute weniger eine soziale Institution als eine freiwillige Lebensform, in der den individuellen Bedürfnissen und Emotionen der Partner eine wichtige Bedeutung zukommt. Gleichzeitig werden sehr hohe emotionale Erwartungen an die Partnerschaft und die Familie gestellt. Die Individualisierung, Mobilität, Enttraditionalisierung und der Wandel hin zur postfordistischen Gesellschaft4 haben dazu beigetragen, dass die Familiengründung, das familiäre Alltagsleben und die Kontinuität von Familien nicht mehr als selbstverständlich betrachtet werden. Aktuell leben wir in einer »Multioptionsgesellschaft « in der die »endlose und kompetitive Ausfaltung neuer Möglichkeiten« omnipräsent ist (Gross, 1994). Diese Entfaltung neuer Möglichkeiten betrifft nicht nur Auswahl stehenden Produkte des Handels (stationär und online) und das Dienstleistungsangebot, sondern auch die individuellen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten (Ausbildung, Wohnort, Partnerwahl etc.). In nahezu jedem Aspekt des Lebens und der Gesellschaft bieten sich verschiedenste Optionen zur Auswahl. Das dahinterliegende Phänomen ist das tief in der Gesellschaft verankerte Streben zur Steigerung, und zum Wachstum. Abels (2000) schreibt dazu: »hinter allem gibt es ein Mehr und ein Besseres, jedes Mehr und Bessere wartet darauf, realisiert zu werden, und jeder hat das Recht, dieses Mehr und Bessere zu fordern.« Ein solches Leitmotiv kann jedoch auch überfordernd sein, denn die wachsende Auswahl erschwert die Wahl und kann zu psychischem Druck führen. Wie ein Mensch sein Leben in der Gesellschaft gestaltet, scheint vermeintlich stark von der Nutzung der sich ihm bietender Optionen abzuhängen (Gross, 1994). Es gilt die Herausforderungen anzunehmen und bewusst verantwortlich für die eigene Person, die Familie, die Mitmenschen und die Umwelt zwischen den Optionen zu wählen. Während lange Zeit die Lebenswege von Menschen klar vorgezeichnet waren, beispielsweise Eheschließungen arrangiert oder der Beruf des Vaters übernommen wurden, sind heute Entwicklungspfade durch deutlich weniger Determinanz und Sicherheiten geprägt. Menschen müssen Flexibilität entwickeln, Chancen und Risiken abzuwägen und Entscheidungen treffen, ohne ständig in Selbstzweifel zu geraten. Eine »Nebenwirkung« dieser Entwicklungsaufgabe ist die Problematik, dass sich Menschen getrieben fühlen, alles neu, anders und besser zu gestalten, ohne die Akzeptanz aufzubringen, sich mit den eigenen Entscheidungen zufriedenzugeben und das Mögliche für die eigene Lebensgestaltung anzuerkennen (Gross, 2007).
Heirat und Familiengründung werden heute seltener und später im Lebensverlauf vollzogen, zudem treten »typische« Abfolgen von Übergängen, wie beispielsweise Heirat und anschließender Familiengründung, nicht mehr so häufig auf. Andere Ereignisse dagegen, wie Scheidungen und Trennungen sind hingegen ein häufigeres Ereignis geworden (Kreyenfeld & Konietzka, 2015). Auch gibt es immer mehr Menschen, die in ihrem Leben nie eine Ehe eingehen oder die Eheschließung im Lebensverlauf aufschieben. So ist das Erstheiratsalter der Frauen in Ostdeutschland zwischen 1960 und 2014 um 8,5 Jahre (mittleres Heiratsalter 31.1 Jahre) und bei den Männern um 9,7 Jahre (mittleres Heiratsalter 33.6 Jahre) gestiegen, in Westdeutschland lag der Anstieg bei den Frauen bei 5,2 Jahren (mittleres Heiratsalter 29.9 Jahre) und bei den Männern bei 6,3 Jahren (mittleres Heiratsalter 32.2 Jahre) (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2016). Der Anstieg des Erstheiratsalters lässt sich als Hinweis auf eine zunehmende Entkopplung von Ehe und Reproduktion deuten. Familiengründungen sind heute also nicht mehr primär an eine Eheschließung gebunden und beides findet häufiger unabhängig voneinander statt. Entsprechend werden immer mehr Kinder in nichtehelichen Partnerschaften geboren.
Die gesellschaftlichen Veränderungen haben auch einen Einfluss auf die Anzahl der in Partnerschaften geborenen Kinder. Ab etwa 1965 bis in die 1970er Jahre ging die Geburtenzahl in beiden Teilen Deutschlands gleichermaßen zurück. Der Geburtenrückgang hat sich auch in allen anderen europäischen Ländern vollzogen, so dass heute in ganz Europa die Geburtenrate unter dem Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern liegt (Eurostat, 2021). Trotz des allgemeinen Trends (aktuelle Geburtenziffer pro Frau in Europa: 1,5 Kinder) zeigen sich zwischen den Ländern deutliche Unterschiede. Die Fertilität ist in den nordeuropäischen Ländern ist vergleichsweise hoch, während die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz zu den Ländern mit der niedrigsten Geburtenziffer zählen
In den 1960er Jahre dominierte die Kernfamilie aus Mutter, Vater und Kindern sowohl in normativer als auch in quantitativer Hinsicht, weshalb sie auch heute immer noch als »Normfamilie« wahrgenommen wird. Jedoch gibt es seit den 1970er Jahren aufgrund der gesteigerten Individualisierung und Mobilität, aber auch der zunehmenden Erwerbsbeteiligung und rechtliche Gleichstellung und damit Unabhängigkeit der Frauen auch einen Anstieg des Heiratsalters und eine höhere Instabilität von Ehen. In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu einer Pluralisierung der Lebensformen, indem neben die klassische Kernfamilie zunehmend auch Alleinerziehende, nichteheliche Lebensgemeinschaften und Stieffamilien traten. Peuckert (2012) konstatiert in diesem Zusammenhang, dass die »biologische und soziale Elternschaft immer häufiger auseinanderfallen«, es also zu einer Erosion der bio-sozialen Doppelnatur der Familie kommt. Immer mehr Eltern sind also mit den Minderjährigen, welche mit Ihnen im gleichen Haushalt leben biologisch nicht mehr verwandt. Immer häufiger haben Kinder biologische und soziale Mütter und Väter. Dies trifft auf Stief-, Pflege- und Adoptivfamilien, aber auch auf die durch reproduktionsmedizinische Fortschritte möglich gewordenen heterologen Inseminationsfamilien zu. Zusammenfassen kann man also, dass unser Normalitätsverständnis von Familie ein biologisches ist, dieses aber in der Realität oftmals davon abweicht.
2.3 Elternschaft in 21. Jahrhundert
Eltern prägen das Leben und die täglichen Erfahrungen von Kindern grundlegend. Sie haben einen fundamentalen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden, aber auch die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung von Kindern (Bornstein, 2019). Elternschaft ist heute wie damals eine Herausforderung und anspruchsvoll. Im letzten halben Jahrhundert hat sich die Welt jedoch grundlegend verändert, wodurch sich die Erwartungen und Erfahrungen in Bezug auf die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder erziehen, verschoben haben (Faircloth, 2023). In den letzten zwei Jahrzehnten sind die Geburten- und Heiratsraten gesunken, während die Scheidungsraten und die Zahl der Alleinerziehenden-Haushalte gestiegen sind (OECD, 2011). Die Familienformen und Lebensformen haben sich diversifiziert: die Zahl der unverheirateten oder geschiedenen Familien, der Alleinerziehenden und der gleichgeschlechtlichen Eltern hat zugenommen. Eltern sind heute häufig älter, besser ausgebildet und haben tendenziell weniger Kinder (Bongaarts, Mensch & Blanc, 2017). Mehr Mütter arbeiten, während sie ihre Kinder erziehen (Miho & Thévenon, 2020). Darüber hinaus hat die Migration in vielen Gesellschaften zu einer noch nie dagewesenen ethnischen, kulturellen und religiösen Vielfalt geführt. In modernen Gesellschaften fühlen sich viele Familien deutlich seltener in ihren Nachbarschaften und Gemeinschaften tief verwurzelt und abhängig (OECD, 2022), was gleichzeitig zu einer Schwächung der informellen sozialen Unterstützung und des Sicherheitsnetzes führte, so dass immer mehr Familien die volle Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Kinder übernehmen müssen, anstatt sich bei der Beaufsichtigung, dem Schutz und der Erziehung der Kinder auf die Großfamilie und die Gemeinschaft als Ganzes verlassen zu können (Pimentel, 2016). Diese Lücke wird in vielen Gesellschaften durch staatliche bzw. öffentliche Unterstützungsangebote geschlossen. In vielen Ländern der OECD haben Schulen und frühkindliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ihr Angebot ausgeweitet. Häufig erhalten Familien nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern werden auch durch verschiedene Initiativen und Elternprogramme mit Informationen und praktischer Unterstützung versorgt (Daly et al., 2015).
Das Familienleben hat sich im Laufe der Jahre verändert, was neue Herausforderungen für Eltern mit sich bringt und die Frage aufwirft, ob sich auch die Art der Kindererziehung ändern sollte (Burns & Gottschalk, 2019). Es überrascht nicht, dass viele Eltern unsicher sind, wie sie die Herausforderung der Elternschaft meistern können (Dworkin, Connell & Doty, 2013). Heute wird eine Vielzahl von Informationen und Unterstützungsdiensten für Eltern angeboten (digitale Plattformen, Blogs, Kampagnen, Elternprogramme und andere Dienste). Viele Eltern wenden sich dem Internet oder Erziehungsbüchern zu und können sich angesichts der schier endlosen Zahl von Erziehungsansätzen, die befürwortet oder vor denen gewarnt wird, verlieren und ratlos zurückbleiben, denn ein Blick in die verfügbaren Informationen offenbart ein verwirrendes Spektrum an angepriesenen Erziehungsansätzen mit wenig oder gar keiner Evidenz auf der einen Seite und gut etablierten und erforschten Ansätzen auf der anderen Seite (Burns & Gottschalk, 2019).
Die Globalisierung und der technologische Fortschritt wirken sich auch auf das Familienleben und die Elternschaft aus. Digitale Technologien haben das Familienleben auf der ganzen Welt spürbar verändert. Im digitalen Zeitalter können Eltern leichter denn je Unterstützung und Informationen finden und austauschen. Viele Eltern scheinen es heute vorzuziehen, das Internet und die sozialen Medien zu konsultieren, bevor sie offline einen Fachmann aufsuchen, Familienmitglieder oder Freunde befragen (Setyastuti, Suminar, Hadisiwi & Zubair, 2019). Da sich jedoch immer mehr Eltern digitalen Plattformen, Chatgruppen und anderen weniger regulierten Kanälen als primären Informations- und Unterstützungsquellen zuwenden, ergeben sich neue Herausforderungen. So überrascht es nicht, dass Eltern berichten, unter dieser Informationsflut zu leiden (Özgür, 2016). Zudem müssen Eltern die Bildschirmzeit ihrer Kinder überwachen, die Sicherheit der Kinder gewährleisten und ihr eigenes Online-Verhalten regulieren (Burns & Gottschalk, 2019). Elterliche Erziehungsdimensionen und -stile werden offline wie auch online angewandt (Padilla‐Walker, Coyne, Fraser, Dyer & Yorgason, 2012), jedoch hängt der konkrete Erziehungsansatz oft von den digitalen Kenntnissen und Fähigkeiten der Eltern sowie von deren Einstellung zur Nutzung digitaler Technologien ab (Livingstone et al., 2017). Eltern nutzen Technologien auch, um sie bei der Kindererziehung Unterstützung zu suchen (Plantin & Daneback, 2009). Neue Überwachungstechnologien erleichtern die Kontrolle von Kindern und können die Überbehütung von Kindern verstärken. Neue Kommunikationstechnologien ermöglichen es Eltern, mit ihren Kindern in engem Kontakt zu bleiben und Wärme und Zuneigung zu zeigen, wenn sie nicht anwesend sind (Muñoz, Ploderer & Brereton, 2018). Gleichzeitig können digitale Technologien die Erziehung beeinflussen (Burns & Gottschalk, 2019). So versteht man unter »Phubbing« die Angewohnheit, jemanden zugunsten eines Mobiltelefons zu ignorieren. Die häufige Nutzung von Smartphones stört im Kontext der Elternschaft die Interaktion mit den Kindern und kann sich negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken, da sich Kinder in ihrem psychologischen Bedürfnis nach Verbundenheit ignoriert und frustriert fühlen können (McDaniel & Coyne, 2019). Beim »Sharenting« geben Eltern viele Informationen über ihre Kinder in sozialen Medien preis, wodurch ihnen die Autonomie über ihre digitale Identität genommen wird (Ouvrein & Verswijvel, 2019).
In einer Überblicksstudie untersuchten Sandberg und Hofferth (2001), wie sich die Zeit, die amerikanische Kinder zwischen 1981 und 1997 mit ihren Eltern verbracht haben, verändert hat und welchen Beitrag dabei die sich verändernden Muster der weiblichen Erwerbsbeteiligung, der Familienstruktur und der elterlichen Bildung geleistet haben. Im Allgemeinen hat sich die Zeit, die Kinder mit ihren Eltern verbringen, in diesem Zeitraum nicht verringert. In Familien mit zwei Elternteilen hat sie sogar erheblich zugenommen. US-amerikanische Eltern verbringen also heute mehr Zeit mit ihren Kindern, obwohl die Frauenerwerbsquote seither deutlich gestiegen ist. Dotti Sani und Judith Treas (2016) werteten Daten aus elf westlichen Ländern (USA, Kanada, Dänemark, Frankreich und Deutschland) mit mehr als 122.300 Eltern mit mindestens einem Kind unter 13 Jahren, welche zwischen von 1965 und 2012 aufgezeichnet wurden, aus. Die teilnehmenden Mütter und Väter hatten dazu in Tagebüchern ihre täglichen Aktivitäten dokumentiert. Eines der zentralen Ergebnisse der Studie: Besser gebildete Eltern widmen ihren Kindern die meiste Zeit. Mütter mit Uni-Abschluss verbringen demnach 123 Minuten pro Tag mit ihrem Nachwuchs, weniger gebildete Mütter 94 Minuten. Akademiker-Väter kommen im Schnitt auf 74, weniger gebildete Väter auf 50 Minuten.
2.4 Elternschaft im Spiegel kultureller Normen
Eltern sind im Allgemeinen bestrebt, ihre Kinder dabei zu unterstützen, kompetente Mitglieder der Gemeinschaft zu werden, in der sie aufwachsen und aller Voraussicht nach als erwachsene Mitglieder leben werden. Sie interpretieren daher das Verhalten ihres Kindes in Bezug auf die bestehenden soziokulturellen Normen dieser Gesellschaft. Entsprechend fördern sie Verhaltensweisen, die ihnen angemessen erscheinen, reglementieren Verhaltensweisen ab, die für ein angemessenes Funktionieren innerhalb der Gesellschaft schädlich erscheinen. Die Auswirkungen kultureller Normen auf Erziehungsansätze sind in einer Fülle von Studien dokumentiert (Bornstein, 2012). So ist beispielsweise eine autoritäre Erziehung in nicht-westlichen Kulturen und unter ethnischen Minderheiten in westlichen Ländern weit verbreitet (Smetana, 2017). In kollektivistischen Gesellschaften, in denen die Entwicklung der Gruppe und die Interdependenz stärker betont wird als die persönliche Freiheit und Entwicklung, sind eher autoritäre Erziehungsnormen vorzufinden (Davids, Roman & Leach, 2015). In vielen asiatischen Kulturen werden beispielweise familiäre Verpflichtungen und akademische Leistungen häufig als Mittel zum Erlangen von Ehre für die Familie propagiert. Eltern asiatischer Herkunft werden deshalb auch oft als strenger und kontrollierender beschrieben, jedoch mit dem Ziel, die Kinder zu schützen und nicht zu hemmen (Doan et al., 2017). Die Überzeugungen und Praktiken der Elternschaft variieren mit den Rollen, familiären Beziehungen und Erwartungen, die durch politische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche, religiöse und gemeinschaftliche Situationen beeinflusst werden. »Wissenschaftliche« Definitionen von Elternschaft können sich von denen erfahrener Eltern mit generationenübergreifenden Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden. In der westlichen Welt hat die Bedeutung von Expertenempfehlungen für Erziehungspraktiken im letzten Jahrhundert zugenommen (Lee, 2014). So wurde beispielsweise in den 1930er Jahren in Fernsehsendungen und Werbespots die »fachkundige« Mutterschaft als eine methodische Tätigkeit propagiert, die erlernt werden sollte, während frühere Generationen neuer Mütter ihre Erziehungsfähigkeiten durch informelle Netzwerke innerhalb der Gemeinschaft und durch Familienmitglieder erlernten. Obwohl der gegenwärtige Erziehungsdiskurs Experten hervorhebt, die die Erziehungspraxis vorschreiben, müssen wir diese Vorstellung von »Expertise« ohne kontextuelle und kulturelle Überlegungen kritisch hinterfragen (Bornstein, 2012; Mousavi, Low & Hashim, 2016).
Wie bereits erwähnt (▸ Kap. 2.2, ▸ Kap. 2.3), verändert sich Elternschaft durch technologische, sozioökonomische und politische Einflüsse. Doepke und Zilibotti (2014) gehen z. B. davon aus, dass Eltern in Gesellschaften, in denen Bildung und Anstrengung hoch belohnt werden und die Möglichkeiten ohne ausreichende Bildung begrenzt sind, ihre Kinder stärker fördern als Eltern in Gesellschaften mit einer geringen Bedeutung der formalen Bildung. Die Autoren fanden mit Hilfe von Daten des World Value Survey (WVS), dass Länder wie Schweden und Norwegen mit geringer Einkommensungleichheit, großzügigen Transferleistungen und einem relativ geringen finanziellen Einsatz für Bildung einen höheren Anteil an permissiven Eltern aufweisen. In Ländern mit größeren Ungleichheiten im Bildungssektor und dem Arbeitsmarkt, wie z. B. den Vereinigten Staaten, scheinen Eltern autoritäre Erziehungsmethoden zu bevorzugen. Gemäß Doepke und Zilibotti (2014) treiben die zunehmende Einkommensungleichheit und die höheren Bildungsrenditen der letzten 30 Jahre den Trend zur Überbehütung voran, wobei die Eltern ihre Anstrengungen verstärken, um den Erfolg ihrer Kinder sicherzustellen. Faktoren wie ein stark segmentierter Arbeitsmarkt oder strenge Zulassungskriterien für prestigeträchtige Schulen oder Universitäten tragen zu diesem Effekt bei (Kwon, Yoo & Bingham, 2015). Wirtschaftliche Faktoren bringen gemäß den Autoren eine »intensive Erziehungskultur« hervor. Eltern versuchen dabei die wahrgenommene Zunahme von Risiken, Unsicherheit und Verantwortung zu bewältigen. Die Modernisierung eine Kultur veranlasst also Eltern, Formen intensiver Elternschaft zu übernehmen. Gefühlte Unsicherheiten im modernen Leben tragen zur Entwicklung einer Risikogesellschaft bei, in der Eltern risikoscheu geworden sind (Pimentel, 2016). Obwohl Kinder in modernen Gesellschaften in deutlich größerer Sicherheit aufwachsen, nehmen viele Eltern heute mehr physische und sozio-emotionale Risiken war (Faircloth, 2023). Sensationsmeldungen in den Medien tragen u. a. dazu bei, indem sie den Blick der Eltern für potenzielle Gefahren lenken und ihr Bedürfnis verstärken, Risiken in allen Lebensbereichen der Kinder zu managen (Garst & Gagnon, 2015). Gemäß Faircloth (2023) fühlen sich viele Eltern zur »Identitätsarbeit« verpflichtet. Folglich hängt der wahrgenommene Lebenserfolg der Kinder von ihnen ab, was Eltern zum Teil stark unter Druck setzen kann. Rutherford (2011) stellt zudem eine stärkere Individualisierung der elterlichen Verantwortung fest, die sich aus der sozialen Abkopplung des Individuums von der Großfamilie und Gemeinschaften ergibt. Gleichzeitig nehmen die Eltern eine Reduktion der Kontrolle und ihres Einflusses auf ihre Kinder war. Dies wiederum kann zu Besorgnis unter den Eltern führt, ob sie in der Lage sind, das Wohlergehen und den Erfolg ihrer Kinder in der Zukunft zu gewährleisten.
Auch die Gesetzgebung beeinflusst die Elternschaft. 1979 war Schweden das erste Land der Welt, das jegliche körperliche Züchtigung von Kindern verbot. Das Hauptziel dieses Verbots bestand darin, die Einstellung der Öffentlichkeit zu ändern und Kinder als eigenständige Individuen anzuerkennen (Durrant & Smith, 2010). Wie die Autoren betonen, lag der Schwerpunkt dieser Gesetzesänderung im schwedischen Kontext auf der Aufklärung der Eltern über die Bedeutung von Erziehungsmethoden. Zu diesem Zweck wurde der Reformprozess von einer groß angelegten öffentlichen Aufklärungskampagne begleitet. Seit 1979 ist die Zahl der Länder mit einer Gesetzgebung gegen den Einsatz körperlicher Bestrafung in der Erziehung kontinuierlich auf 54 im Jahr 2018 gestiegen. Man darf also davon ausgehen, dass Veränderungen der Gesetzgebung den Erziehungsstil beeinflusst und zu einem Rückgang autoritärer Erziehung beigetragen haben könnte (OECD, 2022).
2.5 Elternschaft und Lebenszufriedenheit
Immer wieder wurde der Frage nach dem Einfluss von Kindern auf das empfundene persönliche Glück bzw. die Lebenszufriedenheit von Eltern gestellt. Die Forschung zum elterlichen Glück ist im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Themen seltener, da Eltern negative Gefühle im Zusammenhang mit ihren Kindern meist nicht offen thematisieren. Darum verwenden neuere Studien zum Thema Längsschnittdaten, um das individuelle Wohlbefinden im Verlauf der Zeit zu analysieren und so einen Großteil der Selektionsprobleme zu überwinden, die in Querschnittsstudien auftreten, wie etwa die potenzielle Selektion zur Elternschaft durch das vorherige Niveau des subjektiven Wohlbefindens (Clark & Georgellis, 2013). Anhand des Deutschen Sozio-ökonomischen Panels (SOEP)5 analysierten Clark et al. (2008) das Muster des Glücks vor und nach wichtigen Lebensereignissen, u. a. die Geburt eines Kindes. Sie fanden heraus, dass innerhalb eines 10-Jahres-Fensters, mit der Geburt eines Kindes in der Mitte, das Glück sowohl von Männern als auch von Frauen vor und bis zum Zeitpunkt der Geburt tendenziell zunimmt und dann auf das Niveau vor der Geburt zurückgeht. Frijters und Kollegen (2011) analysierten australische Daten und stellten ebenfalls fest, dass das Glücksempfinden um den Zeitpunkt der Geburt herum zwar zunimmt, aber nach einigen Jahren wieder auf das Ausgangsniveau zurückgeht. Clark und Georgellis (2013) untersuchten anhand der British Household Panel Survey (BHPS), ob sich das Glück neuer Eltern an ihre neuen Lebensumstände anpasst. Beide Studien konzentrierten sich auf die kurzfristige Anpassung, berücksichtigten aber keine langfristigen Verläufe oder Unterschiede nach Geburtsreihenfolge oder sozioökonomischem Status (SES). Myrskylä und Margolis (2014) bauten auf diesen Vorbefunden auf, indem sie untersuchten, wie der Glücksverlauf von Eltern je nach Alter bei der Elternschaft, Sozioökonomischem Status (SES) gemessen an Bildung, Geschlecht, Parität, Familienstand und Kontext variiert. Die Autoren konnten zeigen, dass Eltern durch die Geburt ihres ersten Kindes zunächst unglücklicher werden. Im Durchschnitt gaben Mütter und Väter an, im ersten Jahr ihrer Elternschaft um 1,4 Einheiten weniger glücklicher zu sein als während der zwei Jahre davor. Nur knapp 30 % der Studienteilnehmer beschrieben gar keinen Verlust an Zufriedenheit. Bei einigen der befragten Eltern war die Unzufriedenheit im Jahr nach der ersten Geburt sogar stärker ausgeprägt als etwa bei Arbeitslosigkeit, Scheidung oder dem Tod des Partners. Ausgesprochen bedeutsam in diesem Zusammenhang ist aber auch der Befund, dass der glücksreduzierende Effekt von Kindern primär auf jüngere Eltern, mit weniger stabilen ökonomischen Verhältnissen zutrifft. Der Glücksverlauf vor und nach der Geburt des ersten Kindes, aufgeschlüsselt nach dem Alter der Eltern (15 – 22 Jahre, 23 – 34 Jahre, 35 – 49 Jahre) ergab sowohl in der deutschen (SOEP) als auch in der britischen (BHPS) Stichprobe den Effekt, dass das Glücksniveau im Mittel bei allen drei Gruppen in den ersten zwei Jahren nach der Geburt absank. Dieser Verlauf setzte sich nach dem 2. Lebensjahr der Kinder jedoch nur in der jüngsten Gruppe der 15 – 22-Jährigen fort. In der mittleren Gruppe der 23 – 34-Jährigen stieg das Glücksniveau auf den Zustand wie er 5 Jahre vor der Geburt war und bei der älteren Gruppe der 35 – 49-Jährigen stieg er sogar auf das Niveau von kurz vor der Geburt. Bei genauer Betrachtung der Daten müssen also die die unmittelbaren Glückseinbußen im ersten Elternjahr etwas relativiert werden, denn bei allen untersuchten Eltern stiegen die Vorfreude, und damit die angegebene Zufriedenheit in den 5 Jahren vor der Geburt des ersten Kindes deutlich über das langjährige Niveau an.
Außerdem fanden Margolis und Myrskylä (2015), dass die Erfahrungen beim Übergang zur Elternschaft eine wichtige Determinante für die weitere Fertilität von Elternpaaren sind. Ein Rückgang des Wohlbefindens rund um die erste Geburt ging mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, ein weiteres Kind zu bekommen, einher. Bei Eltern, die ein Minus von drei oder mehr Glückseinheiten berichteten, bekamen 58 % innerhalb von 10 Jahren ein zweites Kind. Empfanden die Eltern nach Geburt des ersten Kindes dagegen keine Reduktion ihres wahrgenommenen Glücks, kam es bei 66 % erneut zu einer Schwangerschaft. Dieser Effekt war besonders stark bei älteren Eltern und Eltern mit höherer Bildung ausgeprägt (Margolis & Myrskylä, 2015). Die häufigsten Ursachen für den Rückgang der Zufriedenheit nach der Geburt eines Kindes sind Schlafmangel, Schwierigkeiten in der Partnerschaft und der Verlust von Freiheit und Kontrolle über das eigene Leben. Zudem nehmen die finanziellen, persönliche Freiheiten und Zeitressourcen ab, die Hausarbeit nimmt zu und soziale Rollen bzw. das soziale Netzwerk verändert sich. Dabei spiele auch die weiterhin schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Rolle. Ebenfalls wichtig könnten auch negative Erfahrungen direkt bei der Entbindung sein. Der Effekt, dass sich ein Rückgang des wahrgenommenen Glücks bei älteren Eltern besonders negativ auf deren Fertilität auswirkte, muss jedoch kritisch betrachtet werden, denn die Wahrscheinlichkeit ein weiteres Kind zu bekommen, reduziert sich auch aus rein biologischen Gründen mit steigendem Alter.
Auch Schröder (2020) analysierte Daten einer Langzeitbefragung von ca. 85.000 Deutschen und kommt zum Schluss, dass Eltern nicht zufriedener sind als Menschen oder Kinder. Hierfür verglich er ebenfalls ein und dieselbe Person mit sich selbst, ob diese in den Jahren mit Kindern glücklicher ist als in der Zeit, in der keine Kinder im gleichen Haushalt lebten. Selbst unter den Teilnehmer*innen der Befragung, die angaben, dass ihnen Kinder sehr wichtig sind, findet sich kein positiver Effekt der Kinder auf die Lebenszufriedenheit. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt ist laut Schröder die Tatsache, dass Kinder zu finanziellen Einbußen führen. Verfügten Eltern jedoch über die gleichen finanziellen Mittel wie vor der Geburt der Kinder, steige die Zufriedenheit tatsächlich an. Diese Befunde decken sich wiederum mit den Ergebnissen der Studien von Clark und Georgellis (2013) und Myrskylä und Margolis (2014).
Forscher der Universität Heidelberg untersuchten den Einfluss von Kindern auf das langfristige Glück von Eltern und stellten fest, dass sich dieses bei den Befragten oft erst nach deren Auszug aus der elterlichen Wohnung einstellte. Die Wissenschaftler analysierten die Einträge von ca. 55.000 Menschen über 50 Jahren aus 16 europäischen Ländern (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe SHARE)6 (Malter & Börsch-Supan, 2013). In die Auswertung flossen u. a. Angaben zur Lebensqualität und zur psychischen Gesundheit ein. Erwachsene mit Kindern, die nicht mehr im selben Haushalt wohnten, beschrieben sich gemäß Becker und Kollegen (2019) als glücklicher und berichteten seltener über eine negative Stimmung als kinderlose Gleichaltrige. Die Autoren vermuten, dass eine hohe soziale Vernetzung wichtig für das Gesamtwohl und die geistige Gesundheit im höheren Alter ist. Langfristig scheinen Eltern von der Unterstützung und Bindung zu ihren Kindern zu profitieren, ohne dass sie sich in späteren Jahren weiterhin täglich um diese kümmern müssen. Bei Enkelkindern war der Einfluss auf die Zufriedenheit weniger eindeutig. Becker betont allerdings auch, dass Kinder nur ein Teilaspekt eines zufriedenen Lebens sind: »Starke soziale Kontakte gehen mit einer hohen Lebensqualität, Zufriedenheit und mentaler Gesundheit einher.
Eine wachsende Zahl von Studien hatte sich mit verschiedenen Merkmalen von Paaren während des Übergangs zur Elternschaft befasst und einige Schlussfolgerungen hinsichtlich des Verlaufs der Ehezufriedenheit gezogen. Metaanalysen weisen auf einen leichten (Mitnick, Heyman & Smith Slep, 2009) bis deutlichen Rückgang (Twenge, Campbell & Foster, 2003) der Ehezufriedenheit in den ersten 11 – 24 Monaten nach der Geburt eines Kindes hin. Die empirische Forschung zeigt aber auch, dass ein Rückgang der Ehezufriedenheit auch bei frisch Verheirateten ohne Kinder üblich ist (Lawrence, Rogers, Zajacova & Wadsworth, 2018). Eine Übersichtsarbeit, die 14 empirische Studien über Jungverheiratete umfasst, kommt zum Schluss, dass ein Rückgang der Ehezufriedenheit auf negative Erfahrungen beim Übergang zur Elternschaft, aber auch auf ein niedriges Anfangsniveau der Ehezufriedenheit zurückzuführen ist (Proulx, Ermer & Kanter, 2017).
2.6 Die Entwicklung der elterlichen Identität
Die Herausbildung eines stabilen Identitätsgefühls ist eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Menschen (Erikson, 2005). Zugleich ist die Identitätsbildung eine Aufgabe, die erhebliche Ressourcen erfordert. Nach Erikson (1966) ist die Identität der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein möchte, und dem, was die Umwelt bzw. die Gegebenheiten ihr gestatten zu sein. Die Identität bildet sich nach Erikson dabei durch die Bewältigung phasentypischer Konflikte