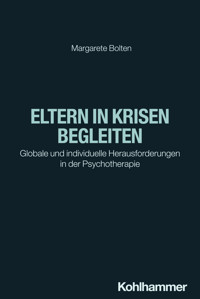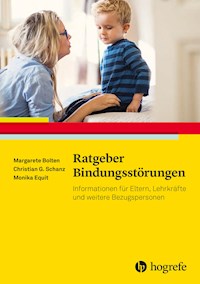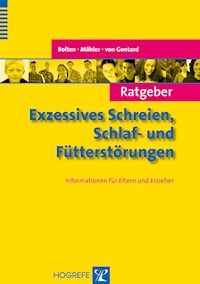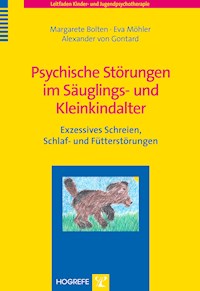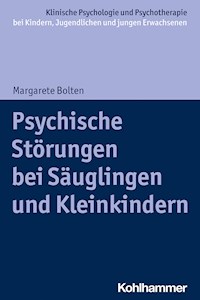
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Even very young children may show behavioural problems & especially those that are known as ?regulation disorders=, i.e. crying, sleeping and feeding disorders. Parents and caregivers are often pushed to their limits, endangering the relationship with the child during this vulnerable phase of development. This can result in long-term negative developmental courses, so that early treatment of behavioural problems in infancy and early childhood has a high preventive value. This book presents the most common psychological disorders in early childhood. In addition to the typical symptoms, the conditions that give rise to these and specific therapeutic approaches are also discussed.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Dr. rer. nat. Margarete Bolten, Co-Leiterin der Sprechstunde für Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder der Klinik für Kinder- und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPKKJ) und am Universitätskinderspital Beider Basel (UKBB).
Margarete Bolten
Psychische Störungen bei Säuglingen und Kleinkindern
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036290-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036291-8
epub: ISBN 978-3-17-036292-5
mobi: ISBN 978-3-17-036293-2
Geleitwort zur Buchreihe
Klinische Psychologie und Psychotherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Verhaltenstherapeutische Interventionsansätze
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet und ein Schrittmacher für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen im Erwachsenenalter. Für einige der für das Kindes- und Jugendalter typischen Störungsbereiche liegen empirisch gut abgesicherte Behandlungsmöglichkeiten vor. Eine Besonderheit in der Diagnostik und Therapie von Kindern mit psychischen Störungen stellt das Setting der Therapie dar. Dies bezieht sich sowohl auf den Einbezug der Eltern, als auch auf mögliche Kontaktaufnahmen mit dem Kindergarten, der Schule, der Jugendhilfe usw. Des Weiteren stellt die Entwicklungspsychopathologie für die jeweiligen Bände ein zentrales Kernthema dar.
Ziel dieser neuen Buchreihe ist es, Themen der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie und Psychotherapie in ihrer Gesamtheit darzustellen. Dies umfasst die Beschreibung von Erscheinungsbildern, epidemiologischen Ergebnissen, rechtliche Aspekte, ätiologischen Faktoren bzw. Störungsmodelle, sowie das konkrete Vorgehen in der Diagnostik unter Berücksichtigung verschiedener Informanten und das konkrete Vorgehen in der Psychotherapie unter Berücksichtigung des aktuellen Wissenstandes zur Wirksamkeit.
Die Buchreihe besteht aus Bänden zu spezifischen psychischen Störungsbildern und zu störungsübergreifenden Themen. Die einzelnen Bände verfolgen einen vergleichbaren Aufbau wobei praxisorientierte Themen wie bspw. Fallbeispiele, konkrete Gesprächsinhalte oder die Antragsstellung durchgehend aufgenommen werden.
Christina Schwenck (Gießen)Hanna Christiansen (Marburg)Tina In-Albon (Landau)
Die Herausgeberinnen
Prof. Dr. Tina In-Albon, Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Universität Koblenz-Landau. Leitung der Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche und des Studiengangs zur Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Universität Koblenz-Landau.
Prof. Dr. Hanna Christiansen, Professur für Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Philipps-Universität Marburg; Leiterin der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie-Ambulanz Marburg (KJ-PAM) sowie des Kinder- und Jugendlichen-Instituts für Psychotherapie-Ausbildung Marburg (KJ-IPAM).
Prof. Dr. Christina Schwenck, Professur für Förderpädagogische und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, Justus-Liebig-Universität Gießen. Leiterin der postgradualen Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie.
Inhalt
Geleitwort zur Buchreihe
1 Erscheinungsbild, Entwicklungspsychopathologie und Klassifikation
1.1 Entwicklungspsychopathologische Grundlagen
1.2 Symptomatik und Klassifikation
1.3 Erscheinungsbild häufiger Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter
1.3.1 Exzessives Schreien
1.3.2 Schlafstörungen und Probleme mit der Schlafregulation
1.3.3 Frühkindliche Fütter- und Essstörungen
1.4 Klassifikation im Säuglings- und Kleinkindalter
1.4.1 Klassifikation des Exzessiven Schreiens
1.4.2 Klassifikation von Schlafstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter
1.4.3 Klassifikation von Fütter- und Essstörungen
1.5 Überprüfung der Lernziele
2 Epidemiologie, Verlauf und Folgen
2.1 Epidemiologie des exzessiven Schreiens
2.2 Verlauf und Folgen des Exzessiven Schreiens
2.3 Epidemiologie der Schlafstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter
2.4 Verlauf und Folgen von Schlafstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter
2.5 Epidemiologie der Fütter- und Essstörungen
2.6 Verlauf der der Fütter- und Essstörungen
2.7 Überprüfung der Lernziele
3 Komorbidität und Differenzialdiagnostik
3.1 Komorbidität und Differenzialdiagnostik des Exzessiven Schreiens
3.2 Komorbidität und Differenzialdiagnostik bei Schlafstörungen
3.3 Komorbidität und Differenzialdiagnostik bei frühkindlichen Fütter- und Essstörungen
3.4 Überprüfung der Lernziele
4 Diagnostik und Indikation
4.1 Ziele und Struktur des diagnostischen Prozesses
4.2 Besonderheiten des diagnostischen Prozesses im Säuglings- und Kleinkindalter
4.3 Exploration und Anamnese
4.4 Kategoriale Klassifikation nach DC: 0-5
4.5 Dimensionale Symptomerfassung
4.5.1 Basisdiagnostik im Säuglings- und Kleinkindalter
4.5.2 Störungsspezifische Fragebögen
4.6 Beurteilung der Eltern-Kind-Beziehung
4.7 Beurteilung der psychosozialen Umwelt
4.8 Standardisierter Entwicklungstestung
4.9 Differenzial- und Ausschlussdiagnostik
4.10 Psychopathologischer Befund
4.11 Spezifisches Vorgehen bei Fütter- und Essstörungen
4.11.1 Diagnostik bei Gedeihstörungen
4.12 Überprüfung der Lernziele
5 Störungstheorien und -modelle
5.1 Exzessives Schreien
5.2 Schlafstörungen
5.2.1 Kindfaktoren
5.2.2 Interaktionelle Faktoren
5.2.3 Proximal extrinsische Elternfaktoren
5.3 Fütter- und Essstörungen
5.4 Überprüfung der Lernziele
6 Psychotherapie
6.1 Therapieantrag
6.2 Therapieziele und Behandlungsplan
6.3 Konzeptionelle Grundlage der Behandlung
6.4 Therapieindikation
6.4.1 Behandlung von Schrei- und Schlafproblemen im ersten Lebensjahr
6.4.2 Behandlung von Schlafstörungen ab dem zweiten Lebensjahr (ab 12 Monaten)
6.5 Überprüfung der Lernziele
7 Psychotherapieforschung
7.1 Exzessives Schreien
7.1.1 Kogitiv-behaviorale orientierte Ansätze beim Exzessiven Schreien
7.1.2 Tiefenpsychologisch orientierte Ansätze beim Exzessiven Schreien
7.1.3 Alternative Behandlungsansätze beim Exzessiven Schreien
7.2 Schlafstörungen
7.3 Fütter- und Essstörungen
7.4 Überprüfung der Lernziele
8 Rechtliche Aspekte
8.1 Einbezug der Bezugspersonen
8.2 Recht auf Information
8.3 Mitwirkungspflichte Eltern
8.4 Recht auf Geheimhaltung
8.4.1 Vorgehensweise bei einer Mitteilung an das Jugendamt
8.5 Überprüfung der Lernziele
9 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Stichwortverzeichnis
1 Erscheinungsbild, Entwicklungspsychopathologie und Klassifikation
Fallbeispiel
Pauls (14 Monate) Mutter wird in der Kinderklinik vorstellig, da sie am Rande ihrer Kräfte ist. Der Junge weist zum Zeitpunkt des Erstgespräches eine generalisierte Regulationsstörung mit Schrei-, Schlaf- und Fütterproblemen auf. Nico weigerte sich bisher (seit Beginn der Einführung fester Nahrung im Alter von 6 Monaten) feste Nahrung in Form von Brei oder Finger Food zu sich zu nehmen, so dass die Mutter in zunehmender Frequenz stillen musste. Durch das häufige Stillen entwickelte sich aber sowohl das Schlafverhalten als auch die Selbstregulation mehr und mehr dysfunktional. Zum Zeitpunkt des Eintrittes in die Kinderklinik, verlangt Nico annähernd stündlich nach der Brust, verweigert jegliche feste Nahrung und wird fast ständig von der Mutter im Arm gehalten und umhergetragen. Er weint sehr viel und schläft tagsüber kaum. Auch in der Nacht ist sein Schlaf stark fraktioniert.
Die Mutter berichtet, dass sie selbst aufgrund einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in psychiatrischer Behandlung sei. Sie könne das Schreien von Paul kaum aushalten. Das Verhalten ihres Sohnes rufe bei ihr extreme Stressgefühle und Anspannung hervor. In den letzten Wochen sei es ihr zunehmend schwergefallen, sich unter Kontrolle zu behalten. Manchmal möchte sie nur schreien. Gleichzeitig sei sie sehr gerne Mutter und betrachte Paul als ihren Lebensmittelpunkt.
Lernziele
• Sie wissen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um von auffälligem Verhalten im Säuglings- und Kleinkindalter zu sprechen.
• Sie kennen die Definition des exzessiven Schreiens nach Wessel.
• Sie kennen die häufigsten Schlafstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern, können diese beschreiben und von Normvarianten abgrenzen.
• Sie kennen mind. zwei Klassifikationssysteme, welche spezifisch für psychische Auffälligkeiten im Säuglings- und Kleinkindalter (0–5 Jahre) entwickelt wurden.
• Sie kennen den Begriff »Pädiatrische Fütterstörungen« und können ihn definieren.
1.1 Entwicklungspsychopathologische Grundlagen
Verhaltensprobleme und psychische Störungen können bereits bei Säuglingen und Kleinkindern auftreten. Entsprechend dem Entwicklungsstand sehr junger Kinder, sehen wir vor allem Schwierigkeiten mit der Verhaltensregulation in verschiedenen Kontexten. Dies ist im Altersbereich von 0–3 Jahren vor allem die Regulation von Erregungen und Stress (bzw. Emotionen), Verhaltensabläufen, des Schlaf-Wach-Rhythmus und der Nahrungsaufnahme. Im folgenden Kapitel sollen deshalb die Erscheinungsbilder der drei Hauptproblembereiche Schreien, Schlafen und Nahrungsaufnahme beschrieben werden. Dabei werden neben den jeweiligen Definitionen von Störungen in diesen Bereichen auch psychopathologische Entwicklungsmodelle und die Klassifikationsmöglichkeiten aufgezeigt.
Das Entwicklungsmodell von Sroufe (1989) sieht in den ersten sechs Lebensjahren eines Kindes folgende Entwicklungsaufgaben vor:
1. Regulierung innerer Abläufe wie beispielsweise Schlaf und Nahrungsaufnahme (0–6 Monate)
2. Bindung und motorische Selbstkontrolle (6–12 Monate)
3. Sprache, Exploration und Autonomie (1–3 Jahre)
4. Impulskontrolle und Beziehung zu Peers (3–6 Jahre)
1.2 Symptomatik und Klassifikation
Störungen in der frühen Kindheit sind eng mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems und der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben verknüpft. Daraus folgt, dass sich die Symptomatik bei sehr jungen Kindern zumeist anders als bei älteren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen äußert und sich mit zunehmendem Alter verändern kann. Folglich müssen bei der Beurteilung eines Kindes im Säuglings- und Kleinkindalter entsprechende Normvarianten von pathologischen Abweichungen des Verhaltens und der Emotionalität unterschieden werden.
Merke
In Anlehnung an Steinhausen (2019) gilt ein Verhalten dann als auffällig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) das Verhalten ist hinsichtlich des chronologischen Alters bzw. des Entwicklungsalters nicht angemessen;
b) die Symptome persistieren über eine spezifische Dauer hinweg und
c) im Rahmen soziokultureller und ökonomischer Rahmenbedingungen wird das Verhalten von der Mehrheit als nicht normativ beurteilt.
Weiterhin muss das kindliche Verhalten zu Leiden, sozialer Einengung, Beeinträchtigung der Entwicklung oder negativen Auswirkungen für andere führen.
Gemäß der im Kasten genannten Definition von auffälligem Verhalten von Steinhausen (2019), müssen Symptome im Säuglings- und Kleinkindalter zwingend in Bezug zu normativen Entwicklungsverläufen und zur erwartenden Variationsbreite von Verhaltensmerkmalen gesetzt werden. Dabei sind insbesondere die Verhaltens- und Emotionsregulation, die Aufmerksamkeitssteuerung und die Handlungskontrolle, aber auch die gesellschaftlichen und sozialen Normen für die Beurteilung relevant.
1.3 Erscheinungsbild häufiger Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter
1.3.1 Exzessives Schreien
Schreien gehört zum normalen Verhaltensrepertoire von Säuglingen. Es sichert ihr Überleben, indem es Bezugspersonen als auch Fremde motiviert, die Ursache für das Schreien zu finden, zu beheben und dadurch das Schreien zu beenden. Schreien kann viele Ursachen haben: Hunger, Müdigkeit, körperliches Unwohlsein, Schmerzen oder der Wunsch nach Nähe sind die häufigsten. Wenn Säuglinge jedoch deutlich mehr schreien, als dies von den Eltern erwartet wird, sehr unruhig und quengelig sind, kaum in den Schlaf und zur Ruhe gebracht werden können und auf angemessene Beruhigungsversuche nicht ansprechen, spricht man vom exzessiven Schreien. Das exzessive Schreien wird in der Alltagssprache auch »Drei-Monats-Koliken« oder »Kolikenschreien« genannt. Damit wird im Allgemeinen das vermehrte Schreien von Säuglingen, welches meist auf die ersten drei Lebensmonate begrenzt ist, umschrieben. Diese passagere Schreiproblematik tritt meist in physiologischen Reifungs- und Adaptationsphasen auf und geht zudem oftmals mit einer Beeinträchtigung der Schlaf-Wach-Regulation aber auch mit Problemen bei der Nahrungsaufnahme einher. Abzugrenzen ist diese zeitlich begrenzte Schreiproblematik vom persistierenden exzessiven Schreien, welches über den vierten bzw. sechsten Lebensmonat hinaus anhält. Dieses ist häufig mit einer tieferliegenden, erworbenen oder vererbten erhöhten Reaktivität auf Umweltreize bzw. größeren Schwierigkeiten die eigene Erregung bzw. Emotionen zu regulieren. Bedingt durch diese regulativen Schwierigkeiten haben die betroffenen Kinder meist auch in anderen Bereichen (z. B. beim Schlafen, beim Essen oder in Trennungssituationen) Probleme.
Merke
Das Kennzeichen des exzessiven Schreiens ist, das ein anfallsartiges, unstillbares Schreien, das ohne erkennbaren Grund bei einem ansonsten körperlich gesunden Säugling, auftritt. Angemessene Beruhigungsversuche der Eltern haben bei diesen Kindern meist keinen Erfolg.
Zur Definition des exzessiven Schreiens wird die so genannte 3er-Regel von Wessel et al. (1954) herangezogen.
Definition
Ein Kind schreit dann exzessiv, wenn die Schrei- und Unruhephasen:
1. länger als drei Stunden pro Tag,
2. öfter als dreimal pro Woche und
3. länger als drei Wochen anhalten.
Auch wenn die Schreiproblematik im Rahmen physiologischer Reifungs- und Adaptationsphasen in den ersten Lebensmonaten auftritt, geht sie jedoch zumeist mit einer erheblichen Belastung der Eltern einher. Das Schreien selbst, aber auch Schwierigkeiten bei der Schlaf-Wach-Regulation können zu einer abnormen Erregung bzw. chronischen Erschöpfung bei der Hauptbezugsperson führen. Betroffene Kinder haben oftmals nur sehr kurze Tagschlafphasen (meist weniger als 30 Minuten) und ausgeprägte Ein- und Durchschlafprobleme. Dies führt zu einer Kumulation der Schreiphasen in den späten Nachmittags- und Abendstunden durch Übermüdung bzw. Reizüberflutung.
Exzessiv schreiende Säuglinge sprechen vielfach auf angemessene Beruhigungsversuche nicht an. Zudem fallen sie sowohl während ihrer Wachphasen als auch im Schlaf durch eine erhöhte Schreckhaftigkeit auf. Die Kinder sind filterschwach auf den meisten Sinneskanälen, wodurch sie nur schlecht »abschalten« können und sehr geruchs-, geräusch-, berührungs- oder lageempfindlich sind. Da sie auf Stimuli oft mit starker Erregung reagieren, sind exzessiv schreiende Säuglinge schneller überreizt (Papousek & von Hofacker, 1998). Weitere beobachtbare Merkmale des Schreiens sind ein hoher Muskeltonus mit Überstrecken von Kopf und Rumpf, geballten Fäusten, hochroter Hautfarbe oder schriller Schreie.
Organische Ursachen können in der Regel beim exzessiven Schreien nicht gefunden werden. Akhnikh und Kolleginnen (2014) schätzen auf der Basis ihrer Literaturübersicht, dass bei weniger als 5 % aller exzessiv schreienden Säuglinge ein organisches Problem die Verhaltensschwierigkeiten erklären kann. Dies deckt sich mit Erfahrungen in klinischen Alltagssettings. Nur in äußerst seltenen Fällen konnte eine organische Ursache für das vermehrte Schreien bei Säuglingen, welche in einer Spezialambulanz für Säuglinge und Kleinkinder behandelt wurden, gefunden werden (Bolten, Glanzmann, & Di Gallo, 2020).
1.3.2 Schlafstörungen und Probleme mit der Schlafregulation
Neugeborene Kinder haben noch keinen klaren Tag-Nacht-Rhythmus. Dieser bildet sich im Verlauf der frühen Kindheit in Interaktion mit der Umwelt langsam aus (Yates, 2018). Nächtliches Aufwachen, auch weit über das erste Lebensjahr hinaus, ist also nicht zwingend als pathologisch zu werten (Mindell et al., 2016). Ob bei einem Säugling oder Kleinkind eine Schlafstörung vorliegt, hängt primär von der subjektiven Belastung durch das Ausmaß und die Häufigkeit der nächtlichen Schlafunterbrechungen für die Bezugspersonen ab (Pennestri et al., 2018).
In den ersten drei Lebensjahren treten vor allem Insomnien, also Ein- oder Durchschlafprobleme gehäuft auf. Dabei lassen sich beide Formen nicht vollständig voneinander trennen, denn Durchschlafschwierigkeiten sind meist eine Folge des Unvermögens alleine Einschlafen zu können. So finden diese Kinder am Abend und in der Nacht in der Regel nur dann in den Schlaf, wenn spezifische Gegebenheiten durch die Eltern hergestellt werden (z. B. elterliche Abwesenheit, Stillen oder Flaschenfütterung). Nicht selten benötigen diese Kinder auch die Anwesenheit der Eltern beim Einschlafen, das Sitzen der Eltern am Bett oder auch eine bestimmte Schlafumgebung wie das Elternbett. Fehlen diese Bedingungen, können die Kinder nicht einschlafen bzw. nach dem nächtlichen Erwachen wieder einschlafen. Die Verknüpfung zwischen kindlichen Schwierigkeiten in den Schlaf zu finden bzw. nach dem Erwachen diesen wieder zu erlangen und elterlichen Einschlafhilfen bzw. elterlicher Belastung wird im Rahmen der Research Diagnostic Criteria-Preschool Age (RDC-PA Kriterien; Emde, 2003) deutlich berücksichtigt.
Good to know
Die RDC-PA berücksichtigt die normative Schlafentwicklung im frühen Kindesalter und betont explizit, dass erst ab dem Alter von 12 Monaten von einer Schlafstörung gesprochen werden darf, da vorher die Fähigkeit zur vollständig unabhängigen Schlafregulation bzw. der Fähigkeit alleine in den Schlaf zu finden noch nicht ausgereift ist.
Eine Durchschlafstörung wird insbesondere bei Kindern in den ersten 6 Monaten nur bei erheblicher elterlicher Belastung als pathologisch angesehen. Junge Säuglinge sind zu Beginn noch sehr stark von der ko-regulatorischen Unterstützung durch die Eltern bei der Schlaf-Wach-Regulation abhängig, so dass Probleme in diesem Bereich im ersten Lebensjahr nicht als Schlafstörung im eigentlichen Sinne betrachtet werden sollten. Wiederholtes, kurzes nächtliches Aufwachen ist im Säuglingsalter physiologisch sinnvoll, da zum einen auch in der Nacht noch Energie aufgenommen werden muss (Kersting, Przyrembel, Zwiauer, & Baerlocher, 2014). Zum anderen sind die zwei Schlafregulationsmechanismen zirkadianer Rhythmus und Schlafhomöostase noch nicht so weit ausgereift, dass nächtliches Erwachen in der frühen Kindheit als normativ betrachtet werden muss (Jenni & Benz, 2007). Hinzu kommt, dass auch die Fähigkeit zur Selbstregulation im Kontext der Schlaf-Wachregulation ebenfalls erst ausreifen muss, um ohne Einschlafhilfe zur Ruhe und in den Schlaf zu finden. Entsprechend brauchten in einer Untersuchung von Goodlin-Jones et al. (2001) 50 % der 12 Monate alten Kinder noch Unterstützung beim Einschlafen durch die Eltern. Ergebnisse von Sadeh und Kolleginnen (2009) fanden auf der Basis einer großen Internetbefragung, dass Kinder im ersten Lebensjahr im Mittel 1- bis 2-mal in der Nacht erwachen und zwischen 30 und 60 Minuten wach sind. Weiterhin berichten die Autoren, dass 22 % der unter 3-jährigen Kinder nur in elterlicher Anwesenheit (eigenes Bett oder Bett der Eltern) einschliefen. Auch bei den Durchschlafstörungen zeigten die Ergebnisse, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Säuglinge und Kleinkinder in der untersuchten Stichprobe beim nächtlichen Erwachen ohne elterliche oder anderweitige exogene Einschlafhilfe wieder einschläft. Im Verlauf des zwei Lebensjahres erwerben jedoch die meisten Kinder die Fähigkeit, ohne wesentliche elterliche Hilfe einzuschlafen.
Merke
Nächtliches Erwachen bei Säuglingen sollte als normativ angesehen werden. Nur wenn häufiges Aufwachen mit einer erheblichen Belastung der Eltern verbunden ist, hat es pathologischen Wert.
1.3.3 Frühkindliche Fütter- und Essstörungen
Das Essverhalten eines Säuglings bzw. Kleinkindes entwickelt sich immer im Zusammenspiel komplexer Mechanismen, Erfahrungen und der Interaktionen mit seinen Bezugspersonen (Abb. 1.1).
Abb. 1.1: Einflussfaktoren auf des Essverhalten im Säuglings- und Kleinkindalter
Neben reifungsassoziierten Faktoren wie beispielsweise die anatomische und kognitive Reife sowie oralmotorische Fähigkeiten, haben physiologische Regelmechanismen von Hunger und Sättigung eine zentrale Bedeutung bei der Entwicklung des Essverhaltens und der Esskompetenz von Säuglingen bzw. Kleinkindern. Zusätzlich spielen aber auch eine Vielzahl von Lerneinflüssen eine Rolle. Die Lernumwelt wird im Säuglings- und Kleinkindalter vor allem durch die Interaktionen mit Eltern bestimmt. Die Eltern oder Bezugspersonen machen Nahrungsangebote und strukturieren den Tag bzw. die Mahlzeiten, sie füttern aber auch das Kind und setzen Grenzen. Eltern geben im Zusammenhang mit der Essentwicklung die Entwicklungsreize in Form der Nahrungsangeboten. Werden einem Kind nur eingeschränkte Angebote an Nahrungsmitteln gemacht, können auch keine neuen Erfahrungen im Verarbeiten (Beißen, Kauen, Schlucken) gewonnen werden. Dadurch ist das Kind in seinen keine Entwicklungsschritten im Hinblick auf die Erweiterung des Nahrungsmittelspektrums eingeschränkt. Im Zusammenhang mit den Lernerfahrungen sind aber auch Traumatisierungen im Mund-Rachen-Bereich zu nennen. Diese können z. B. durch forciertes Füttern, unsachgemäße Zubereitung der Nahrung (hohe Temperaturen), Verschlucken und Erbrechen oder aber auch durch intensivmedizinische Maßnahmen entstehen. In diesem Gefüge können also auch Störungen der normativen Essentwicklung auftreten.
Generell erscheint es sinnvoll, Fütterstörungen und Essverhaltensstörungen zu unterscheiden. Bei Fütterstörungen erfolgt die Nahrungsaufnahme in dyadischen Beziehungen, da ein unabhängiges Essen des Kindes aufgrund seines Entwicklungsstandes noch nicht möglich ist. Bei den Essverhaltensstörungen können Kinder unabhängig von ihren Bezugspersonen selber essen. Streng genommen sollte deshalb der Begriff »Fütterstörungen« auf Säuglinge oder Kindern mit Entwicklungsstörungen beschränkt sein, welche nicht selbstständig essen können.
In den letzten Jahren gab es vielfältige Veränderungen und Anpassungen bei den verschiedenen Definitionen von Ess- und Fütterstörungen im frühen Kindesalter. Die Revisionen waren dringend notwendig, da die Definitionen der traditionellen Klassifikationssysteme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) und der 4., überarbeiteten Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) teilweise im klinischen Alltag problematisch waren. So wird die »Fütterstörung im frühen Kindesalter« (F98.2) in der ICD-10 als »eine für das frühe Kindesalter spezifische Störung beim Gefüttert-werden« beschrieben (Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2006). Außerdem muss es definitorisch beim Kind zu einem Gewichtsverlust bzw. keiner Gewichtszunahme in Abwesenheit anderer psychischer oder organischer Krankheiten kommen. Diese Definition ist in vielerlei Hinsicht problematisch, da sie die anhaltende Unfähigkeit, adäquat zu essen, nur sehr allgemein formuliert. Zum anderen wird eine mangelnde Gewichtszunahme bzw. mangelndes Gedeihen vorausgesetzt. Gedeihstörungen sind jedoch nicht zwangsläufig mit Fütter- und Essstörungen assoziiert. Wie Chatoor (2016) ausführt, sind Gedeihstörungen (»Failure to thrive«) ein mögliches Symptom einer Fütter- und Essstörung, aber keine zwingende Voraussetzung für die Vergabe der Diagnose. Mit anderen Worten, manche Fütterstörungen gehen mit einer mangelnden Gewichtszunahme einher, während andere Kinder trotz massiver Essstörung sehr gut gedeihen. Auch der Ausschluss medizinischer Krankheitsfaktoren muss kritisch bewertet werden. Natürlich müssen alleinige organische Ursachen für eine Fütter- und Essstörung ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite gibt es Kinder mit organischen Grunderkrankungen, die komorbid eine Fütter- und Essstörung entwickelten, welche trotz erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung nicht verschwindet (Berlin, Lobato, Pinkos, Cerezo, & LeLeiko, 2011). Ferner haben neuere Studien (Krom et al., 2019; Norris, Spettigue, & Katzman, 2016) wiederholt zeigen können, dass komorbide psychische Störungen bei Fütter- und Essstörungen sehr häufig sind. Internalisierende (vor allem Angststörungen) und externalisierende Störungen (vor allem Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten), aber auch Autismus-Spektrums-Störungen sind typische komorbide Störungen. Und abschließend muss bemängelt werden, dass der interaktionelle Aspekt einer Fütterstörung vollkommen ausgeblendet wird.
Eine Neuerung im DSM-5 ist, dass es keine Fütterstörung im Säuglings- oder Kleinkindalter mehr gibt, sondern dass Probleme mit der Nahrungsaufnahme sowohl bei Säuglingen und Kleinkindern als auch bei Erwachsenen im Rahmen einer Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme (Avoidant/restrictive food intake disorder; ARFID; Association, 2013) klassifiziert werden können. Dabei handelt es sich um eine Ernährungs- bzw. Fütterstörung ohne Gewichts- und Figursorgen. Die ARFID ist mit einem signifikanten Gewichtsverlust, signifikantem Nährstoffmangel, Abhängigkeit von Sondennahrung oder einer signifikanten Beeinträchtigung der psychosozialen Funktion verbunden. Nahrungsmittelknappheit, kulturelle Praktiken, Anorexia, Bulimia Nervosa oder körperliche Erkrankungen müssen als Alternativerklärungen für das gestörte Essverhalten ausgeschlossen werden.
Assoziierte Störungsbilder der ARFID können in drei Subkategorien eingeteilt werden: Ernährungsstörung aufgrund (a) einer allgemeinen unangemessenen Nahrungsaufnahme, (b) einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln oder (c) aufgrund einer spezifischen Angst, sind jeweils mit deutlichen Einschränkungen der akzeptierten Nahrungsmitteln und der aufgenommenen Nahrungsenergie verbunden (Bryant-Waugh, Markham, Kreipe, & Walsh, 2010).
a) Die Nahrungsvermeidung mit emotionaler Störung (Food avoidance emotional disturbance; FAED) wurde erstmals von Higgs, Goodyer und Birch (1989) für Kinder mit einer emotionalen Störung und einer damit einhergehenden Nahrungsvermeidung verwendet. Die Nahrungsvermeidung oder restriktive Nahrungsaufnahme muss mindestens einen Monat präsent sein ohne organische Hirnstörung, Psychose, Drogenmissbrauch oder Medikamenteneinwirkung. Kinder mit FAED erleben häufig emotionale Spannungen mit Sorgen oder Traurigkeit, die den Appetit und den Hunger beeinflussen, ohne das ein Gewichtsverlust angestrebt wird (Bryant-Waugh et al., 2010). FAED geht oft mit Untergewicht, Wachstumsstörungen und einem reduzierten Allgemeinzustand einher (Bryant-Waugh, 2013).
b) Die vermeidend/restriktive Ernährungsstörung aufgrund einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln, Picky Eating oder selektivem Essen ist durch ein extrem eingeschränktes Nahrungsspektrum und eine starke Vorliebe für ausgewählte Lebensmittel aufgrund von sensorischen oder anderen Merkmalen (Farbe, Geschmack, Konsistenz oder Marke) gekennzeichnet (Bryant-Waugh, 2019). In dieses Spektrum fällt auch die Food Neophobie, also die Ablehnung neuer, unbekannter Lebensmittel (Lobos & Januszewicz, 2019). Zwischen dem extrem selektiven Essverhalten und der Neophobie wurden bisher große Überschneidungen (Cole, An, Lee, & Donovan, 2017) beobachtet. Zudem gibt es eine Häufung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (Wallace, Llewellyn, Fildes, & Ronald, 2018). Weitere Ernährungsstörungen aufgrund einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln sind die von Chatoor (2016) beschriebene »Sensorische Nahrungsvermeidung« und das »Perseverant eating«, also das alleinige Akzeptieren von Babynahrung (Bryant-Waugh, 2019). Im Normalfall hat diese Form der vermeidend/restriktiven Ernährungsstörung keinen Einfluss auf das Gewicht und das Wachstum. Allerdings kann es, je nach Nährstoffzusammensetzung der akzeptierten Lebensmittel, zu Mangelerscheinungen und Wachstumsstörungen kommen (Cooney, Lieberman, Guimond, & Katzman, 2018).
c) Eine vermeidend/restriktive Ernährungsstörung aufgrund einer spezifischen Angst wird auch Nahrungsphobie (NP) genannt, kann als isoliertes Symptom mit akutem Beginn oder als Symptom anderer Störungen auftreten. Die Ernährungsphobie unterliegt häufig einem vorausgehenden traumatischen Erlebnis, wie zum Beispiel würgen (Kreipe & Palomaki, 2012). Die wohl bekannteste Ernährungsphobie ist die funktionelle Dysphagie, bei der die Kinder aufgrund einer Angst vor dem Erbrechen bzw. Würgen Nahrung verweigern. Diese Phobie steht im engen Zusammenhang mit der Emetophobie, einer spezifischen Phobie vor dem Erbrechen (Bryant-Waugh & Lask, 2007).
Im Rahmen der Revision des Klassifikationssytems ZERO TO THREE wurden in der DC: 0-5 (ZERO TO THREE: National Center for Infants, 2016, 2019) die Fütterstörungen in »Essstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter« umbenannt und enthalten nun zwei Hauptklassen: Essstörung mit Überessen (Overeating Disorder) und Essstörung mit Nahrungsverweigerung (Undereating Disorder) sowie eine Restkategorie (Atypical Eating Disorder). Die Essstörung mit Nahrungsverweigerung entsprechen den Frühkindlichen Fütterstörungen der ICD-10, jedoch werden hier acht verschiedene Symptome unterschieden, durch welche sich die Essstörung manifestieren kann. Die DC: 0-5 stellt die durchgängige Weigerung altersadäquat zu Essen ins Zentrum seiner Definition einer Essstörung im frühen Kindesalter. Dabei kann altersadäquat vielerlei bedeuten und ist nicht zwangsläufig nur durch eine mangelnde Nahrungsaufnahme bzw. Gewichtszunahme definiert. Vielmehr spricht das DC: 0-5 auch von einer Essstörung, wenn das Kind bestimmte Verhaltensmuster, wie beispielsweise ein fehlendes Interesse am Essen, extrem selektives Essen oder sehr langes im-Mund-behalten zeigt oder Interaktionen beim Füttern/Essen dysfunktionale Auffälligkeiten aufweisen (z. B. nur im Schlaf, mit Zwang oder Ablenkung).
Sowohl aus der klinischen Praxis, als auch aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass Kinder mit Fütter- und Essstörungen oftmals eine Vielzahl von weiteren Begleiterkrankungen (psychische und organische) und Einschränkungen haben (Berlin et al., 2011; Norris et al., 2016; Rommel, De Meyer, Feenstra, & Veereman-Wauters, 2003). Auch Goday et al. (2019) kritisieren in einem Konzeptpapier, dass Fütterstörungen bisher jeweils nur aus der Perspektive einer Disziplin (z. B. Psychiatrie) betrachtet wurden, was zu den bereits oben beschriebenen Problemen der Definition führte. Sie schlagen deshalb den Begriff der »Pädiatrischen Fütterstörungen« (Pediatric feeding disorders, PFDs) vor. Voraussetzung für die Vergabe dieser Diagnose ist eine über mind. 2 Wochen anhaltende Störung der Nahrungsaufnahme, die mit medizinischen Komplikationen (kardiorespiratorische Probleme, wiederkehrende Aspirationen), ernährungsbedingten Dysfunktionen (Mangelernährung, Nährstoffmangel, Notwendigkeit von Sondennahrung oder Nährungsergänzungsmitteln), Dysfunktion in den Essfertigkeiten (Pürieren/Andicken von Nahrungsmitteln, Anpassung von Positionierung/Hilfsmitteln oder Fütterstrategien erforderlich) oder psychosoziale Dysfunktionen (Vermeidungsverhalten, ungeeignete Fütterstrategien der Bezugspersonen, beeinträchtige soziale Funktionen, beeinträchtige Eltern-Kind-Beziehung) assoziiert ist und nicht auf kognitive Prozesse (wie z. B. bei Anorexie), einem Mangel an Nahrung bzw. kultureller Normen erklärbar sind (vgl. Goday et al., 2020).
Die vorgeschlagene Definition erleichtert die multidisziplinäre Arbeit auf den vier potenziell beeinträchtigen Ebenen: organische bzw. medizinische Komplikationen, beeinträchtigte Ess- und Schluckfertigkeiten, Nährstoffversorgung und psychische Beeinträchtigung.
Merke
Eine besondere Form der frühkindlichen Fütter- bzw. Essstörung ist die Sondendependenz. Von Sondendependenz sprechen wir dann, wenn aufgrund erfüllter medizinischer Indikation die Sondenernährung beendet werden könnte, der Übergang zu einer ausreichenden oralen Ernährung vom Kind jedoch nicht gemeistert wird. Das Kind wird somit unbeabsichtigt von der ursprünglich nur als vorübergehend geplanten Sondierung ohne weitere medizinische Indikation abhängig. Bei dieser Form der Fütterstörung haben wir es mit einem aktiven Widerstand bzw. starker Abwehr gegenüber oraler Ernährung zu tun, der bei jedem Kontakt mit flüssigen, breiigen und festen Speisen erfolgt. Somit wird die Sondierung bei ausreichender körperlicher und oralmotorischer Funktion allein aufgrund der anhaltenden Nahrungsverweigerung fortgesetzt.
1.4 Klassifikation im Säuglings- und Kleinkindalter
Das Ziel der Klassifikation ist es, die große Zahl klinischer Bilder nach übergeordneten Gesichtspunkten der Ähnlichkeit zu gruppieren und auf eine überschaubare Menge typischer Systemkonstellationen zu reduzieren (Wittchen, 2011). Die kategoriale Diagnostik dient dazu, eine sinnvolle Informationsreduktion vorzunehmen, um eine klar definierte Nomenklatur zu bieten, die Kommunikation zwischen Fachpersonen zu erleichtern und darauf aufbauend einen schnellen Zugriff auf therapeutisches Störungswissen zu ermöglichen (Suppiger & Schneider, 2009). Des Weiteren ist die Klassifikation sie Voraussetzungen für die Therapieindikation und Therapieforschung.
Sowohl bei Kindern und Jugendlichen, als auch bei Erwachsenen, werden zur diagnostischen Klassifikation primär die »Internationale Klassifikation Psychischer Störungen« (ICD-10; WHO, 1991) und das »Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen« (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013) eingesetzt. Wesentliches Merkmal beider Systeme ist der deskriptive Ansatz, bei dem sich die Diagnosekriterien vor allem auf beobachtbare Merkmale einer Störung beziehen und hinsichtlich Ätiologie und Pathogenese weitgehend atheoretisch sind. Da jedoch die meisten Diagnosekriterien des ICD-10 und DSM-5 für Erwachsene erarbeitet wurden, gibt es bei der Anwendung im Säuglings- und Kleinkindalter erhebliche Schwierigkeiten. So fehlen beispielsweise an die verschiedenen Entwicklungsphasen angepasste Kriterien. Manche für diese Altersspanne typischen Verhaltensstörungen fehlen vollständig (z. B. exzessives Schreien, Beziehungsstörungen, sensorische Verarbeitungsstörungen). Aus diesem Grund wurde von der Arbeitsgruppe »ZERO TO THREE« am National Center for Infants, Toddlers and Families 1994 erstmals ein multiaxiales Diagnosesystem zur Klassifikation psychischer Auffälligkeiten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr eingeführt (DC: 0-3) und 2016 überarbeitet. Die aktuell gültige Fassung der Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0-5, 2016, 2019) ist für Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr geeignet und berücksichtigt im Vergleich zu den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 in höherem Maße altersspezifische Besonderheiten und entwicklungspsychologische Zusammenhänge von Verhaltensstörungen in dieser Altersspanne. Insbesondere die schnellen Veränderungen in der sozioemotionalen Entwicklung und die hohe Relevanz des Beziehungssystems der Kinder in diesem Altersbereich werden bei der Diagnosevergabe mit beachtet.
Auf der Achse III finden sich medizinische Krankheiten und Faktoren, die die psychische Gesundheit direkt oder indirekt beeinflussen können. Komplikationen in der Schwangerschaft oder perinatal werden ebenfalls auf Achse III berücksichtigt. Auf Achse IV werden die psychosozialen Belastungsfaktoren mit Hilfe von Kategorien und spezifischen Stressoren erfasst. Psychosoziale Faktoren beinhalten akute Ereignisse als auch andauernde Umstände wie z. B. Armut oder häusliche Gewalt. Stressoren können zudem direkt (z. B. Hospitation) oder indirekt (z. B. plötzliche Krankheit eines Elternteils) vorliegen. Auch Übergänge oder normale Ereignisse, wie die Geburt eines Geschwisters oder ein Umzug, können stressreich sein. Achse V beschreibt Entwicklungskompetenzen. Dabei werden die folgenden Entwicklungsbereiche berücksichtigt: die emotionale, soziale, sprachliche, kognitive, als auch die motorische und körperliche Entwicklung. Für die Einschätzung beinhaltet das DC:0-5 eine Übersicht an Meilensteinen der Entwicklung für das Alter von 3 bis 60 Monaten.
Entsprechend der Erweiterung der Altersspanne, für welche das DC: 0-5 anwendbar ist, wurden neue Störungsbilder für Kinder bis zum fünften Lebensjahr eingeschlossen. Bezüglich des Altersbereiches zwischen 0 und 3 Jahren gab es folgende Anpassungen.
In der Anwendung der DC: 0-3 fanden sich jedoch auch einige Schwierigkeiten. So berichten beispielsweise Wiefel et al. (2005) besonders bei der Klassifikation von Fütterstörungen, aber auch bei der Abgrenzung der einzelnen Subtypen der Regulationsstörungen von Problemen. Für die Bindungsstörungen wurden ebenfalls ausführlichere Kriterien gefordert.
1.4.1 Klassifikation des Exzessiven Schreiens
Sowohl die ICD-10 als auch das DSM-5 bieten keine Klassifikationsmöglichkeiten für frühkindliche Regulationsstörungen und damit auch nicht für das exzessive Schreien. Daher kann im Säuglingsalter mit beiden Klassifikationssystemen exzessives Schreien nicht angemessen klassifiziert werden. Die einzige, allerdings unbefriedigende Möglichkeit ist die Vergabe der Diagnose einer Anpassungsstörung mit Exzessivem Schreien (F43.2). Eine solche Störung wird diagnostiziert, wenn eine identifizierbare psychosoziale Belastung, von einem nicht außergewöhnlichen oder katastrophalen Ausmaß vorliegt, die Symptome und Verhaltensstörungen wie bei anderen Störungen vorliegen und diese Symptome nicht länger als sechs Monate nach Beendigung der Belastung andauern.
Diagnostische Kriterien der Anpassungsstörungen ICD-10, F43.2
A. Identifizierbare psychosoziale Belastung, von einem nicht außergewöhnlichen oder katastrophalen Ausmaß; Beginn der Symptome innerhalb eines Monats.
B. Symptome und Verhaltensstörungen, wie bei F3 (außer Wahngedanken und Halluzinationen), F4 oder F91, die Kriterien einer einzelnen Störung werden aber nicht erfüllt.
C. Die Symptome dauern nicht länger als sechs Monate nach Ende der Belastung oder ihrer Folgen an, außer bei der längeren depressiven Reaktion (F43.21).
Diagnostische Kriterien der Anpassungsstörung nach DSM-51
A. Die Entwicklung von emotionalen oder behavioralen Symptomen als Reaktion auf einen identifizierbaren Belastungsfaktor, die innerhalb von 3 Monaten nach Beginn der Belastung auftreten.
B. Diese Symptome oder Verhaltensweisen sind insofern klinisch bedeutsam, als sie eines oder beide der folgenden Kriterien erfüllen:
1. Deutliches Leiden, welches unverhältnismäßig zum Schweregrad und zur Intensität des Belastungsfaktors ist, nach Berücksichtigung des externen Umfelds und kultureller Faktoren, die den Schweregrad und das Beschwerdebild der Symptome beeinflussen können.
2. Bedeutsame Beeinträchtigung in sozialen, [beruflichen] oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
C. Das belastungsabhängige Störungsbild erfüllt nicht die Kriterien für eine andere psychische Störung und stellt nicht nur eine Verschlechterung einer vorbestehenden psychischen Störung dar.
D. Die Symptome sind nicht Ausdruck einer gewöhnlichen Trauerreaktion.
E. Wenn die Belastung oder deren Folgen beendet sind, dauern die Symptome nicht länger als weitere 6 Monate an.
Bestimme, ob:
F43.21 Mit Depressiver Stimmung: Gedrückte Stimmung, Weinerlichkeit oder Gefühle der Hoffnungslosigkeit stehen im Vordergrund.
F43.22 Mit Angst: Nervosität, Sorgen, Überspanntheit oder Trennungsangst stehen im Vordergrund.
F43.23 Mit Angst und Depressiver Stimmung, Gemischt: Eine Kombination von Depression und Angst steht im Vordergrund.
F43.24 Mit Störung des Sozialverhaltens: Eine Störung des Sozialverhaltens steht im Vordergrund.
F43.25 Mit Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens, Gemischt: Sowohl emotionale Symptome (z B Depression, Angst) als auch eine Störung des Sozialverhaltens stehen im Vordergrund.
F43.20 Nicht Näher Bezeichnet: Für unangepasste Reaktionen, die sich nicht als eine der spezifischen Subtypen der Anpassungsstörung klassifizieren lassen.
Bestimme, ob:
Akut: Wenn das Störungsbild weniger als 6 Monate anhält.
Andauernd (Chronisch): Wenn das Störungsbild 6 Monate oder länger anhält.
Im DC: 0-5 gibt es dagegen die Störungskategorie der »Exzessiven Schreistörung«, welche auf der 3er-Regel von Wessel aufbaut. Zudem gibt es eine weitere Klassifikationsmöglichkeit, welche am ehesten dem im deutschsprachigen Raum verwendeten Konzept der Regulationsstörungen entspricht: »Andere Schlaf-, Ess- und Schreistörungen der frühen Kindheit«.
Diagnostische Kriterien der Exzessiven Schreistörung DC:0-5 (ZERO TO THREE, 2019)
A. Das Kind schreit mindestens drei Stunden am Tag, an drei oder mehr Tagen pro Woche seit mindestens drei Wochen (»3er-Regel«).