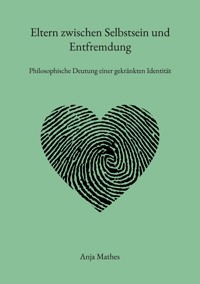
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eltern kennen das: Den ganzen Tag haben sie sich nur um andere gekümmert, und keiner hat es bemerkt. Denn wenn wir nicht arbeiten, haben wir ja frei. Aber ist das fair? Und wie kommt es, dass wir uns dann auch noch schuldig fühlen, wenn wir Erziehungszeit nehmen? Obwohl wir uns fragen, ob es überhaupt noch unser Leben ist, das wir führen? Denn um uns selbst zu verwirklichen, fehlt uns mit Kindern schließlich die Zeit. - Glauben wir. Anja Mathes hat untersucht, was dieses Selbst eigentlich ist - und warum es bei Eltern ins Wanken gerät. Sie war junge Mutter, als sie mit dieser Frage ihre Magisterarbeit an der Universität Heidelberg mit 1,0 abgeschlossen hat. Aus der Perspektive der praktischen Philosophie zeigt sie, wie Identitätskrisen mit (fehlender) Anerkennung zusammenhängen und welche historischen Entwicklungen dazu geführt haben, dass Eltern besonders gefährdet sind, unter den Bedingungen moderner westlicher Gesellschaften Identitätskrisen zu erleiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem unsere zweite Tochter geboren war, konnte ich mich gut erinnern, warum ich damals, nach der Geburt unserer ersten Tochter, das Thema Elternschaft und Entfremdung für meine Magisterarbeit gewählt habe. Um durchzuhalten, musste ich jeden Tag erleben, dass das, worüber ich da nachdachte, von Bedeutung war. Ich war junge, alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes, das noch keine Nacht durchschlief, unsagbar müde, hunderte Kilometer vom Vater meines Kindes entfernt – entschlossen, mein Studium noch zu einem guten Ende zu bringen. Und ich blickte verängstigt in meine Zukunft, weil diese mir etwas abzuverlangen schien, was ich nicht bereit war, zu geben: meine Werte und meine Prioritäten im Leben.
Unser zweites Kind war geplant und ich nicht mehr alleinerziehend; aber die Grenzen, an die wir als Eltern im Alltag immer wieder stoßen, zeigen mir erneut die Relevanz dieses Themas, weshalb ich mich dafür entschieden habe, meine Magisterarbeit zu veröffentlichen.
Da ich diese Arbeit hier nicht als Qualifikationsschrift einreiche, sondern zur Ermutigung anderer Eltern zugänglich mache, habe ich die wissenschaftlichen Standards, an die ich mich bei dieser Arbeit halten musste, im Sinne der besseren Verständlichkeit und Leserfreundlichkeit reduziert. Dies betrifft etwa den Fußnotenapparat einschließlich etlicher Quellenverweise, den ich mir erlaubt habe, erheblich zu verschlanken. In meiner Arbeit wird auch so immer deutlich, bei wem ich gedankliche Anleihen nehme und auf wen ich mich beziehe. Für tiefer Interessierte belasse ich mein vollständiges Literaturverzeichnis gern im Anhang.
Ganz den förmlichen Charakter einer akademischen Schrift konnte ich der folgenden Arbeit nicht nehmen. Umso mehr freue ich mich über jeden Einzelnen, der dieses Buch meistert – und dem ich ein Stück helfen kann, sich wieder mit einem guten Gefühl in seinem Leben zurechtzufinden.
Anmerkung:
In diesem Buch verteidige ich alle, die Erziehungsarbeit leisten, vom Hausmann bis zur Unternehmenschefin. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass ich Teil einer Frauen-zurück-an-den-Herd-Bewegung bin. Die Errungenschaften, die es Frauen ermöglicht haben, sich nicht ausschließlich als Mütter, sondern auch beruflich zu verwirklichen, erachte ich als unverzichtbar und nicht verhandelbar. Mir ist bewusst, dass auch Eltern, die ihrer Erwerbsarbeit mit Hingabe nachgehen, sich oft gezwungen sehen, ihre Entscheidung zu verteidigen. Das halte ich für ebenso falsch.
Unsere Kinder brauchen zufriedene Eltern – die jeden Tag spüren, dass sie in ihrem Tun wertgeschätzt werden.
So oder so.
Anja Mathes
Inhalt
1.
Einleitung
2.
Entfremdung als diagnostischer Begriff
2.1. Entfremdung und die Verdeckung praktischer Fragen
2.2. Verdeckung praktischer Fragen durch das Mutterideal?
2.3. Zum Begriff der Selbstverwirklichung
3.
Bedingungen gelingender personaler Identität
3.1. Das anthropologische Selbstkonzept Charles Taylors
3.2. Anerkennung
3.3. Missachtung und persönliche Identität
4.
Die Verfasstheit der Moderne
4.1. Entstehung und Merkmale der modernen Identität
4.2. Selbstbilder im Widerstreit
4.3. Der Sieg der Effizienz
5.
Ergebnis und Perspektiven
Literatur
1. Einleitung
„Philosophie, wie ich sie verstehe, ist der Versuch, begriffliches Licht in wichtige Erfahrungen des menschlichen Lebens zu bringen.“1
Aufgrund ihrer Unwiderruflichkeit und aller Konsequenzen, die sie für uns als Menschen birgt, muss als eine solche wichtige Erfahrung die Elternschaft gelten. Die Entscheidung für ein Kind ist wohl eine der folgenreichsten Entscheidungen, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Dass sich die zeitgenössische Philosophie dennoch so erstaunlich wenig mit der Erfahrung von Elternschaft auseinandersetzt, war Dieter Thomä ein Anlass, diese riskante Lebensform einer philosophischen Betrachtung zu unterziehen. Angesichts dessen, was die Elternschaft für eine Lebensführung bedeute, solle die Philosophie sich zu dieser Aufgabe wieder berufen fühlen. Ich stimme zu.
In seiner Betrachtung fragt Thomä danach, warum Menschen sich trotz aller erwartbaren persönlichen Entbehrungen überhaupt noch in die Elternschaft begeben – zumal in einer Zeit, in der aufgrund unseres Rentensystems ihre Versorgung im Alter auch ohne Kinder als gewährleistet gelten kann und sich Kinderlose nicht mehr der Stigmatisierung ausgesetzt sehen, zulasten der Gesellschaft zu leben.2 Die kulturelle Bewertung der Kinderlosigkeit ist heute nicht mehr negativ: Als Alternative zur Familie als Lebensform verbreiten sich seit einigen Jahrzehnten individualistische Lebensformen, nicht zuletzt, weil Restriktionen durch Kirche, Staat oder traditionelle Normen weggefallen sind – übergeordnete Gesichtspunkte, die Menschen in früheren Zeiten Eltern werden ließen. Darum müsse nun die Art des Lebens in den Blick geraten, für die sich Menschen, die Kinder bekommen, entschieden. Diesen Blick will ich im Folgenden wagen. Es ist dabei nicht Anspruch dieser Arbeit, die Untersuchung Thomäs einer umfassenden kritischen Würdigung zu unterziehen. Doch war es eine von Thomä aufgeworfene Frage, die den Anstoß für diese Arbeit gab – und zwar die Frage, ob eine Entscheidung für Kinder eine Entscheidung gegen uns selbst sei. Geben wir unser eigenes Leben aus der Hand, um es in den Dienst von anderen, namentlich unseren Kindern zu stellen, wenn wir Eltern werden? Lassen wir mit dieser Entscheidung einen großen Teil von uns selbst zurück?
Relevanz spreche ich dieser Frage zu, weil es mich, seit ich selbst Mutter wurde, betroffen macht zu beobachten, wie Menschen, die vor ihrer Elternschaft mit ihrem Leben zufrieden waren, immer wieder darum ringen und manchmal daran scheitern, ein positives Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, seit sie Kinder bekamen – obwohl sie ihrer Elternschaft mit Vorfreude entgegengesehen hatten.
Wenn Menschen an diesem Punkt ihres Lebens das Gefühl für sich selbst verlieren, die Orientierung, was für sie eigentlich von Bedeutung ist, kann man von einer Identitätskrise sprechen.3 Ich will im Rahmen dieser Betrachtung dem Zusammenhang zwischen den Erfahrungen von Elternschaft und Identitätsverlust nachgehen.
An dieser Stelle liegt der Einwand nahe, dass es in der Natur der praktizierten4 Elternschaft liegt, ein individuelles Leben und die Person, die es führt, nicht unberührt zu lassen. Das Selbstverständnis einer jeden Person unterliegt im Laufe ihres Lebens zudem zwangsläufig einem dynamischen Veränderungsprozess. Doch die Deutung und Bewertung, die wir einzelnen Elementen unserer Biografie geben, hängt dabei in hohem Maße von der Art unseres Selbstverständnisses ab, weshalb jenem in meiner Untersuchung eine Schlüsselrolle zukommt. Es ist unsere Bewertung auf Grundlage unseres Selbstverständnisses, anhand welcher sich zwischen einer Persönlichkeitsveränderung im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstentfremdung im Sinne einer negativen Veränderung unseres Selbstverhältnisses unterscheidet. Es ist die Letztere, die sich auf unser Selbstwertgefühl auswirkt und um die es hier geht.
Der Erfahrung einer Identitätskrise versuche ich mich im Folgenden über den Begriff der Entfremdung zu nähern, da es das Gefühl der Ohnmacht und der Fremdheit in ihrem eigenen Leben ist, das Eltern oft Unbehagen bereitet. Mir ist es im Rahmen einer philosophischen Arbeit leider nicht möglich, meine Beobachtungen und meine Auffassung, dass diese einen verbreiteten Sachverhalt widerspiegeln, empirisch zu fundieren. Doch das möchte ich auch nicht leisten. Es geht mir nicht darum, einen Beweis für eine gesellschaftliche Tendenz zu erbringen, die ich wahrnehme, sondern, wie ich es im Titel schon benenne, eine Deutung anzubieten für eine Erfahrung, die einige Eltern teilen, viele womöglich nicht. Ich möchte einen Aspekt sichtbar und nachvollziehbar machen, aus welchen Gründen eine Elternschaft das Selbstverhältnis eines Menschen fundamental beeinträchtigen kann.
Meine Argumentation stellt sich dabei insbesondere der naheliegenden These entgegen, dass es die Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit im Sinne einer Ungebundenheit oder Unabhängigkeit ist, unter welcher die betroffenen Eltern leiden. Thomä selbst schließt seiner Frage, ob Selbstbestimmung von Eltern überhaupt denkbar sei, eine Diskussion über Freiheit und Verpflichtungen an. Die persönliche, als bedrückend empfundene Unfreiheit von Eltern wird bei Thomä durch die elterliche Pflicht begründet, Sorge zu leisten. Ich hingegen möchte Thomäs Untersuchung um einen meiner Ansicht nach vernachlässigten Aspekt ergänzen, der Imperative in den Blick nimmt, die nicht durch das Kind erzeugt werden. Da ich mich beschränken muss, sollen im Fokus dieser Arbeit daher diejenigen Eltern stehen, die sich positiv zu ihrer Fürsorgepflicht verhalten und die jene nicht als Belastung erfahren, sondern vielmehr, dass sie in Widerstreit zu anderen Geboten gerät, die uns Menschen in der Moderne beherrschen.
Seit langem wird ein Individualismus, der aufgrund seines eigennützigen Beiklangs immer wieder in Verruf gebracht wird, für die sich verbreitende Kinderlosigkeit in Europa verantwortlich gemacht. Schon Georg Simmel hatte Menschen beschrieben, die durch gestiegene Mobilität und beschleunigten Berufswechsel nur noch zu geringer Bindungsfähigkeit in der Lage seien und gegenüber ihren Mitmenschen verstärkt eine egozentrische Einstellung entwickelten.5 Im Hinblick auf Partnerschaft, Karriere oder Wohnort hat der Mensch im Zuge der Individualisierung tatsächlich große biografische Freiheiten gewonnen, die er durch eine Entscheidung für ein Kind einschränken würde. Insbesondere das Streben von Frauen nach beruflicher Selbstverwirklichung und damit die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit wird mit einem geringeren Kinderwunsch verbunden, da die Familiengründung in der Regel bedeutet, gewonnene finanzielle und biografische Selbständigkeit aufgeben zu müssen. Folglich sei es hauptsächlich die Ausrichtung an Selbstverwirklichungszielen zusammen mit der zunehmenden Toleranz nicht-traditioneller familialer Lebensformen, die man dafür verantwortlich zeichnen müsse, dass sich die Geburtenzahl reduziere. Der Grundgedanke dieser Theorie ist also, dass eine Entscheidung für Kinder Optionen der Selbstverwirklichung mindert. Kinderlosigkeit wird als Ausdruck der Unvereinbarkeit von Familie mit dem gewachsenen Anspruch auf Selbstverwirklichung angesehen.
In der Tat kommt dem Wunsch nach Selbstverwirklichung heutzutage in modernen westlichen Gesellschaften ein zentraler Wert zu. Meine These ist jedoch, dass die Rückläufigkeit der Geburten nicht mit einem Rückgang von Kinderwunsch einhergeht. Eher verhindert die wachsende berufliche und ökonomische Unsicherheit zunehmend, dass Kinderwünsche, die vorhanden sind, handlungswirksam werden. Weiter bin ich der Auffassung, dass Eltern, die ihren Kinderwunsch verwirklicht haben, sich aufgrund eines inneren Anspruchs entfremdet fühlen, der gar nicht ihnen selbst entspringt. Die Individualisierungsprozesse, die vormals eine Steigerung persönlicher Freiheit versprachen, drängen uns heute vielmehr zu unreflektierten Handlungsmustern.
Dieses Paradoxon greift auch Charles Taylor auf:
„Was wir erklären müssen, ist das, was unsere Zeit vor anderen auszeichnet. Daß die Menschen ihre Liebesbeziehungen und die Fürsorge für ihre Kinder opfern, um ihre Karriere zu verfolgen, ist nicht das wirklich Eigentümliche. So etwas hat es vielleicht immer schon gegeben. Das Ausschlaggebende ist, daß sich heute viele Menschen dazu aufgefordert [Hervorhebung im Original] fühlen, daß sie meinen, sie müßten so handeln, und daß sie spüren, ihr Leben wäre irgendwie vergeudet oder unerfüllt, wenn sie nicht so verfahren würden.“6
Ich möchte im Folgenden für die These argumentieren, dass Eltern gefährdet sind, in ihrem Selbstverhältnis beeinträchtigt zu werden, weil sie den nicht immer authentischen Imperativ verspüren, sich selbst zu verwirklichen. Und das nicht irgendwie, sondern innerhalb einer Leistungsgesellschaft, in der es aufgrund der Verteilung sozialer Anerkennung nach dem Wettbewerbsprinzip zur zentralen Aufgabe für uns Menschen geworden ist, unser Leben nicht nur selbstbestimmt zu führen, sondern auch so zu gestalten, dass wir unsere Konkurrenzfähigkeit sicherstellen können. Menschen, die Eltern geworden sind, die sich folglich unwiderruflich auf die Einschränkung ihrer Mobilität, Flexibilität und Leistungskraft festgelegt haben, können diesen Ansprüchen der Moderne nicht mehr ohne Abstriche genügen. Die zunehmende Beschleunigung innerhalb des wirtschaftlichen und sozialen Konkurrenzkampfes trägt für Eltern ein Entfremdungspotential in sich, da sie entweder aufgrund ihrer Elternschaft ins Hintertreffen innerhalb des sozialen Wettbewerbs geraten oder ihre Kinder in wesentlich geringerem Umfang persönlich durchs Leben begleiten können, als sie es selbst wünschen und für richtig halten. Ursächlich für Letzteres ist, dass die alltägliche Leistung von Eltern gegenüber anderen Tätigkeitsformen gering geschätzt wird. Kinder gelten heute als reines Privatvergnügen. Unsere Erde ist überbevölkert. Die Klimakrise bedroht die Existenz aller, besonders der Jüngsten. In modernen, hochindustrialisierten Ländern ist es weder eine ökonomischen Notwendigkeit, Kinder zu bekommen, noch eine unvermeidbare Folge sexueller Beziehungen. Aus dieser Perspektive stellen Kinder einen Luxus dar, auf den jeder verzichten kann und sollte, dem die Bürden der Erziehung zu groß sind. Die Belastung von Eltern gilt als optional, sozusagen als selbst verschuldet; Elternschaft ist kein Schicksal mehr.
Um meine These zu begründen, gilt es zuerst herauszuarbeiten, wie der Begriff der Entfremdung in Abgrenzung zu seiner Verwendung innerhalb der Geschichte der Philosophie heute verstanden werden kann. Hier ist relevant für mich, wie Rahel Jaeggi den Entfremdungsbegriff rekonstruiert hat (Kapitel 2.1.). Eine konkrete Anwendung des ermittelten Entfremdungsbegriffes auf Aspekte der Elternschaft werde ich mit Élisabeth Badinters Thesen zum Dilemma der Frau, sich zwischen Selbstverwirklichung und Muttersein entscheiden zu müssen, prüfen (Kapitel 2.2.). Diese Ausführungen erfordern anschließend, den Begriff der Selbstverwirklichung als solchen in einem Exkurs in den Blick zu nehmen (Kapitel 2.3.). Denn um das Konzept der Selbstverwirklichung problematisieren zu können, müssen bestimmte Vorstellungen, die besagen, was es heißt, sich selbst zu verwirklichen, näher erläutert werden.
Da meine These es voraussetzt, will ich folgend nachvollziehbar machen, dass ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Anerkennung und der Art unseres Selbstverhältnisses besteht. Um dies zu erreichen, werde ich entlang der philosophischen Anthropologie Charles Taylors zunächst ergründen, was der Begriff der Identität beinhaltet (Kapitel 3.1.). Ausgehend von Taylors zeitgenössischem Begriff eines Selbst lassen sich allgemeingültige Kriterien für gelingende personale Identität formulieren. Es wird sich zeigen, dass auch Anerkennung für sie wesentlich ist (Kapitel 3.2.), was ich durch die Anerkennungstheorie Axel Honneths stützen werde. Mit Honneth werde ich ferner darlegen, auf welche Art ein individuelles Selbstverhältnis, das nicht mit der Erfahrung von Anerkennung einhergeht, beeinträchtigt wird (Kapitel 3.3.).
Auf diese Grundlagen hat schließlich eine Diagnose unserer modernen Gesellschaft aufzubauen, um den kulturellen Rahmen, in dem Selbstverhältnisse heute gelingen müssen, zu untersuchen. Ich werde erläutern, warum unsere Kultur nicht alle Kriterien erfüllt, um Eltern zu einer stabilen, positiven Selbstbeziehung zu verhelfen. Dafür ist von Bedeutung, dass biografische Entwicklungen, wie sie etwa mit der Elternschaft einhergehen, nur abhängig von unserem Selbstverständnis als entfremdend beschrieben werden können. Dem Selbstverständnis des modernen Menschen gehe ich daher mit Charles Taylor nach, der im Zuge seiner Deutung der Moderne seinem anthropologischen Begriff des Selbst den Begriff des spezifisch neuzeitlichen Selbst gegenüberstellt (Kapitel 4.1.). Das neuzeitliche Selbstverständnis stellt für Taylor nur ein mögliches unter vielen dar, das sich in unserer Zeit zwar realisiert hat, jedoch nicht zwingend ist. Aus dem Überblick über die historischen Entwicklungen, die zu unserer neuzeitlichen Identität geführt haben, wird hervorgehen, dass es zwei grundverschiedene Ausformungen neuzeitlicher Selbstinterpretation gibt, die der Mensch der Moderne beide verinnerlicht hat und die Orientierungskonflikte in uns erzeugen (Kapitel 4.2.). Dass unsere gesellschaftlichen Prozesse und Institutionen vom Bild eines autonomen, effizienten Menschen als funktionierendes Glied in einem als äußerlich empfundenen Wirtschaftssystem dominiert werden, ist Taylors Erkenntnis, an welche ich anknüpfen kann, wenn ich unter Rückgriff auf Hartmut Rosas Thesen zur sozialen Beschleunigung zu unseren gegenwärtigen Anerkennungsverhältnissen vorstoße (Kapitel 4.3.).
Im Ergebnisteil werde ich das Erschlossene schließlich konkret auf die Lebenssituation beziehen, in der sich Eltern befinden. Angesichts der im Hinblick auf Elternschaft dürftigen wissenschaftlichen Ausgangslage darf es nicht verwundern, dass in weiten Teilen des Hauptteiles von Eltern lediglich am Rande die Rede sein wird. Es wird hauptsächlich meinem Ergebnisteil vorbehalten bleiben, die Auseinandersetzung mit den vorangegangenen Theorien zu einer Antwort auf meine ursprüngliche Frage zusammenzuführen (Kapitel 5). Ferner werde ich mögliche Perspektiven aufzeigen, wie Eltern zu einem positiveren Selbstgefühl gelangen könnten.
Entscheidend ist für mich im Zusammenhang mit den Beobachtungen, die den Impuls für diese Arbeit gaben, dass ein Gefühl wie Scham oder Schuld und auch das der Entfremdung das Ergebnis einer bestimmten Wahrnehmung einer Situation ist. Je nachdem, über welche Deutungsmuster ein Mensch verfügt, wird das Gefühl, das mit einer Situation einhergeht, unterschiedlich ausfallen. Das Gefühl wird folglich durch eine Interpretation hervorgebracht. Mit der Aufdeckung seines Ursprungs und schließlich der Neuinterpretation einer Lebenssituation geht, so die Hoffnung, auch eine Veränderung der sie begleitenden Gefühle einher, ohne dass die äußeren Lebensumstände aufgehoben werden. Wenn unsere Überzeugungen – wie etwa, dass die Fürsorge für unsere Kinder einen Beitrag von Wert darstellt – mit unseren Gefühlen – wie dem der Scham und Schuld, wenn wir uns ihr widmen – nicht übereinstimmen, müssen relevante Sachverhalte benannt werden, um unser Selbstverhältnis positiv zu korrigieren. Einen Schritt in diese Richtung zu tun, ist das Anliegen dieser Arbeit.
1 Peter Bieri, Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde, München 2013, S. 11.
2 Thomä verweist hier z. B. auf Platon, der in den Nomoi aufgrund der Angewiesenheit der Gemeinschaft auf Nachkommen die Verweigerung der Ehe mit einer Geldstrafe zu belegen gedachte. Dieter Thomä, Eltern. Kleine Philosophie einer riskanten Lebensform, München 2002, S. 16.
3 Wenn ich im Rahmen dieser Arbeit von Identität spreche, möchte ich in Abgrenzung zum logischen und mathematischen Begriff der numerischen Identität den Begriff der qualitativen personalen Identität übernehmen, wie er von Hartmut Rosa vorgeschlagen wird. Rosa bezeichnet mit diesem Begriff „jenes praktische Selbstbild oder Selbstkonzept, aus dem ein Individuum in der Welt Sinn schöpft und Orientierung gewinnt sowie die Fähigkeit zum intentionalen Handeln bezieht.“ Hartmut Rosa, Identität und kulturelle Praxis. Politische Philosophie nach Charles Taylor, Frankfurt am Main 1998, S. 69.
Gemäß Charles Taylor ist unsere Identität „das, wodurch wir zu bestimmen vermögen, was für uns wichtig ist und was nicht.“ Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt am Main 2012, S. 60.
„Was ich als Selbst bin – meine Identität –, ist wesentlich durch die Art und Weise definiert, in der mir die Dinge bedeutsam erscheinen.“ Taylor, Quellen des Selbst, S. 67.
4 Thomä unterscheidet die praktizierte





























