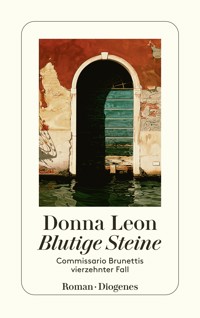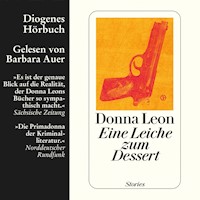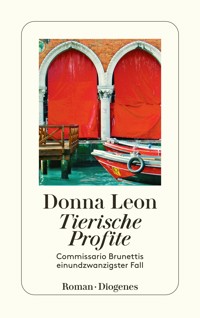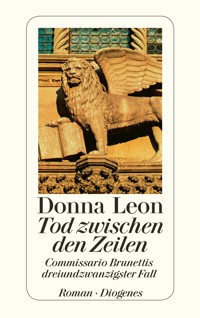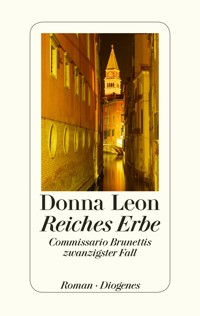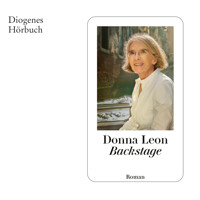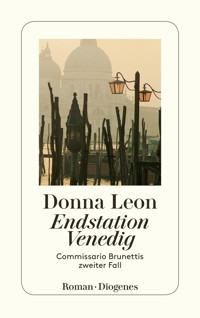
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche schwimmt in einem stinkenden Kanal in Venedig. Und zum Himmel stinken auch die Machenschaften, die sich hinter diesem Tod verbergen: Mafia, amerikanisches Militär und geldgierige Geschäftsleute sind gleichermaßen verwickelt. Commissario Brunetti muß sich anstrengen, um nicht selbst im Kanal zu landen. Wer Giftmüll verschwinden lassen kann, für den sind unliebsame Mitwisser kein Problem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Endstation Venedig
Commissario Brunettis zweiter Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel der 1993 bei HarperCollins Publishers,
New York, erschienenen Originalausgabe:
›Death in a Strange Country‹
Copyright ©1993 Donna Leon
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995
im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Helga Sittl
Copyright ©Helga Sittl
Für Peggy Flynn
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22936 3 (38. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60061 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Volgi intorno lo sguardo, o sire, e vedi qual strage orrenda nel tuo nobil regno, fa il crudo mostro. Ah mira allagate di sangue quelle pubbliche vie. Ad ogni passo vedrai chi geme, e l’alma gonfia d’atro velen dal corpo esala.
Blick umher, o König, und sieh, welche Verwüstung das wilde Ungeheuer in deinem stolzen Reich anrichtet! Sieh die offenen Straßen vom Blut überschwemmt! Bei jedem Schritt findest du einen, der stöhnend aus dem vom scheußlichen Gift
[7] 1
Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin, die am Ende des Kanals begann. Der Kopf schlug ein paarmal gegen die bemoosten Stufen am Ufer vor der Basilika SS. Giovanni e Paolo, verfing sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen.
Von der nahen Kirche schlug es vier Uhr morgens, und der Sog des Wassers verlangsamte sich wie auf Befehl der Glocke.
Er ließ immer mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht war, wenn das Wasser darauf wartet, daß die neue Tide ihr Tagwerk übernimmt. Gefangen in dieser Ruhe schaukelte das leblose Ding auf dem Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Die Zeit verstrich im Schweigen, das kurz darauf von zwei vorbeigehenden Männern gebrochen wurde, die sich leise in dem an Zischlauten reichen venezianischen Dialekt unterhielten. Einer schob einen flachen, mit Zeitungen beladenen Wagen und war auf dem Weg zu seinem Kiosk, der andere zu seiner Arbeit im Krankenhaus, das eine ganze Seite des großen, offenen Campo einnahm.
Draußen in der Lagune tuckerte ein kleines Boot vorbei, und kleine, kurze Wellen kräuselten den Kanal, [8] spielten mit der Leiche und drückten sie gegen die Mauer.
Als die Glocken fünf schlugen, stieß in einem der Häuser am Kanal eine Frau die dunkelgrünen Läden ihres Küchenfensters auf, drehte sich um und stellte die Gasflamme unter ihrem Kaffeetopf kleiner. Verschlafen löffelte sie Zucker in eine kleine Tasse, drehte mit geübter Handbewegung das Gas ab und goß mit dickem Strahl den Kaffee in ihre Tasse. Dann umfaßte sie mit beiden Händen die Tasse und trat ans offene Fenster, wo sie, wie jeden Morgen seit Jahrzehnten, zum großen Reiterstandbild des Condottiere Colleoni hinübersah, einst der gefürchtetste aller venezianischen Heerführer, jetzt ein guter Nachbar. Für Bianca Pianaro war dies der friedlichste Augenblick des Tages, und der in ewiges bronzenes Schweigen gegossene Colleoni war der ideale Genosse für diese kostbare, heimliche und stille Viertelstunde.
Sie schlürfte ihren Kaffee, freute sich an dessen Wärme und beobachtete die Tauben, die sich bereits pickend dem Sockel der Statue näherten. Beiläufig schaute sie nach unten, wo das kleine Boot ihres Mannes im dunkelgrünen Wasser dümpelte. Es hatte in der Nacht geregnet, und sie wollte sehen, ob die Plane über dem Boot noch da war. Wenn der Wind sie gelöst hatte, mußte Nino hinuntergehen und das Boot ausschöpfen, bevor er zur Arbeit fuhr. Sie beugte sich vor, um besser sehen zu können.
Zuerst dachte sie, es sei ein Müllsack, den die nächtliche Flut vom Ufer herübergeschwemmt hatte. Aber die Form war seltsam symmetrisch, länglich, mit zwei Ästen, die an den Seiten herausragten, beinah als ob …
[9]»Oh, Dio«, japste sie und ließ ihre Kaffeetasse ins Wasser unter sich fallen, nicht weit entfernt von der seltsamen Form, die bäuchlings im Kanal trieb. »Nino, Nino«, schrie sie, während sie sich zum Schlafzimmer umdrehte. »Im Kanal treibt eine Leiche.«
Dieselbe Nachricht, »Im Kanal treibt eine Leiche«, weckte zwanzig Minuten später Guido Brunetti. Er stützte sich auf die linke Schulter und zog das Telefon zu sich aufs Bett. »Wo?«
»Santi Giovanni e Paolo. Vor dem Krankenhaus, Commissario«, antwortete der Polizist, der ihn sofort angerufen hatte, nachdem die Meldung bei der Questura eingegangen war.
»Was ist passiert? Wer hat sie gefunden?« fragte Brunetti, während er die Beine unter der Decke hervorschwang und sich auf die Bettkante setzte.
»Ich weiß nicht, Commissario. Ein Mann namens Pianaro hat es telefonisch gemeldet.«
»Und warum rufen Sie mich an?« wollte Brunetti wissen, wobei er gar nicht erst versuchte, seine Verärgerung zu verbergen, die eindeutig ausgelöst war durch einen Blick auf das leuchtende Zifferblatt des Weckers: fünf Uhr einunddreißig. »Was ist mit der Nachtschicht? Ist denn keiner da?«
»Sie sind alle nach Hause gegangen, Commissario. Ich habe Bozzetti angerufen, aber seine Frau sagt, er ist noch nicht zu Hause.« Die Stimme des jungen Mannes wurde immer unsicherer, während er sprach. »Da habe ich Sie angerufen, weil ich wußte, daß Sie Tagschicht haben.«
[10] Und die begann, wie Brunetti sich sagte, in zweieinhalb Stunden. Er schwieg.
»Sind Sie noch da, Commissario?«
»Ja, ich bin da. Und es ist halb sechs.«
»Ich weiß«, greinte der junge Mann. »Aber ich konnte sonst niemanden erreichen.«
»Schon gut, schon gut. Ich gehe hin und sehe mir die Sache an. Schicken Sie mir ein Boot. Sofort.« Angesichts der Uhrzeit und der Tatsache, daß die Nachtschicht schon weg war, fragte er: »Ist jemand da, der es herbringen kann?«
»Ja, Commissario. Montisi ist eben gekommen. Soll ich ihn schicken?«
»Ja, und zwar sofort. Und rufen Sie die anderen von der Tagschicht an. Sie sollen mich dort treffen.«
»Ja, Commissario«, antwortete der junge Mann, dem man die Erleichterung darüber anhörte, daß jemand die Sache übernahm. »Und benachrichtigen Sie Dottore Rizzardi. Bitten Sie ihn, so schnell wie möglich hinzukommen.«
»Ja, Commissario. Noch etwas, Commissario?«
»Nein, nichts weiter. Aber schicken Sie das Boot. Sofort. Und sagen Sie den anderen, wenn sie vor mir da sind, sollen sie absperren. Niemand darf in die Nähe der Leiche.« Wie viele Beweise wurden schon vernichtet, während er jetzt sprach, wie viele Zigarettenkippen weggeworfen, wie viele Paar Schuhe waren übers Pflaster geschlurft? Ohne ein weiteres Wort legte Brunetti auf.
Neben ihm im Bett regte sich Paola und sah mit einem Auge zu ihm auf, das andere war von ihrem schützend [11] gegen das Licht erhobenen nackten Arm verdeckt. Sie gab einen Laut von sich, den er aus langer Erfahrung als Frage erkannte.
»Eine Leiche im Kanal. Sie kommen mich abholen. Ich rufe dich an.«
Der Laut, mit dem sie das aufnahm, klang zustimmend. Sie drehte sich auf den Bauch und schlief schon wieder, sicher der einzige Mensch in der ganzen Stadt, den es nicht interessierte, daß in einem der Kanäle eine Leiche trieb.
Er zog sich rasch an, beschloß aufs Rasieren zu verzichten und ging in die Küche, um zu sehen, ob noch Kaffee da war. Er öffnete den Deckel der Caffettiera und stellte fest, daß noch ein kleiner Rest vom Abend übrig war. Obwohl er aufgewärmten Kaffee verabscheute, schüttete er ihn in einen Topf und drehte die Gasflamme hoch, während er dabeistand und wartete, daß es kochte. Als es soweit war, goß er das dickflüssige Gebräu in eine Tasse, löffelte drei Stück Zucker hinein und trank schnell aus.
Das Klingeln der Türglocke zeigte die Ankunft des Polizeiboots an. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Acht Minuten vor sechs. Das mußte Montisi sein, kein anderer war in der Lage, ein Boot so schnell hierherzubringen. Er holte ein wollenes Jackett aus dem Schrank neben der Wohnungstür. Septembermorgen konnten kalt sein, und womöglich war es auch noch windig bei SS. Giovanni e Paolo, so nah am offenen Wasser der Lagune.
Am Fuß der fünf Treppen angelangt, öffnete er die Haustür und stand Puccetti gegenüber, einem Rekruten, der noch keine fünf Monate bei der Polizei war.
[12] »Buon giorno, Signor Commissario«, sagte Puccetti fröhlich und salutierte. Viel mehr Lärm und Bewegung, als Brunetti zu dieser Stunde für angemessen hielt.
Er antwortete mit einer Handbewegung und eilte die schmale Calle entlang, in der er wohnte. Auf dem Wasser sah er das Polizeiboot mit seinem rhythmisch blinkenden Blaulicht am Landesteg liegen. Am Steuer erkannte er Montisi, einen Polizeibootführer, in dessen Adern das Blut zahlloser Generationen von Buranofischern floß – Blut, das sich inzwischen mit Lagunenwasser gemischt haben mußte – und der ein instinktives Wissen über Gezeiten und Strömungen in sich trug, das es ihm erlaubt hätte, die Kanäle der Stadt mit geschlossenen Augen zu durchfahren.
Montisi, vierschrötig und vollbärtig, quittierte Brunettis Ankunft mit einem Nicken, ebenso ein Zugeständnis an die Tageszeit wie an seinen Vorgesetzten. Puccetti sprang an Deck zu zwei dort wartenden, uniformierten Polizisten. Einer von ihnen machte die Leine los, und Montisi lenkte das Boot rasch rückwärts hinaus in den Canal Grande, wo er es scharf herumschwang und zurück in Richtung Rialto-Brücke fuhr. Sie glitten unter der Brücke hindurch und in einen Einbahnkanal zur Rechten. Kurz darauf bogen sie nach links ab, dann wieder rechts. Brunetti stand an Deck, den Kragen gegen den Wind und die morgendliche Kühle hochgeschlagen. Die Boote auf beiden Seiten des Kanals schaukelten in ihrem Kielwasser, und andere, die mit frischem Obst und Gemüse von Sant’ Erasmo hereinkamen, wichen beim Anblick des Blaulichts seitlich in den Schutz der Häuser aus.
[13] Endlich bogen sie in den Rio dei Mendicanti, den Kanal, der neben dem Krankenhaus und dann hinaus in die Lagune floß, genau gegenüber dem Friedhof. Die Nähe des Friedhofs war höchstwahrscheinlich Zufall, doch die meisten Venezianer, die eine Behandlung im Krankenhaus überlebt hatten, sahen in der Lage des Friedhofs einen stummen Kommentar zur Tüchtigkeit des Krankenhauspersonals.
Auf halbem Weg sah Brunetti zur Rechten eine kleine Menschengruppe zusammengedrängt am Ufer stehen. Montisi brachte das Boot fünfzig Meter weiter vorne zum Halten, ein in Brunettis Augen absolut nutzloser Versuch, irgendwelche Spuren am Fundort der Leiche durch ihre Ankunft nicht zu zerstören.
Einer der Polizisten kam zum Boot und streckte Brunetti die Hand entgegen, um ihm beim Aussteigen behilflich zu sein. »Buon giorno, Signor Commissario. Wir haben ihn herausgeholt, aber wie Sie sehen, haben wir schon Gesellschaft bekommen.« Er deutete auf die neun oder zehn Leute, die sich um etwas auf dem Boden scharten und mit ihren Körpern Brunettis Blick darauf verdeckten.
Der Polizist wandte sich wieder den Leuten zu und sagte im Gehen: »Polizei. Zurücktreten, bitte.« Das Nahen der beiden Männer, nicht der Befehl, bewog die Leute Platz zu machen.
Auf dem Boden sah Brunetti den Körper eines jungen Mannes auf dem Rücken liegen, dessen offene Augen ins Morgenlicht starrten. Neben ihm standen zwei Polizisten, die Uniformen bis an die Achseln durchnäßt. Beide salutierten, als sie Brunetti sahen. Sowie sie die Hände [14] wieder an die Hose legten, tropfte neben ihnen Wasser auf den Boden. Er erkannte sie. Luciani und Rossi, beides gute Leute.
»Und?« fragte Brunetti, während er auf den Toten hinuntersah.
Luciani, der Dienstältere, antwortete: »Er trieb im Kanal, als wir ankamen, Dottore. Ein Mann in dem Haus da drüben«, er deutete auf ein ockerfarbenes Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals, »hat uns angerufen. Seine Frau hat ihn entdeckt.«
Brunetti drehte sich um und schaute zu dem Haus hinüber. »Vierter Stock«, erklärte Luciani. Brunetti hob den Blick und sah gerade noch eine Gestalt vom Fenster zurückweichen. Während er sich das Gebäude und die Nachbarhäuser genauer ansah, bemerkte er eine ganze Reihe dunkler Schatten an den Fenstern. Einige zogen sich zurück, als er hinschaute, andere nicht.
Brunetti wandte sich wieder Luciani zu und bedeutete ihm mit einem Kopfnicken fortzufahren. »Er trieb in der Nähe der Treppe, aber wir mußten ins Wasser, um ihn herauszubekommen. Ich habe ihn auf den Rücken gelegt. Zur Wiederbelebung. Aber es war hoffnungslos, Commissario. Wie es aussieht, ist er schon lange tot.« Seine Stimme klang abbittend, beinah als würde der erfolglose Versuch, dem jungen Mann wieder Leben einzuhauchen, die Endgültigkeit seines Todes noch unterstreichen.
»Haben Sie die Leiche durchsucht?« fragte Brunetti.
»Nein. Als wir sahen, daß wir nichts tun konnten, hielten wir es für das beste, ihn für den Arzt so liegenzulassen.«
[15] »Gut, gut«, murmelte Brunetti. Luciani erschauerte, entweder vor Kälte oder in Erkenntnis seines Mißerfolgs, und kleine Wassertropfen fielen unter ihm zu Boden.
»Sie beide gehen jetzt nach Hause. Nehmen Sie ein Bad, essen Sie was. Und trinken Sie etwas gegen die Kälte.« Beide Männer lächelten bei diesen Worten, dankbar für den Vorschlag. »Und nehmen Sie das Boot. Montisi bringt Sie heim. Beide.«
Die Männer bedankten sich und drängten sich durch die Menschentraube, die in den letzten Minuten seit Brunettis Ankunft größer geworden war. Er wandte sich an einen der beiden Uniformierten, die mit ihm gekommen waren. »Drängen Sie die Leute zurück, dann lassen Sie sich Namen und Adressen geben, von allen«, ordnete er an. »Fragen Sie, wann sie hier angekommen sind und ob sie heute morgen irgend etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben. Danach schicken Sie sie nach Hause.« Er verabscheute diese Leichenfledderer, die sich stets an Orten des Todes einfanden, und hatte nie verstanden, welche Faszination der Tod für viele hatte, besonders in seiner gewaltsamen Form.
Er sah sich wieder das Gesicht des jungen Mannes auf dem Boden an, das jetzt Gegenstand so vieler mitleidloser Blicke war. Ein gutaussehender Mann mit kurzem, blondem Haar, das dunkler wirkte durch die Nässe, die eine Pfütze rings um ihn bildete. Seine Augen waren von einem klaren, durchsichtigen Blau, sein Gesicht wirkte symmetrisch, die Nase schmal und wohlgeformt.
Hinter sich hörte Brunetti die Stimmen der Polizisten, die begannen, die Menge zurückzudrängen. Er rief [16] Puccetti zu sich und ignorierte das erneute Salutieren des jungen Mannes. »Puccetti, gehen Sie zu den Häusern da drüben auf der anderen Seite des Kanals, und fragen Sie, ob jemand etwas gehört oder gesehen hat.«
»In welcher Zeit, Commissario?«
Brunetti überlegte kurz und bedachte den Mondstand. Vor zwei Nächten hatten sie Neumond gehabt; die Flut war demnach nicht stark genug gewesen, um die Leiche sehr weit zu tragen. Er würde Montisi danach fragen. Die Hände des Toten waren seltsam runzlig und weiß, ein sicheres Zeichen, daß er lange im Wasser gelegen hatte. Wenn er erst wußte, wie lange der junge Mann schon tot war, würde er es Montisi überlassen, auszurechnen, wie weit es ihn abgetrieben haben konnte. Und von woher. Inzwischen mußte er Puccetti eine Antwort geben. »Fragen Sie nach der ganzen vergangenen Nacht. Und sperren Sie die Stelle ab. Schicken Sie die Leute nach Hause, wenn möglich.« – Kaum möglich, wie er wußte. Venedig hatte seinen Bürgern wenige Ereignisse dieser Art zu bieten; sie würden nur widerwillig gehen.
Er hörte ein weiteres Boot kommen. Eine zweite weiße Polizeibarkasse bog mit blinkendem Blaulicht in den Kanal ein und hielt an derselben Landestelle, die Montisi benutzt hatte. Auch auf diesem Boot waren drei Uniformierte und ein Mann in Zivil. Wie Sonnenblumen wandten die Gesichter der Menge sich vom Gegenstand ihrer bisherigen Aufmerksamkeit zu den Männern, die aus dem Boot sprangen und auf sie zukamen.
Voran ging Dr. Ettore Rizzardi, der Leichenbeschauer der Stadt. Unberührt von den Blicken, die auf ihm lagen, [17] trat er auf Brunetti zu und streckte freundlich die Hand aus. »Buon di, Guido. Was ist los?«
Brunetti trat zur Seite, so daß Rizzardi sehen konnte, was zu ihren Füßen lag. »Er war im Kanal. Luciani und Rossi haben ihn herausgezogen, aber sie konnten nichts mehr tun. Luciani hat es versucht, aber es war zu spät.«
Rizzardi nickte und grunzte etwas dazu. Die verschrumpelte Haut an den Händen sagte ihm, daß es für jede Hilfe zu spät gewesen war.
»Sieht aus, als ob er lange da drin gelegen hätte, Ettore. Aber Sie können es mir sicher genauer sagen.«
Rizzardi nahm dieses Kompliment nur als recht und billig entgegen und wandte seine Aufmerksamkeit der Leiche zu. Als er sich darüberbeugte, wurde das Zischeln in der Menge noch lebhafter. Er beachtete es nicht, stellte seine Tasche sorgsam auf ein trockenes Fleckchen neben dem Toten und bückte sich.
Brunetti machte kehrt und trat auf die vorderste Reihe der Leute zu, die inzwischen dichtgedrängt standen.
»Wenn Sie Ihre Personalien angegeben haben, können Sie gehen. Es gibt nichts weiter zu sehen. Sie können also ruhig gehen, alle.« Ein alter Mann mit grauem Bart neigte sich energisch nach links, um an Brunetti vorbei sehen zu können, was der Arzt an der Leiche machte. »Ich sagte, Sie können gehen.« Brunetti sprach den Alten direkt an. Der richtete sich auf, warf Brunetti einen völlig abwesenden Blick zu und beugte sich wieder zur Seite, nur am Tun des Arztes interessiert. Eine alte Frau riß ärgerlich an der Leine ihres Terriers, sichtlich in Wut über diesen neuerlichen Beweis polizeilicher Brutalität. Die Uniformierten [18] gingen langsam an der Menge entlang und bewegten sie sanft mit einem Wort oder dem Druck einer Hand gegen eine Schulter zum Gehen. Der letzte war der alte Mann mit dem Bart, der nur bis zu dem Eisengeländer zurückging, das die Statue von Colleoni umgab, sich dagegen lehnte und sich weigerte, den Campo zu verlassen oder seine Rechte als Bürger preiszugeben.
»Guido, kommen Sie doch mal einen Augenblick her«, rief Rizzardi von hinten.
Brunetti drehte sich um und trat neben den knienden Arzt, der das Hemd des Toten hochgeschoben hatte. Etwa fünfzehn Zentimeter oberhalb der Taille sah Brunetti auf der linken Seite einen horizontalen Strich, an dessen ausgefransten Rändern das Fleisch merkwürdig graublau aussah. Er kniete sich neben Rizzardi in eine kalte Pfütze, um besser sehen zu können. Der Schnitt war etwa so lang wie sein Daumen und klaffte, wahrscheinlich weil die Leiche so lange im Wasser gelegen hatte, seltsam blutlos auseinander.
»Das ist nicht irgendein Tourist, der zuviel getrunken hat und dann in den Kanal gefallen ist, Guido.«
Brunetti nickte in stillschweigender Übereinstimmung. »Was könnte so etwas verursachen?« fragte er mit einer Kopfbewegung zu der Wunde hin.
»Ein Messer mit breiter Klinge. Und wer immer das getan hat, war entweder sehr gut oder hatte sehr viel Glück.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Brunetti.
»Ich will jetzt nicht allzuviel darin herumstochern, bevor ich ihn nicht aufmachen und mir das genau ansehen kann«, sagte Rizzardi. »Aber wenn der Winkel stimmt, [19] und soweit ich sehen kann, deutet alles darauf hin, dann hatte er einen geraden Weg zum Herzen. Keine Rippen dazwischen, gar nichts. Schon der geringste Schub, das kleinste bißchen Druck, und der andere ist tot.« Rizzardi wiederholte: »Entweder sehr gut, oder sehr viel Glück.«
Brunetti sah nur die Breite der Wunde; er hatte keine Ahnung von dem Verlauf, den sie innerhalb des Körpers nahm. »Hätte es auch etwas anderes sein können? Ich meine, etwas anderes als ein Messer?«
»Ganz sicher kann ich nicht sein, bevor ich mir das innere Gewebe genauer angesehen habe, aber ich glaube nicht.«
»Und Ertrinken? Wenn der Stich sein Herz nicht erreicht hätte, könnte er dann trotzdem ertrunken sein?«
Rizzardi ging in die Hocke, wobei er vorsichtig die Schöße seines Regenmantels zusammenraffte, um ihn vor der Nässe zu bewahren. »Nein, kaum. Wenn das Herz verfehlt wurde, wäre er nicht schwer genug verletzt gewesen, um sich nicht noch selbst aus dem Wasser zu retten. Sehen Sie nur, wie blaß er ist. Ich glaube, so ist es passiert: Ein einziger Stich. Und der richtige Winkel. Dann wäre der Tod fast augenblicklich eingetreten.« Er richtete sich auf und sagte: »Armer Teufel.« Von allem, was an diesem Morgen über den jungen Mann gesprochen wurde, kam das wohl einem Totengebet am nächsten. »Ein gutaussehender Junge, und seine Kondition war hervorragend. Ich würde sagen, er war Sportler, oder zumindest jemand, der sehr auf sich achtete.« Er beugte sich wieder über die Leiche und strich mit einer seltsam väterlich anmutenden Geste über die Augen des Toten, um sie zu schließen. Eines [20] wollte nicht zugehen, das andere schloß sich für einen Moment, öffnete sich dann wieder und starrte gen Himmel. Rizzardi murmelte etwas vor sich hin, nahm ein Taschentuch aus seiner Brusttasche und legte es dem jungen Mann übers Gesicht.
»Bedecke sein Antlitz. Er starb jung«, murmelte Brunetti.
»Wie bitte?«
Brunetti zuckte die Achseln. »Ach, nichts. Etwas, was Paola immer sagt.« Er wandte den Blick von dem jungen Mann ab, betrachtete einen Moment die Fassade der Basilika und ließ ihre Symmetrie beruhigend auf sich einwirken. »Wann können Sie mir Genaueres sagen, Ettore?«
Rizzardi warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr. »Wenn Ihre Leute ihn gleich zur Friedhofsinsel rausbringen, kann ich ihn mir heute vormittag noch vornehmen. Rufen Sie mich nach dem Mittagessen an, dann weiß ich mehr. Aber ich glaube nicht, daß es Zweifel gibt, Guido.« Der Arzt zögerte etwas, weil er Brunetti nicht gern in seine Arbeit hineinreden wollte, dann fragte er: »Sehen Sie nicht seine Taschen durch?«
Auch wenn er das in seinem Beruf schon viele Male getan hatte, widerstrebte Brunetti dieses allererste Eindringen in die Intimsphäre eines Toten immer noch, diese erste schreckliche Machtausübung des Staates gegenüber denen, die dahingegangen waren. Er haßte es, in ihren Tagebüchern und Schubladen herumstöbern, ihre Briefe durchlesen und ihre Kleidung befingern zu müssen.
Aber da sich die Leiche ohnehin nicht mehr am Fundort befand, bestand kein Grund, sie unberührt zu lassen, bis [21] der Fotograf die genaue Lage beim Tod festgehalten hätte. Er hockte sich neben den jungen Mann und schob seine Hand in dessen Hosentasche. Er fand ein paar Münzen und legte sie neben ihn. In der anderen Tasche war ein einfacher Metallring mit vier Schlüsseln. Unaufgefordert beugte Rizzardi sich herunter und half, den Toten auf die Seite zu drehen, damit Brunetti in die Gesäßtaschen fassen konnte. In einer steckte ein durchnäßtes gelbes Stück Papier, eindeutig eine Fahrkarte, in der anderen eine Papierserviette, ebenso durchweicht. Er nickte Rizzardi zu, und sie ließen den Körper auf den Boden zurückgleiten.
Brunetti hob eine der Münzen auf und hielt sie dem Arzt hin.
»Was ist das?« wollte Rizzardi wissen.
»Amerikanisches Geld. Fünfundzwanzig Cents.« In Venedig schien das ein seltsamer Fund in der Tasche eines Toten.
»Ah, das könnte es sein«, meinte der Arzt. »Ein Amerikaner.«
»Was?«
»Warum er in so guter Verfassung ist«, antwortete Rizzardi, ohne sich der traurigen Ungereimtheit der Gegenwartsform bewußt zu sein. »Das könnte die Erklärung sein. Die sind immer so fit, so gesund.« Gemeinsam sahen sie den Körper an, die schmale Taille unter dem noch immer offenen Hemd.
»Wenn er Amerikaner ist, erkenne ich es an den Zähnen«, sagte Rizzardi.
»Wieso?«
»An der zahnärztlichen Arbeit. Sie benutzen andere [22] Techniken, besseres Material. Wenn an den Zähnen etwas gemacht worden ist, kann ich Ihnen heute nachmittag sagen, ob er Amerikaner ist.«
Wäre er nicht Brunetti gewesen, er hätte Rizzardi vielleicht gebeten, sofort nachzusehen, aber er sah keinen Grund zur Eile und wollte auch dieses junge Gesicht nicht noch einmal stören. »Danke, Ettore. Ich schicke einen Fotografen zu Ihnen hinaus, um ein paar Aufnahmen zu machen. Ob Sie wohl seine Augen schließen können?«
»Aber sicher. Ich sorge dafür, daß er so natürlich aussieht wie möglich. Aber für die Fotos wollen Sie die Augen doch wohl offen haben, oder?«
Um ein Haar hätte Brunetti gesagt, er wolle diese Augen nie wieder offen sehen, aber er hielt sich zurück und sagte statt dessen: »Ja, ja natürlich.«
»Und schicken Sie jemanden für die Fingerabdrücke, Guido.«
»Ja.«
»Gut. Dann rufen Sie mich gegen drei Uhr an.« Sie gaben sich kurz die Hand, und Dr. Rizzardi nahm seine Tasche vom Boden. Ohne sich zu verabschieden, ging er über den Platz auf das riesige, offene Portal des Krankenhauses zu, zwei Stunden zu früh bei der Arbeit.
Während sie die Leiche inspiziert hatten, waren weitere Polizisten gekommen, es mußten inzwischen acht sein, die jetzt in etwa drei Meter Entfernung den Toten in einem Halbkreis abriegelten. »Sergente Vianello«, rief Brunetti, und einer von ihnen trat aus der Reihe und kam zu ihm.
»Nehmen Sie zwei Ihrer Leute, bringen Sie ihn zum Boot, und schaffen Sie ihn nach San Michele hinüber.«
[23] Während das geschah, nahm Brunetti seine Betrachtung der Basilika wieder auf und ließ den Blick über die hochragenden Türmchen gleiten. Dann schaute er über den Campo zur Statue von Colleoni hinüber, die vielleicht Zeuge des Verbrechens gewesen war.
Vianello trat zu ihm. »Ich habe ihn nach San Michele bringen lassen, Commissario. Noch etwas?«
»Ja. Gibt es hier in der Nähe eine Bar?«
»Da drüben, Commissario, hinter der Statue. Sie macht um sechs Uhr auf.«
»Gut. Ich brauche einen Kaffee.« Während sie zu der Bar hinübergingen, begann Brunetti, Anordnungen zu geben. »Wir brauchen Taucher, zwei. Sie sollen da anfangen, wo die Leiche gefunden wurde. Ich möchte alles haben, was wie eine Waffe aussieht: ein Messer, Klinge etwa zwei Zentimeter breit. Aber es kann auch etwas anderes gewesen sein, sogar ein einfaches Stück Metall. Lassen Sie also alles herausholen, was eine derartige Wunde verursacht haben könnte. Werkzeug, alles.«
»Ja, Commissario«, sagte Vianello, während er im Gehen versuchte, sich alles zu notieren.
»Dottor Rizzardi teilt uns heute nachmittag den Zeitpunkt des Todes mit. Sobald wir den haben, möchte ich mit Montisi sprechen.«
»Wegen der Gezeiten, Commissario?« fragte Vianello, der gleich verstand.
»Ja. Und fangen Sie schon mal an, sich bei den Hotels zu erkundigen. Ob jemand vermißt wird, besonders Amerikaner.« Er wußte, daß die Männer das nicht gern machten, diese endlosen Anrufe in den Hotels, deren bei [24] der Polizei aufliegende Liste Seiten umfaßte. Und nach den Hotels kamen die Pensionen und Gästehäuser, noch mehr Seiten voller Namen und Telefonnummern.
Die dumpfige Wärme der Bar war tröstlich und vertraut, wie auch der Geruch nach Kaffee und Gebäck. Ein Mann und eine Frau standen am Tresen, warfen einen Blick auf den Uniformierten und wandten sich wieder ihrem Gespräch zu. Brunetti bestellte einen Espresso, Vianello einen caffè corretto, schwarzen Kaffee mit einem kräftigen Schuß Grappa. Als der Barmann die Tassen vor sie hinstellte, tat sich jeder der beiden zwei Stück Zucker hinein und nahm die warme Tasse einen Augenblick zwischen die Hände.
Vianello trank seinen Kaffee mit einem Schluck, stellte die Tasse auf den Tresen zurück und fragte: »Noch etwas, Commissario?«
»Erkundigen Sie sich nach der Drogenszene in der Umgebung. Wer wo dealt. Stellen Sie fest, ob in der Gegend schon jemand im Zusammenhang mit Drogen oder Straßenkriminalität polizeilich aufgefallen ist: Dealen, Fixen, Klauen, alles. Und bringen Sie in Erfahrung, wo die zum Drücken hingehen, in welche dieser Calli, die als Sackgassen am Kanal enden; ob es eine Stelle gibt, wo morgens Spritzen herumliegen.«
»Glauben Sie, daß es um Drogen geht, Commissario?«
Brunetti trank seinen Espresso aus und bedeutete dem Barmann, ihm einen zweiten zu bringen. Ohne die Antwort abzuwarten, schüttelte Vianello rasch verneinend den Kopf, aber Brunetti sagte: »Ich weiß nicht, möglich wäre es. Überprüfen wir das also als erstes.«
[25] Vianello nickte und schrieb in sein Notizbuch, bevor er es in die Brusttasche steckte und nach seinem Portemonnaie griff.
»Nein, nein«, meinte Brunetti. »Das übernehme ich. Gehen Sie zum Boot und rufen Sie wegen der Taucher an. Und lassen Sie Ihre Leute Sperren aufstellen. Die Zugänge zum Kanal müssen abgesperrt werden, solange die Taucher arbeiten.«
Vianello bedankte sich mit einem Kopfnicken für den Kaffee und ging. Durch die beschlagenen Fenster der Bar sah Brunetti dem Treiben auf dem Campo draußen zu. Er beobachtete, wie die Leute von der Hauptbrücke kamen, die zum Krankenhaus führte, die Polizei zu ihrer Rechten sahen und dann die Umstehenden fragten, was los sei. Die meisten blieben stehen und schauten von den dunkel Uniformierten, die immer noch herumliefen, zu der Polizeibarkasse, die am Rand des Kanals schaukelte. Dann, nachdem sie absolut nichts Besonderes feststellen konnten, gingen sie weiter ihren Beschäftigungen nach. Der alte Mann lehnte immer noch an dem eisernen Geländer. Selbst nach all den Jahren Polizeiarbeit konnte Brunetti nicht verstehen, wie Menschen sich so willig in die Nähe des Todes ihrer Artgenossen begaben. Es war ein Rätsel, das er nie hatte lösen können, diese schreckliche Faszination der Endlichkeit des Lebens, besonders wenn sie gewaltsam war wie hier.
Er wandte sich wieder seinem zweiten Espresso zu und trank ihn rasch. »Wieviel?« fragte er.
»Fünftausend Lire.«
Brunetti zahlte mit einem Zehner und wartete auf sein [26] Wechselgeld. Als der Barmann es ihm reichte, fragte er: »Etwas Schlimmes?«
[27] 2
Die Questura lag so nah, daß es für Brunetti einfacher war, zu Fuß zu gehen, als mit den Uniformierten in der Polizeibarkasse zurückzufahren. Er ging hintenherum, an der evangelischen Kirche vorbei, und näherte sich von rechts dem Gebäude der Questura. Der Polizist am Haupteingang öffnete die schwere Glastür, sobald er ihn sah, und Brunetti ging zu der Treppe, die zu seinem Büro im vierten Stock führte, vorbei an der Schlange von Ausländern, die um eine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis anstanden. Die Schlange reichte durch die halbe Halle.
In seinem Büro angelangt, fand er seinen Schreibtisch so vor, wie er ihn tags zuvor verlassen hatte, bedeckt mit Papieren und Akten in nicht erkennbarer Ordnung. Der nächstliegende Stapel enthielt Personalbeurteilungen, die er als Teil des byzantinischen Verfahrens, das alle Staatsdiener zwecks Beförderung zu durchlaufen hatten, sämtlich lesen und kommentieren mußte. Ein anderer Stapel enthielt die Unterlagen zum letzten Mordfall in der Stadt, diesem brutalen, irrwitzigen Totschlag an einem jungen Mann, der sich vor einem Monat an der Uferbefestigung Le Zattere ereignet hatte. Das Opfer war so brutal zusammengeschlagen worden, daß die Polizei es erst für das Werk einer Gang gehalten hatte. Statt dessen hatten sie nach nur einem Tag herausgefunden, daß der Mörder ein schmächtiges Bürschchen von sechzehn Jahren war. Das [28] Opfer war homosexuell gewesen, und der Vater des Mörders ein bekannter Faschist, der seinem Sohn eingetrichtert hatte, daß Kommunisten und Schwule ein Ungeziefer seien, das nur den Tod verdiente. So waren diese beiden jungen Männer in der Frühe eines strahlenden Sommermorgens am Ufer des Giudecca-Kanals in einer tödlichen Flugbahn aufeinandergetroffen. Niemand wußte, was zwischen ihnen vorgefallen war, aber das Opfer war derart zugerichtet, daß man der Familie das Recht verweigerte, die Leiche zu sehen, die ihnen in einem versiegelten Sarg übergeben wurde. Das Stück Holz, mit dem er zu Tode geprügelt und gestochen worden war, lag in einem Plastikkasten in einem Aktenschrank im zweiten Stock der Questura. Es blieb wenig zu tun, außer darauf zu achten, daß die psychiatrische Behandlung des Mörders fortgeführt wurde und er bis zur Verhandlung unter Hausarrest blieb. Eine psychiatrische Behandlung für die Familie des Opfers sah der Staat nicht vor.
Statt sich an seinen Schreibtisch zu setzen, zog Brunetti eine Schublade auf und nahm einen elektrischen Rasierapparat heraus. Beim Rasieren stand er am Fenster und blickte hinaus auf die Fassade von San Lorenzo, die immer noch, wie in den vergangenen fünf Jahren, mit einem Gerüst umgeben war, hinter dem angeblich eine umfassende Restaurierung stattfand. Er hatte keinen Beweis, daß dies geschah, denn nichts hatte sich in all den Jahren verändert, und das Hauptportal der Kirche blieb ewig geschlossen.
Sein Telefon klingelte, die direkte Leitung nach draußen. Er sah auf die Uhr. Neun Uhr dreißig. Das [29] waren sicher die Aasgeier. Er schaltete den Rasierapparat aus und ging an seinen Schreibtisch hinüber, um den Anruf entgegenzunehmen.
»Brunetti.«
»Buon giorno, Commissario. Hier ist Carlon«, sagte eine tiefe Stimme, um sich dann noch unnötigerweise als Polizeireporter des Gazzettino vorzustellen.
»Buon giorno, Signor Carlon.« Brunetti wußte, was Carlon wollte, ließ ihn aber fragen. Dank Carlons Berichterstattung über den letzten Mordfall war das Privatleben des Opfers bloßgestellt worden, und Brunetti war immer noch sehr erbittert darüber.
»Sagen Sie mir etwas über den Amerikaner, den Sie heute früh aus dem Rio dei Mendicanti gezogen haben.«
»Herausgezogen hat ihn der Kollege Luciani, und wir haben keinen Beweis dafür, daß es ein Amerikaner war.«
»Ich nehme alles zurück, Dottore«, sagte Carlon mit einem Sarkasmus, der aus der Entschuldigung eine Beleidigung machte. Als Brunetti nicht reagierte, fragte er: »Er wurde ermordet, oder?« Dabei machte er keinen Hehl aus seiner Freude über diese Möglichkeit.
»Es sieht so aus.«
»Erstochen?«
Wie kamen die nur zu ihren Informationen? Und auch noch derart schnell. »Ja.«
»Ermordet?« wiederholte Carlon in bemüht geduldigem Ton.
»Das letzte Wort darüber kann erst gesprochen werden, wenn wir die Ergebnisse der Autopsie haben, die Dottor Rizzardi heute nachmittag vornehmen wird.«
[30] »Hatte die Leiche eine Stichwunde?«
»Ja.«
»Aber Sie sind nicht sicher, ob diese Stichwunde die Todesursache war?« Carlons Frage endete mit einem ungläubigen Schnauben.
»Nein, das sind wir nicht«, antwortete Brunetti ausdruckslos. »Wie schon gesagt, nichts ist sicher, bevor wir das Ergebnis der Autopsie haben.«
»Gab es andere Anzeichen für Gewalt?« fragte Carlon, unzufrieden mit den dürftigen Auskünften.
»Nicht vor dem Autopsiebericht«, wiederholte Brunetti.
»Wollen Sie mir als nächstes erzählen, daß er auch ertrunken sein könnte, Commissario?«
»Signor Carlon«, sagte Brunetti, dem es langsam reichte, »wie Sie sehr wohl wissen, würde er, wenn er auch nur kurz im Wasser eines unserer Kanäle gewesen wäre, eher an einer Seuche gestorben als ertrunken sein.« Am anderen Ende herrschte Schweigen. »Wenn Sie mich bitte heute nachmittag anrufen würden, gegen vier. Dann gebe ich Ihnen gern etwas genauere Informationen.«
»Vielen Dank, Commissario. Das tue ich bestimmt. Ach ja – wie hieß dieser Kollege noch?«
»Luciani, Mario Luciani, ein vorbildlicher Polizist.« Das waren sie alle, wenn Brunetti der Presse gegenüber von ihnen sprach.
»Vielen Dank, Commissario. Ich werde es erwähnen. Und ganz bestimmt erwähne ich in meinem Artikel Ihre Kooperation.«
Ohne weitere Umstände legte Carlon auf.
[31] Früher war Brunettis Verhältnis zur Presse relativ freundlich gewesen, manchmal sogar mehr als das, und zuweilen hatte er die Presse sogar eingespannt, um Informationen über ein Verbrechen herauszukitzeln. Aber in den letzten Jahren hatte die immer höher schlagende Welle von Sensationsjournalismus jeden Umgang mit Reportern verhindert, der mehr als rein formal war; denn jede Vermutung, die er äußerte, wurde anderntags garantiert als mehr oder weniger direkte Schuldzuweisung veröffentlicht. Darum war Brunetti vorsichtig geworden und gab nur noch sehr begrenzt Auskunft, wobei die Reporter immer sicher sein konnten, daß diese stimmte.
Er merkte, daß er eigentlich nichts weiter tun konnte, bevor er nicht etwas über die Herkunft der Fahrkarte in der Tasche des Toten gehört oder den Autopsiebericht bekommen hatte. Die Leute in den Büros unten waren damit beschäftigt, die Hotels durchzutelefonieren, und würden ihm Bescheid sagen, wenn sie irgend etwas in Erfahrung brachten. Demnach konnte er nichts tun, als weiter Personalbeurteilungen zu lesen und abzuzeichnen.
Eine Stunde später, kurz vor elf, summte seine Gegensprechanlage. Schon als er den Hörer abnahm, wußte er nur allzugut, wer es war. »Ja, Vice-Questore?«
Etwas überrumpelt ob der direkten Anrede, oder vielleicht auch, weil er gehofft hatte, Brunetti sei nicht da oder schlafe, brauchte sein Chef, Vice-Questore Patta, einen Moment, bevor er antworten konnte. »Was ist das für eine Geschichte mit einem toten Amerikaner, Brunetti? Warum bin ich nicht informiert worden? [32] Können Sie sich vorstellen, was das für den Tourismus bedeutet?«
Brunetti vermutete, daß die dritte Frage die einzige war, die Patta wirklich interessierte. »Was für ein Amerikaner?« fragte Brunetti mit gespielter Neugier.
»Der Amerikaner, den Sie heute morgen aus dem Wasser gezogen haben.«
»Oh«, sagte Brunetti, diesmal die höfliche Überraschung selbst. »Ist der Bericht schon da? Dann war er also wirklich Amerikaner?«
»Kommen Sie mir nicht so oberschlau, Brunetti«, sagte Patta ärgerlich. »Der Bericht ist noch nicht da, aber der Mann hatte amerikanisches Geld in der Tasche, also muß er Amerikaner sein.«
»Oder Numismatiker«, erklärte Brunetti freundlich.
Es folgte eine lange Pause, die Brunetti sagte, daß der Vice-Questore nicht wußte, was das hieß.
»Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mir nicht so oberschlau kommen, Brunetti. Wir gehen davon aus, daß er Amerikaner ist. Wir können es nicht brauchen, daß in dieser Stadt Amerikaner ermordet werden, wo es in diesem Jahr schon so schlimm um den Tourismus steht. Verstehen Sie das?«
Brunetti verkniff sich die Gegenfrage, ob es denn in Ordnung sei, Menschen anderer Nationalitäten umzubringen – Albaner vielleicht? –, und sagte nur: »Ja, Vice-Questore.«
»Und?«
»Und was?«
»Was haben Sie unternommen?«
[33] »Taucher untersuchen den Kanal an der Stelle, an der er gefunden wurde. Wenn wir wissen, wann er gestorben ist, lassen wir die Stellen untersuchen, von denen aus er abgetrieben sein könnte, ausgehend von der Annahme, daß er irgendwo anders getötet worden ist. Vianello überprüft die Drogenszene in der Umgebung, und das Labor arbeitet an den Sachen, die wir in seinen Taschen gefunden haben.«
»Diese Münzen?«
»Ich bin nicht sicher, ob wir uns vom Labor bestätigen lassen müssen, daß es amerikanische sind.«
Nach einem langen Schweigen, das Brunetti anzeigte, wie wenig klug es wäre, seinen Vorgesetzten weiter auf die Schippe zu nehmen, fragte Patta: »Was ist mit Rizzardi?«
»Er sagt, er schickt mir seinen Bericht heute nachmittag.«
»Sorgen Sie dafür, daß ich eine Kopie bekomme«, befahl Patta.
»Gut. Noch etwas?«
»Nein, das ist alles.« Patta legte auf, und Brunetti widmete sich wieder seinen Beurteilungen.
Als er sie fertig hatte, war es nach eins. Da er nicht wußte, wann Rizzardi ihn anrufen würde, und den Bericht so rasch wie möglich haben wollte, beschloß er, zum Mittagessen weder nach Hause noch in ein Restaurant zu gehen, obwohl er nach dem langen Vormittag hungrig war. Statt dessen entschied er sich für ein paar tramezzini und ging zu der Bar am Ponte dei Greci.
Als er das Lokal betrat, begrüßte ihn Arianna, die Besitzerin, mit Namen und stellte automatisch ein Weinglas [34] vor ihn auf den Tresen. Orso, ihr alter deutscher Schäferhund, der im Lauf der Jahre eine besondere Zuneigung zu Brunetti entwickelt hatte, erhob sich arthritisch von seinem üblichen Platz neben der Eistruhe und tapste zu ihm hin. Er wartete, bis Brunetti ihm den Kopf getätschelt und ihn sanft an den Ohren gezaust hatte, dann ließ er sich zu seinen Füßen nieder. Die vielen Stammkunden der Bar waren daran gewöhnt, über Orso hinwegzusteigen und ihm kleine Bissen zuzuwerfen. Er hatte eine besondere Vorliebe für Spargel.
»Welche hätten Sie gern, Guido?« fragte Arianna, womit sie die tramezzini meinte, und goß dabei unaufgefordert Rotwein in sein Glas.
»Ich hätte gern eines mit Schinken und Artischocken, und eines mit Shrimps.« Zu seinen Füßen begann Orsos Schwanz wie ein Ventilator gegen sein Fußgelenk zu wedeln. »Und eins mit Spargel.« Als die Sandwichs kamen, bat er um ein weiteres Glas Wein und trank langsam, während er daran dachte, wie sich die Dinge komplizieren würden, wenn der Tote tatsächlich ein Amerikaner war. Er wußte nicht, ob es Probleme wegen der Zuständigkeit geben würde, und beschloß, darüber nicht nachzudenken.
Als wollte sie genau das verhindern, sagte Arianna: »Schlimm, das mit dem Amerikaner.«
»Wir sind nicht sicher, ob es einer ist, noch nicht.«
»Also, wenn es einer ist, schreit garantiert bald einer ›Terrorismus!‹, und das ist für keinen gut.« Obwohl sie gebürtige Jugoslawin war, dachte sie ganz venezianisch: das Geschäft geht vor.
»In dieser Gegend spielt sich einiges mit Drogen ab«, [35] fügte sie hinzu, als könnte schon die bloße Erwähnung die Sache zu einem Drogenfall machen. Brunetti fiel ein, daß sie auch ein Hotel besaß und allein schon der Gedanke an Terrorismus sie deshalb mit berechtigter Panik erfüllen mußte.
»Ja, wir überprüfen das, Arianna. Danke.« Während er sprach, löste sich ein Stück Spargel von seinem Sandwich und fiel direkt vor Orsos Nase auf den Boden. Und als das verschwunden war, ein weiteres. Der Hund hatte Schwierigkeiten, auf die Beine zu kommen; warum ihm sein Essen also nicht servieren?
Brunetti legte einen Zehntausendlireschein auf den Tresen und steckte das Wechselgeld ein, als Arianna es ihm gab. Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Betrag in die Kasse zu tippen, so daß die Summe unregistriert und also auch unversteuert blieb. Brunetti hatte schon vor Jahren aufgehört, sich Gedanken um diesen ständigen Betrug am Staat zu machen. Sollten die Beamten der Finanzbehörde sich damit befassen. Nach dem Gesetz mußte sie den Betrag eintippen und ihm eine Quittung aushändigen; wenn er ohne den Beleg die Bar verließ, konnten sie beide zu Geldstrafen in Höhe von Hunderttausenden von Lire verurteilt werden. Oft warteten die Beamten der Finanzbehörde vor Bars, Geschäften und Restaurants und beobachteten den Gang der Dinge durch die Fenster, um dann die Herauskommenden anzuhalten und ihre Quittung zu verlangen. Aber Venedig war eine kleine Stadt, und alle von der Finanzbehörde kannten ihn; er würde also nie angehalten werden, es sei denn, sie holten sich Hilfe von außerhalb und veranstalteten, was die Presse [36] einen »Blitzkrieg« nannte, indem sie im gesamten Geschäftsviertel der Stadt herumpirschten und Millionen Lire an Bußgeldern an einem Tag einnahmen. Und wenn sie ihn anhielten? Dann würde er seinen Ausweis zücken und sagen, er habe nur die Toilette benutzt. Aus denselben Steuern wurde sein Gehalt bezahlt; das stimmte. Aber das hatte für ihn und vermutlich auch für die Mehrheit seiner Mitbürger schon lange nichts mehr zu bedeuten. In einem Land, in dem die Mafia morden konnte, wann und wen sie wollte, sah Brunetti es kaum als großes Verbrechen an, wenn jemand für eine Tasse Kaffe keine Quittung vorzeigen konnte.
Wieder an seinem Schreibtisch, fand er einen Zettel, auf dem er gebeten wurde, Dr. Rizzardi anzurufen. Als Brunetti das tat, erreichte er den Arzt noch in seinem Büro auf der Friedhofsinsel.
»Ciao, Ettore. Hier ist Guido. Was haben Sie herausgefunden?«
»Ich habe mir sein Gebiß angesehen. Alles amerikanische Arbeit. Er hatte sechs Füllungen und eine Wurzelbehandlung, alles über mehrere Jahre verteilt, und was die Technik angeht, gibt es keinen Zweifel. Alles amerikanisch.«
Brunetti wußte, daß er nicht zu fragen brauchte, ob Rizzardi ganz sicher sei.
»Und sonst?«
»Die Klinge war zwei Zentimeter breit und mindestens fünfzehn lang. Die Spitze hat das Herz durchbohrt, genau wie ich dachte. Sie ist glatt zwischen den Rippen durchgeglitten, hat sie nicht mal angekratzt; wer immer das getan [37] hat, verstand genug davon, um die Klinge horizontal zu halten. Und der Winkel war perfekt.« Er hielt einen Augenblick inne, dann fügte er hinzu: »Da es auf der linken Seite war, würde ich sagen, der Täter war Rechtshänder oder hat zumindest die rechte Hand benutzt.«
»Und seine Größe? Können Sie darüber etwas sagen?«
»Nein, nichts Definitives. Aber er muß dem Toten ziemlich nahe gekommen sein, wahrscheinlich hat er ihm direkt gegenübergestanden.«
»Gibt es Anzeichen für einen Kampf? Irgendwas unter seinen Fingernägeln?«
»Nein. Nichts. Aber er hat fünf bis sechs Stunden im Wasser gelegen, wenn also überhaupt etwas da war, ist es wahrscheinlich abgespült worden.«
»Fünf bis sechs Stunden?«
»Ja. Ich schätze, er ist so zwischen Mitternacht und ein Uhr gestorben.«
»Noch etwas?«
»Nichts Besonderes. Er war in sehr guter körperlicher Verfassung, sehr muskulös.«
»Und der Mageninhalt?«
»Er hat ein paar Stunden vor seinem Tod etwas gegessen. Wahrscheinlich ein Sandwich. Schinken und Tomate. Aber getrunken hat er nichts, jedenfalls nichts Alkoholisches. Er hatte keinen Alkohol im Blut, und so wie seine Leber aussieht, würde ich sagen, er hat sehr wenig getrunken, wenn überhaupt.«
»Narben? Operationen?«
»Eine kleine Narbe hatte er«, begann Rizzardi, dann hielt er inne, und Brunetti hörte Papier rascheln. »Am [38] linken Handgelenk, halbmondförmig. Könnte alles mögliche sein. Keinerlei Operationen. Er hatte noch seine Mandeln, und den Blinddarm auch. Vollkommen gesund.« Brunetti hörte an der Stimme, daß Rizzardi ihm mehr nicht sagen konnte.
»Danke, Ettore. Schicken Sie mir einen Bericht?«
»Möchte Seine Obrigkeit ihn sehen?«
Brunetti grinste über Rizzardis Titel für Patta. »Er möchte ihn haben. Ich bin nicht sicher, ob er ihn lesen wird.«
»Na, wenn er es tut, wird er feststellen, daß er so von medizinischer Fachterminologie strotzt, daß er mich zum Übersetzen braucht.« Vor drei Jahren hatte Patta versucht, Rizzardis Einstellung als Leichenbeschauer zu hintertreiben, weil der Neffe eines Freundes von ihm gerade sein Medizinstudium abgeschlossen hatte und einen Posten beim Staat suchte. Aber Rizzardi mit seiner fünfzehnjährigen Erfahrung als Pathologe war eingestellt worden, und seitdem führten er und Patta einen Guerillakrieg gegeneinander.
»Also, dann freue ich mich auf die Lektüre«, sagte Brunetti.
»Oh, Sie werden kein Wort verstehen. Versuchen Sie es erst gar nicht, Guido. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an, und ich erkläre es Ihnen.«
»Was ist mit seiner Kleidung?« fragte Brunetti, obwohl er wußte, daß dies nicht in Rizzardis Aufgabenbereich gehörte.
»Er hatte Jeans an, Levi’s. Und einen Turnschuh Marke Reebok, Größe 44.« Bevor Brunetti etwas sagen konnte, [39] fuhr Rizzardi fort: »Ich weiß, ich weiß. Das heißt noch nicht, daß er Amerikaner war. Levi’s und Reeboks kann man heute überall kaufen. Aber seine Unterwäsche war amerikanisch. Die Etiketten waren in Englisch, und es stand ›Made in USA‹ drauf.« Die Stimme des Arztes veränderte sich, und ein für ihn ungewöhnliches Interesse kam durch. »Haben Ihre Jungs bei den Hotels etwas in Erfahrung bringen können? Irgendeinen Hinweis darauf, wer er war?«
»Ich habe noch nichts gehört, deshalb nehme ich an, daß sie immer noch telefonieren.«
»Ich hoffe, Sie finden heraus, wer er ist, damit Sie ihn nach Hause schicken können. Es ist nicht schön, in der Fremde zu sterben.«
»Danke, Ettore. Ich werde mein Bestes tun, um herauszufinden, wer er ist. Und ihn nach Hause schicken.«
Er legte auf. Ein Amerikaner. Er hatte keine Brieftasche bei sich gehabt, keinen Paß, keinen Ausweis, kein Geld, bis auf die paar Münzen. All das deutete auf Straßenraub hin, einer, der schrecklich danebengegangen war und mit Mord geendet hatte statt mit Raub. Und der Dieb besaß ein Messer und hatte es entweder mit Glück oder mit Geschick eingesetzt. Straßenkriminelle in Venedig hatten manchmal Glück, aber sie besaßen selten Geschick. Sie griffen zu und rannten. In jeder anderen Stadt hätte dies für einen Raubüberfall mit tödlichem Ausgang gehalten werden können, aber hier in Venedig passierte so etwas einfach nicht. Geschick oder Glück? Und wenn es Geschick war, wessen Geschicklichkeit war es dann, und warum war es nötig gewesen, Geschick einzusetzen?
[40] Er rief unten im Hauptbüro an und fragte, ob es schon irgendeinen Erfolg bei den Hotels gäbe. Die Hotels erster und zweiter Klasse vermißten nur einen Gast, einen etwa Fünfzigjährigen, der vergangene Nacht nicht in sein Zimmer im Gabrielli Sandwirth zurückgekehrt war. Die Männer hatten begonnen, die kleineren Hotels zu überprüfen, von denen eines einen Amerikaner hatte, der vergangene Nacht abgereist war, dessen Beschreibung aber nicht paßte.
Brunetti war klar, daß er auch eine Wohnung in der Stadt gemietet haben konnte; in dem Fall mochten Tage vergehen, bevor er als vermißt gemeldet wurde; oder er wurde womöglich gar nicht vermißt.
Er rief im Labor an und verlangte Enzo Bocchese, den Leiter. Als dieser an den Apparat kam, fragte Brunetti: »Bocchese, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse aus dem Tascheninhalt gewinnen können?« Er mußte nicht dazusagen, wessen Tascheninhalt.
»Wir haben die Fahrkarte mit dem Infrarot geprüft. Sie war so durchweicht, daß ich nicht geglaubt habe, wir würden etwas erkennen. Haben wir aber.«
Bocchese, der so schrecklich stolz war auf seine technischen Geräte und was er alles damit machen konnte, wollte immer erst gebeten und dann gelobt werden. »Sehr gut. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber Sie finden ja immer etwas.« Wenn das nur annähernd wahr wäre! »Woher stammte sie?«
»Aus Vicenza. Rückfahrkarte nach Venedig. Gestern gekauft und für die Hinfahrt entwertet. Ich habe einen Mann vom Bahnhof herbestellt, um zu sehen, ob der an [41] der Entwertung feststellen kann, welcher Zug es war, aber ich glaub’s nicht.«
»Für welche Klasse war sie? Erste oder zweite?«
»Zweite.«
»Noch etwas? Socken, Gürtel?«
»Hat Rizzardi Ihnen etwas über die Kleidung gesagt?«
»Ja. Daß die Unterwäsche amerikanisch ist.«
»Genau. Keine Frage. Der Gürtel – den hätte er überall kaufen können. Schwarzes Leder mit einer Messingschnalle. Die Socken sind Synthetik. Hergestellt in Taiwan oder Korea. Werden überall verkauft.«
»Noch was?«
»Nein, nichts.«
»Gute Arbeit, Bocchese, aber ich glaube nicht, daß wir mehr als die Fahrkarte brauchen, um Gewißheit zu haben.«
»Gewißheit, Commissario?« fragte Bocchese.
»Daß er Amerikaner ist.«
»Warum?« fragte der Laborleiter, eindeutig verwirrt.
»Weil dort die Amerikaner sind«, erklärte Brunetti. Jeder Italiener in der Gegend wußte von dem Stützpunkt in Vicenza. Caserma irgendwas, der Stützpunkt, wo Tausende von Amerikanern mit ihren Familien wohnten, auch heute noch, fast fünfzig Jahre nach Kriegsende. Ja, das würde ganz bestimmt das Schreckgespenst Terrorismus heraufbeschwören, und es gab sicher Probleme wegen der Zuständigkeit. Die Amerikaner hatten ihre eigene Polizei da draußen, und sobald jemand das Wort »Terrorismus« auch nur flüsterte, konnte sehr wohl die NATO mit ins Spiel kommen, und möglicherweise Interpol. [42] Oder sogar die CIA, eine Vorstellung, bei der Brunetti das Gesicht verzog, wenn er nur daran dachte, wie Patta im Blitzlichtgewitter baden würde, in der Berühmtheit, die deren Ankunft mit sich brächte. Brunetti hatte keine Ahnung, wie Terrorakte sich anfühlten, aber für sein Gefühl war dies hier keiner. Ein Messer war eine allzu gewöhnliche Waffe; es sicherte dem Verbrechen keine Aufmerksamkeit. Und es hatte keinen Bekenneranruf gegeben. Der könnte vielleicht noch kommen, aber das wäre dann zu spät, zu passend.
»Natürlich, natürlich«, sagte Bocchese. »Daran hätte ich denken sollen.« Er wartete, ob Brunetti noch etwas sagen wollte, und als nichts kam, fragte er: »Sonst noch etwas, Commissario?«
»Ja. Wenn Sie mit dem Mann von der Bahn gesprochen haben, lassen Sie mich bitte wissen, ob er Ihnen etwas über den Zug sagen konnte, den er genommen hat.«
»Ich bezweifle, daß er das kann, Commissario. Es ist nur eine Ausstanzung auf der Fahrkarte. Wir können daraus nichts entnehmen, was auf einen bestimmten Zug hindeutet. Aber ich rufe Sie an, wenn er es uns sagen kann. Noch etwas?«
»Nein, nichts weiter. Und vielen Dank, Bocchese.«
Nachdem sie aufgelegt hatten, saß Brunetti an seinem Schreibtisch, starrte an die Wand und überdachte diese Information und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Ein junger Mann, körperlich fit, kommt nach Venedig mit einer Rückfahrkarte aus einer Stadt, in der ein amerikanischer Militärstützpunkt ist. Die zahntechnischen Arbeiten in seinem Mund sind [43] amerikanischer Machart, und er hat amerikanische Münzen in der Tasche.
[44] 3
Während er auf die Verbindung wartete, kam das Bild dieses jungen Gesichtes mit den im Tod offenen Augen ihm wieder ins Gedächtnis. Es hätte irgendeines der Gesichter sein können, die er auf den Fotos von amerikanischen Soldaten im Golfkrieg gesehen hatte: frisch, glattrasiert, unschuldig, strotzend von jener außergewöhnlichen Gesundheit, die so charakteristisch für Amerikaner war. Aber das Gesicht des jungen Amerikaners am Kanalufer war seltsam ernst gewesen, von seinen Kameraden abgehoben durch das Mysterium des Todes.
»Brunetti«, meldete er sich auf das Summen seiner Sprechanlage.
»Sie sind schwer zu finden, diese Amerikaner«, erklärte der junge Mann von der Vermittlung. »Im Telefonbuch von Vicenza ist der Stützpunkt nicht verzeichnet, auch nicht unter NATO oder unter Vereinigte Staaten von Amerika. Aber unter Militärpolizei habe ich eine Nummer gefunden. Wenn Sie einen Augenblick warten, Commissario, stelle ich die Verbindung her.«
Wie merkwürdig, dachte Brunetti, daß eine Macht, die so präsent war, im Telefonbuch so gut wie unauffindbar sein sollte. Er lauschte den normalen Klickgeräuschen eines Ferngesprächs, hörte es am anderen Ende klingeln und dann eine männliche Stimme sagen: »M.P. Station, kann ich Ihnen helfen, Sir oder Madam?«
»Guten Tag«, sagte Brunetti auf englisch. »Hier spricht [45] Commissario Guido Brunetti von der venezianischen Polizei. Ich hätte gern mit dem Mann gesprochen, dem bei Ihnen die Polizei untersteht.«
»Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit, Sir?«
»In einer polizeilichen. Können Sie mich mit dem verbinden, der dafür zuständig ist?«
»Einen Moment bitte, Sir.«
Es folgte eine lange Pause, in der man am anderen Ende gedämpfte Stimmen hörte, dann sagte eine neue Stimme: »Hier ist Sergeant Frolich. Kann ich Ihnen helfen?«
»Guten Tag, Sergeant. Hier ist Commissario Brunetti von der venezianischen Polizei. Ich möchte gern mit Ihrem vorgesetzten Offizier sprechen.«
»Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit, Sir?«
»Wie ich Ihrem Kollegen schon erklärt habe, in einer polizeilichen«, antwortete Brunetti in unverändertem Ton, »und ich möchte mit Ihrem vorgesetzten Offizier sprechen.« Wie lange würde er wohl noch weiter dieselbe Formel wiederholen müssen?
»Es tut mir leid, Sir, aber er ist im Augenblick nicht hier.«
»Wann erwarten Sie ihn zurück?«
»Das kann ich nicht sagen, Sir. Könnten Sie mir einen Anhaltspunkt geben, worum es geht?«
»Um einen vermißten Soldaten.«
»Entschuldigung, Sir?«
»Ich wüßte gern, ob bei Ihnen ein Soldat vermißt gemeldet ist.«
Die Stimme wurde plötzlich ernst. »Wer, sagten Sie, spricht da?«
[46] »Commissario Brunetti. Venezianische Polizei.«
»Können Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben?«
»Sie können mich bei der Questura in Venedig erreichen. Die Nummer ist 52032