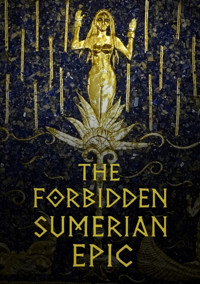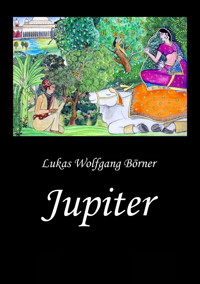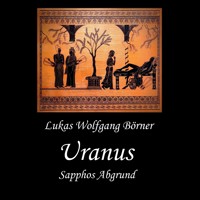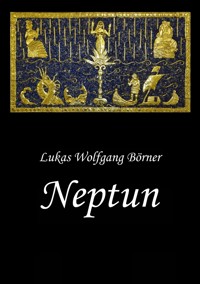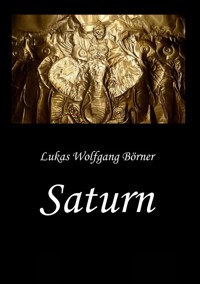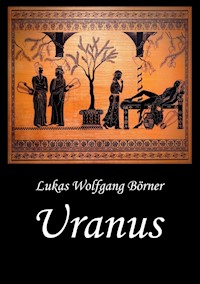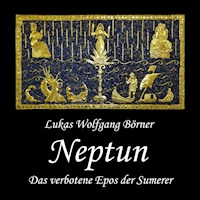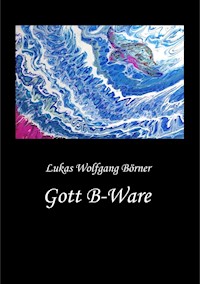7,99 €
Mehr erfahren.
Ein Mörder unter den Gästen. Die Gäste eingepfercht in ein Hotel. Das Hotel umringt von Höhlenlöwen. Die Höhlenlöwen im Herzen des Eiszeitparks. Der Eiszeitpark unter der Kontrolle einer einzigen Person: Der Leiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2022 Lukas Wolfgang Börner
Coverdesign von: Sabrina Börner (boerner-literatur.de)
ISBN Softcover: 978-3-347-56156-4
ISBN Hardcover: 978-3-347-56163-2
ISBN E-Book: 978-3-347-56165-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Lukas Wolfgang Börner
Endzeitpark
Kowalskis Entdeckung
Der Tabak knisterte, als sich die Glut in die Zigarette fraß. In weniger als einer Minute, das waren exakt zwölf Zuckungen seines Mundwinkels, würde sie vollständig in Rauch aufgegangen sein.
Kowalski war kein Freund von Überraschungen. Ein Leben im Labor war nicht anders als ein Leben vor dem Bildschirm. Alles theoretisch, alles bloße Schablone der Wirklichkeit. Es befriedigte ihn nicht und manchmal, wenn er mit seinen Freunden am Tresen ihres Stammausschanks Myśliwska lehnte, träumte er grölend vom großen Durchbruch – und wusste doch, dass er sich selbst betrog.
Mit einer nachlässigen Geste schabte er die giftigen Rückstände des Methanamids von seinen Fingernägeln, ehe er die Zigarette ausdrückte. Neues Futter für die alte Yucca, einen mexikanisch-eurasischen Hybriden, der gemächlich unter Hunderten von Zigarettenstummeln dahinstarb. Der schäbige Vorhof des Labors stank vor Rauch und Kowalski öffnete die Glastür. In einem anderen Job, einem anderen Leben hätte der Vorhof ein behaglicher Wintergarten sein können, aber was ging ihn das an?
Gleich würde Robertsson aufkreuzen. Kowalski hatte seine Anrufe schon viermal an diesem Nachmittag weggedrückt – ihm war nicht nach Sprechen zumute. Aber er wusste, dass Robertssons feines Gespür nicht zu hintergehen war.
Kowalskis Mund zuckte, vier braune Fingerkuppen drehten mechanisch eine neue Zigarette.
Aber es war unmöglich, dass der Professor ahnen oder auch nur denken konnte, was er dort in den Katakomben der Laborräume, dem sogenannten Seziersalon, entdeckt hatte.
Hätte Kowalski seine geliebte Piotra noch gehabt, er hätte sie angerufen und hierher bestellt. Er hätte den guten alten Lada Granta schon von weitem gehört, seinen Flickenkittel, der lange schon Teil seiner abgenutzten Alltagskleidung geworden war, anbehalten, sich selbst ans Steuer gesetzt, um mit ihr auf- und davonzufahren. Nach Finnland vielleicht. Oder nach Usbekistan. Nur weg von hier.
Kowalski strich mit der Glut über die spröde Haut seines Mittelfingers, die Stelle, wo vor wenigen Jahren noch der Verlobungsring gewesen war. Die Haut schmolz dahin, aber es zuckte kein Schmerz über seine Lider. Nichts, rein gar nichts konnte ihn noch außer Fassung bringen.
Von dieser einen Sache abgesehen.
„Was faseln Sie da?“
Robertsson wedelte den Laborpraktikanten, der ihn eingelassen hatte, wie eine lästige Fliege fort. Kowalski fuhr herum. Es war das erste Mal, dass er Robertsson in Levis und Rollkragen sah. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund, um sein freudloses Feixen zu kaschieren. Mit dem hängenden Augenlid, dem Überbleibsel einer falschen Phosphordosierung vor siebenundzwanzig Jahren, sah sein Chef wie ein betrunkener Steve Jobs aus.
Was nun mit Sicherheit folgte, war die altbekannte Ansammlung von Ermahnungen, Belehrungen und Androhungen einer Kündigung … oder etwa nicht?
Kowalski wusste, dass die Karten neu gemischt waren, dass er heute eine Macht besaß, die keineswegs zu unterschätzen war – so gern er auch darauf verzichtet hätte. Robertsson erkannte das neue Machtgefüge, sowie er dem greisenhaften Mittvierziger in die Augen sah.
Im bläulich verrauchten Licht, das durch die Dachscheiben fiel, trieben ganze Schollen aus Staub, wild und orientierungslos, doch ohne je zu kollidieren – ein ebenso lachhaftes wie ungelöstes chemisches Phänomen. Robertsson blies hinein und blickte dem wirbelnden Schmutz hinterher.
„Ist es …“, er verstummte so rasch, wie er begonnen hatte. Seine Ahnungen waren Unsinn. Geradezu wahnwitzig. Kowalski fütterte die Yucca mit einem weiteren Stummel, ohne dem stotternden Professor zu Hilfe zu kommen. Der staubige Wirbel der Gezeiten umfloss die beiden Chemiker, die allein ihre Halsstarrigkeit verband.
„Sprechen wir vom … vom unteren Geschoss?“, fuhr Robertsson fort, gleichwohl Kowalski genau genommen noch gar kein Wort gesprochen hatte. Sein Gegenüber wandte sich ab. Er wusste nicht, was er antworten sollte, und wollte, bevor er sich entschied, keineswegs von einem falschen Wimpernschlag verraten werden. Er schloss die Glastür, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Als er sich umsah, war Robertssons Gesicht erblasst. „Sie wollen doch nicht sagen … Sie meinen doch nicht etwa … den Seziersalon?“
Es war zu spät, alles abzustreiten. Zu spät, die Entdeckung vor sich selbst zu leugnen. Kowalskis Mundwinkel zuckten zu wild. Die braunen Fingerkuppen vergruben sich zu tief in seinem Tabaksbeutel. Ein Praktikant rief von weitem Robertssons Namen, aber niemand beachtete ihn.
Piotra, dachte Kowalski. Oh, Piotra. Dich jetzt in die Arme schließen, die Nase in deinem Nacken versenken zu können …
Robertsson zupfte an seinem Rollkragen und seine Finger knackten dabei. „KP 31?“
Kowalski sah ihn lange an, sah die letzte Hoffnung in den Augen des Professors flackern – aber er musste ihn mit einem Blick auf den verdreckten PVC-Boden enttäuschen.
Weißer als sein Doktorkittel war Robertssons Teint, sein rechtes Auge war das erste Mal seit siebenundzwanzig Jahren in voller Größe zu sehen. Als er sprach, war das Zittern seiner Zähne zu hören: „KP … 34?“
Kowalski nickte und der Professor stürzte ohnmächtig zu Boden.
*
Die Einladung
„Johann!“
Die Stimme von Cleos Mutter weckte mich aus meiner Träumerei. Die Nachricht auf meinem Handy war noch frisch, das Eisessen mit Mädchen 1 und der Kinoabend mit Mädchen 2 bereits fix.
„Es läuft“, murmelte ich so dezent vor mich hin, dass Cleo sich die Ohren zuhielt.
Trüber Schweiß rann über seine Birne, als er aufsah. Er saß, wie er beteuert hatte, schon seit Sonnenaufgang hier auf der Terrasse, um irgendwelche Gesteinsbrocken, die er irgendwo erstanden hatte, auf Buchstaben zu untersuchen. Er behauptete steif und fest, die fehlenden Splitter von irgendwelchen nostalgischen Schrifttafeln gefunden zu haben – dem sogenannten Gilatier-Epos.
„Gilgamesch-Epos“, verbesserte er mich. „Und wenn ich die Zeilen richtig zusammenfüge und übersetze, werde ich so reich und berühmt, dass ich allein darum zwei Mädchen bei mir beschäftigen muss, um die anderen daten zu können.“
„Hoho!“ – Ich betrachtete meinen rotglänzenden Freund mit einer Mischung aus Übermut und Mitleid. Die Pubertät machte ihm schwer zu schaffen. Sein Gesicht hatte sich im Laufe des Sommers in einen Kirsch-Quarkstrudel verwandelt und statt zu sprechen, jodelte er bei fast jedem Satz. Außerdem war er, um das Maß der Ungerechtigkeit vollzumachen, seit bestimmt zwei Jahren keinen Zentimeter gewachsen, was dazu führte, dass er unterdessen der Kleinste in der Klasse war. Nur zwei Mädchen sind noch kleiner als er und auch nur dann, wenn sie dringend aufs Klo müssen.
Das ist echt bitter.
Mich hingegen haben die Götter gesegnet. Groß bin ich geworden, ja, geradezu riesig. Und ziemlich schlank. Manche sagen sogar, ich wäre voll schlank. Ich brauche keine Zahnspange und kein Pickelpuder und würde sicherlich an der Spitze der Klassennahrungskette rangieren – wenn ich in Punkto Schlagfertigkeit nicht an der Schwelle zur geistigen Behinderung stehen würde.
Hoppla, das mit der geistigen Behinderung sollte man so natürlich nicht sagen. Das diffamiert Betroffene.
Ich werde mich bemühen, mich künftig korrekter auszudrücken und jedes diffamierende Wort mit dem Wort ZAUDAMOM zu überdecken. Das bedeutet: Zensur aufgrund unangemessener Darstellung andersartiger Menschen oder Minderheiten.
Denn Minderheiten darf man nicht diffamieren. Nur Mehrheiten.
Seltsam ist das schon. Das Leid auf der Welt wäre mathematisch betrachtet doch geringer, wenn es umgekehrt wäre, oder?
Egal, das Wort ZAUDAMOM wird meine Kleingeistigkeit künftig angemessen kaschieren. Ich bin mir sicher, dass Sätze wie „Ja, sag mal, bist du denn eigentlich ZAUDAMOM, du Voll-ZAUDAMOM!?“ den Lesefluss nur unwesentlich beeinträchtigen werden.
In der Vergangenheit wurde mir häufig vorgeworfen, frauenfeindliches Betragen an den Tag gelegt zu haben – das lag aber nur an meinem Alter und der damit einhergehenden Einfältigkeit. Heute weiß ich, dass unsere ganze Gesellschaft durchzogen ist von Machtstrukturen und dass die Frauen da drin zappeln wie ein Käfer im Spinnennetz. Beziehungsweise eine Käferin im Spinner-Netz.
Ich will kein Spinner sein. Ich will jeden Menschen mit Respekt behandeln. Darum werde ich mit dem Wort ZAUDAMOM auch sexistische Begriffe überdecken, auch wenn Frauen jetzt nicht unbedingt einer Minderheit angehören. Aber andersartige Menschen sind sie ja in jedem Fall.
Außerdem werde ich mir angewöhnen, den weiblichen Plural mitzubenützen und von Lehrer*innen und Referendar*innen und Schüler*innen zu sprechen. Denn die Sprache unserer Väter – und Mütter – ist gleichberechtigungstechnisch eher dämlich als herrlich.
Aber nun zu mir.
Ich heiße Hugo Ramsauer und hab bis vor wenigen Wochen noch die achte Klasse besucht. Es war eine reine Bubenklasse, die aus exakt dreißig nach Schweiß stinkenden Schüler*innen bestanden hatte, und ich bin verdammt froh, dass wir jetzt, wo die Sommerferien rum sind, neu durchgemischt worden sind.
Auch darum, weil es in unserer neuen Klasse das ein oder andere Mädchen gibt, das ich gerne öfter sehe als nur in den beiden Pausen.
Das heißt natürlich nicht, liebe Leser*in, dass ich diese Mädchen auf ihr Äußeres reduzieren würde. Wo denkst du hin? Die haben sicherlich auch schöne Zähne und so.
Auch ich habe schöne Zähne. Und schwarze Haare, aber nicht auf den Zähnen, sondern auf dem Kopf halt. Und auch sonst an vielen Stellen meines maskulinen Teenager*innen-Körpers. Ich bin Fußball- (und Frauenfußball-)Fan und ein kognitives Wunderkind im Sektor Biologie. Wenn meine fleißige Mitarbeit auch nur ein wenig in die Notenberechnung einbezogen wird, kann ich es erfahrungsgemäß durchaus auf einen Zweier im Zeugnis bringen.
Mein Lieblingsessen ist ZAUDAMOM-Wurst mit Reiberdatschi, aber das gibt es bei uns daheim nur selten, weil meine Mutter Reiberdatschi lieber mit Jäger*innen-Schnitzel kombiniert. Dass sie es ist, die kocht, liegt aber nicht daran, dass sie in irgendwelchen Machtstrukturnetzen zappelt, sondern an den Kochkünsten meines Vaters. Der ist halt eher der handwerkliche … äh … Typ … aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich meine, frau darf das nicht falsch verstehen … ich …
Verdammt nochmal!!
Ich kann so nicht arbeiten!
Wieso muss ich mich überhaupt um Gleichberechtigung bemühen? Wer bemüht sich denn darum, dass ich gute Noten bekomme? Hm? Und wer bemüht sich darum, dass der Cleo seine Akne in den Griff bekommt? Hä?
Niemand tut das!
Und weißt du auch warum? Weil jeder der Schmied seines eigenen Glückes ist. Jawohl! Jederrrr! DER Schmied-d-d!
Cleo hat mal gesagt, er wüsste einen Ausweg aus der ganzen Genderproblematik. Man müsse das Mann-Sein weniger plastisch, sondern eher als Metapher verstehen. Als Metapher für etwas erstrebenswert Großartiges, was jeder Mensch – egal, ob Mann oder Frau – mit Einsatz und Mühe erreichen kann.
Er sagt, Sätze wie „Sei ein Mann!“ würden doch bereits belegen, dass man durchaus nicht als Mann geboren würde, sondern allein durch Mut, Tatendrang und Selbstdisziplin dahingelangen könnte. Deshalb würde auch kein Mensch „Sei eine Frau!“ sagen.
Die Gesellschaft, sagt er, müsse endlich umdenken und sich das Mann-Sein als gemeinschaftliches Endziel vor Augen führen. Sein Pamphlet dazu trägt den nachdenklichen Titel: „Das Mann-Sein als Luxus für Eliten?“
„Johann.“
Cleos Mutter umrundete das Haus. Ein feingekleideter Herr ging neben ihr. Mit freundlichen Augen blinzelte er uns an.
Für einen Moment stockte mir der Atem. Oder das Blut. Oder was halt sonst so stocken kann.
Das wird doch nicht ihr neuer Lover sein …?
Also, nicht dass es jetzt so wirkt, lieber Leser, als würde sie jeden Tag mit einem neuen Lover aufkreuzen – eigentlich sogar ganz im Gegenteil.
„Da seid ihr ja“, sagte sie. Ihre Augen blitzten. Cleo machte einen unheilvollen Katzenbuckel. „Das hier ist Herr Grün. Er möchte sich gerne mit euch unterhalten.“
Es störte mich, dass Herr Grün einen cremefarbenen Anzug und auch sonst nichts Grünes trug. Ich finde, wenn man Herr Grün heißt, sollte man auch entsprechend auftreten, sonst ist man ein Blender.
„Das ist der Hugo und das hier ist mein Sohn, der Johann.“
Ich reichte Herrn Grün die Hand, ohne aufzustehen. Cleo, den der Schweiß vorübergehend erblindet hatte, streckte seine Hand aus und langte seiner Mutter an die Hupen.
„Soso“, erwiderte Herr Grün, nachdem Cleos Hand an ihn weitergereicht worden war. „Dann sind wir beide wohl Namensvettern.“
Das hätte er nicht sagen sollen.
Seit der Scheidung von Cleos Eltern haben meines Wissens exakt zwei Männer das Haus betreten. Und beide hat Cleo innerhalb weniger Minuten wieder hinausgeekelt. Seitdem weigern sich der Kaminkehrer und der Gasableser, Cleo die Hand zu schütteln.
Wahrscheinlich ist das der Grund für seine Glücklosigkeit, also, ich meine, was seine äußere Erscheinung betrifft.
Die Steinbrocken polterten auf den Terrassenboden, als Cleo wie ein Schachtelteufel hochfuhr. „Habt ihr etwa schon geheiratet?! Hä? Und umgetauft bin ich wohl auch schon!“
Herr Grün wechselte einen bestürzten Blick mit Cleos Mutter, die ihren Sohn mit einem traurigen, aber sehr warmen Lächeln bedachte. „Alles gut, Schatz. Herr Grün …“
„Herr Grün, Herr Grün!“, unterbrach Cleo sie. „Sind wir hier bei Cluedo? Wenn ich irgendwann spurlos verschwinde, dann lass die Rohrzange bitte auf Fingerabdrücke untersuchen!“
„Ich meinte,“ erwiderte Herr Grün stotternd. „dass ich auch Johann heiße. Johann Grün. Und nein, wir haben nicht geheiratet, keine Sorge.“
„Mein Mann und ich haben uns letztes Jahr scheiden lassen“, erklärte Cleos Mutter mit gedämpfter Stimme und ich fragte mich noch, für wen sie die Stimme eigentlich dämpfte. Für die Nachbarn vielleicht? Wenn ich Cleos Wutanfälle der letzten Monate so zusammenrechne, sollten die das bereits mitbekommen haben.
„Es ist nicht immer leicht,“ fügte sie hinzu, „aber er hat es eigentlich ganz gut verwunden.“
Und an uns gewandt: „Herr Grün ist Professor und Doktor der Paläontologie und Geologie.“
„Geobiologie“, verbesserte Prof. Dr. Grün. „Sie haben sicher von meiner Abhandlung über die rüssellosen Stegodonten im beginnenden Holozän gehört.“
Ich verschüttete meinen Orangensaft. Und bemerkte überhaupt erst jetzt, dass ein Glas Orangensaft vor mir gestanden war. Cleos Mutter musste es mir heimlich untergeschoben haben.
„Oh ja, ich habe es ganz gelesen!“, rief ich aus, auch wenn ich kaum übers Vorwort hinausgekommen war. Aber es lag zumindest auf meinem Nachtkastl und das ist es doch, was zählt, oder nicht? Cleo sagt dazu gewöhnlich: Gut bezahlt ist halb studiert.
„Aber sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass die rüssellos waren. Ich meine, wie hätten sie dann an Nahrung kommen sollen? Der Kopf ist doch fest mit dem Rumpf verwachsen.“
„Es spricht tatsächlich einiges dafür,“ Prof. Dr. Grün ergriff glücklich das Wort und einen Stuhl, „dass sich bei sämtlichen Mastodonten – heute sagt man ja fälschlicherweise Rüsseltiere dazu – die Rüssel zurückbildeten und die Tiere zunehmend verhungerten. Es handelt sich dabei um eine Seuche, die sogenannte phthisis manus, die sich, in abgewandelter Form, auch bei den rezenten Großen Pandas wiederfindet.“
„Jajaja“, gab Cleo zur Antwort. Er hatte sich weitgehend beruhigt, zufrieden war er aber nicht. Und der Umstand, dass er mit der Untersuchung seiner Schrifttafeln nun von vorn beginnen durfte, besserte seine Laune keineswegs. „Was verschafft uns denn die Ehre?“
Cleos Mutter stand auf und verschwand im Haus. Prof. Dr. Grün strich sich durch den kurzen grauen Vollbart wie ein gütiger Sankt Nikolaus. Mir fiel auf, dass er gute zehn Jahre jünger aussah, sowie er den Bart verdeckte.
Denk dran, Hugo, vermerkte ich in meinem geistigen Notizbuch, sobald dein Bart weiß wird: abrasieren! Aber erstmal warten, bis überhaupt ein Bart da ist.
Es gibt durchaus schon einige Mitschüler*innen, die einen Bartflaum vor sich hertragen. Auf meinem Gesicht hingegen wird man wohl noch jahrzehntelang Eisstock schießen können.
„Ich wollte Ihnen beiden ein Angebot machen.“
Hast du’s gehört, lieber Leser? Er hat Ihnen gesagt.
Es ist echt geil, wenn man gesiezt wird.
Wie gerne ich einfach mal jedem Hanswursten, der sich dafür einsetzt, die Sie-Form abzuschaffen, eine E-Mail schreiben würde! „Die Sie-Form“, würde ich schreiben, „ist ein wichtiges Mittel, anderen Menschen seinen Respekt zu zeigen, du Affe!“
Prof. Dr. Grün lehnte sich genüsslich zurück. Entweder, dachte ich und beförderte den Orangensaftrest mit der Kante meiner Hand ins Glas zurück, ist er himmelschreiend selbstverliebt oder er hat tatsächlich ein wundervolles Angebot in petto.
Hm, ein Angebot …
Hoffentlich kein unmoralisches.
Womöglich handelt es sich um einen Fall für Cleo&Co, unsere Detektei, die schon so lange brachliegt. Nach der Scheidung seiner Eltern hatte Cleo keinen Bock mehr auf den Kinderkram gehabt.
Überhaupt ist er ernster als früher. Dabei lassen sich Eltern doch alle Nase lang scheiden, das ist doch wirklich nichts Besonderes, oder?
Ich glaube, dass seine Tristesse mit seinem Vater zusammenhängt, der nach Friedrichshafen gezogen ist und dort, wie Cleo sagt, mit einer Zyklopin zusammenlebt.
Ob das wohl stimmt? Auf jeden Fall scheint er sich in ihrem Melonenauge total verloren zu haben, denn er meldet sich immer seltener. Außerdem stinkt es Cleo, dass Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke chronisch eine Woche zu spät ankommen. Meine wiederholte Erklärung, dass es von der Nordsee bis hier her einfach ein weiter Weg ist, tröstet ihn überhaupt nicht.
Trotzdem tut mir Cleo weit weniger leid als seine Mutter. Sie ist noch so fesch und, ja klar, schon irgendwie alt, aber nicht so alt, dass man sie nicht mehr liebhaben könnte, verstehst du?
„Ich glaube, da muss ich Sie enttäuschen“, erwiderte Cleo.
Aber Herr Grün hob beschwichtigend die Hand.
Darf man überhaupt Herr sagen, wenn einer einen Professoren- und Doktortitel hat? Oder muss man dann immer Prof. Dr. sagen? Ach, egal.
Lass mich halt endlich mit der Geschichte fortfahren, lieber Leser, und grätsch mir nicht dauernd dazwischen!
„Ich bin hergekommen,“ erwiderte Herr Grün, noch immer gütig lächelnd, „um den Entdeckern des isotelus romanus meinen höchsten Respekt auszusprechen.“
Cleo und ich tauschten einen Blick. Ich sah, wie der Stolz über unsere Entdeckung Cleos Zornfalte glättete.
„Überdies scheine ich mich hier doch im Garten des beliebten und überaus geistreichen Internet-Bloggers Johann Reuther zu befinden, besser bekannt als Cleo W. Südseekönig. Für was steht das W eigentlich?“
Nun war Cleo zufrieden. „Für Wurstsalat“, gab er zur Antwort und bot dem Gast artig meine letzte Lakritzschnecke an.
„Was können wir für Sie tun, Herr Doktor?“, fragte ich.
Völlig unprofessionell biss der Professor in seine unentrollte Lakritzschnecke, nahm abwesend kauend ein Glas Orangensaft entgegen, das Cleos Mutter eben herausbrachte, und beendete seine Geheimniskrämerei:
„Ich besitze ein Waldgebiet in Polen, nahe der weißrussischen Grenze. Meine Wissenschaftler und ich haben in … ja, inzwischen mögen es schon über zehn Jahre sein – einen Natur-Themenpark aus dem Boden gestampft mit allen Schikanen und großartigen Attraktionen – Sie würden begeistert sein. Nun sind unsere Forschungen weitgehend abgeschlossen … ich meine, es wird auch weiterhin geforscht werden, aber die ersten Populationen sind ja bereits ausgewildert und vollständig lebensfähig, nicht wahr? Darum trommle ich gerade ein heterogenes Grüppchen namhaften Fachpersonals zusammen, das meinen Park besichtigen und pünktlich zur Eröffnung davon berichten soll.“
„Und ausgerechnet wir sollen ein Teil dieses Grüppchens sein?“, erwiderte Cleo.
„Was für ein Park soll das denn sein?“, fragte ich. Herr Grün überreichte mir das Glas Orangensaft, das er noch immer in der Hand hielt. Seine Augen funkelten mich an, als er antwortete: „Er entspricht exakt Ihrem Interesse, möchte ich meinen.“
Ich verstummte.
Ein Themenpark, der exakt meinem Interesse entspricht … der muss ja voller nackter Mädchen sein.
„Ich sagte ja, dass ich gern ein heterogenes Grüppchen dabeihätte“, fuhr der Professor an Cleo gewandt hinzu. „Ihr würdet auf jeden Fall Bekanntschaft mit dem Vorsitzenden des Schwäbische-Alb-Museums Häberle, dem Philosophen Gedik, dem renommierten Löwendompteur Idle und dem südkoreanischen Stammzellforscher Rhee machen – der übrigens einer der Klon-Pioniere schlechthin ist. Und dann ist da noch eine gewisse Madame Voiture.“
„Und was ist die von Beruf?“
„Keine Ahnung, ehemalige Journalistin oder so – aber wir brauchen nun mal eine Frau dabei, sonst bekomme ich Ärger.“
Er machte eine kurze Pause. Dann fuhr er fort: „Wissen Sie, der Park wird höchstwahrscheinlich vor allem junge Leute ansprechen. Deshalb wäre es für mich äußerst zielführend, wenn ich jemanden dabeihätte, der sich mit Sozialen Medien und dem ganzen Kladderadatsch auskennt. Zumal, wenn er ganz nebenbei für solch einen heftigen Lazarus-Effekt gesorgt hat wie Sie beide.“
Cleo und ich lächelten – und hofften inständig, dass Herr Grün uns gelobt und nicht etwa durch den Schleier des Wissenschaftsgeschwurbels beleidigt hatte.
„Nur, dass ich das richtig verstehe“, schaltete sich Cleos Mutter ein. „Sie wollen die beiden einladen, Ihren Themenpark zu besichtigen?“
„Das möchte ich“, gab der Professor zur Antwort.
„Und es handelt sich dabei um einen Urzeitpark im weitesten Sinne, wie?“
„Im weitesten Sinne, ja“, nickte Herr Grün. „Ich darf noch nicht zu viel davon verraten, aus juristischen Gründen, nicht wahr? Sie brauchen sich aber keine Sorgen zu machen – es ist ganz sicher nicht gefährlich.“
„Ich mache mir keine Sorgen“, winkte sie ab. „Wann soll das Ganze denn stattfinden?“
„Ende Oktober.“
„Und wie lange?“
„Über das Allerheiligenwochenende, also zwei Übernachtungen, Anreise in der Früh, Abreise am Abend. Und das Gefahrenpotenzial ist übrigens wirklich gleich null.“
„Und die beiden sind eingeladen, sagten Sie? Es bliebe quasi nur noch der Flug zu bezahlen?“
„Selbstverständlich nicht. Ich habe die Tickets sogar bei mir.“ Und er zog zwei Hin- und Rückflugtickets aus seiner Anzugtasche.
„Im Gegenzug“, erwiderte Cleo, „sollen wir im Nachgang über den Park berichten, was?“
Herr Grün lächelte etwas verschämt: „Das wäre sehr freundlich.“
Dann erhob er die Stimme, dass wir zusammenzuckten: „Sie müssen aber keine Werbung machen! Sie können schreiben, was Sie wollen! Aber mit Verlaub, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ihnen der Park nicht zusagen sollte – zumal das Unterfangen wirklich nicht lebensbedrohlich ist. Wirklich nicht! Ich verbürge mich dafür, dass Sie beide wieder heil nach Hause kommen!“
Betretene Stille.
„Hm … ich wüsste nicht, was da dagegen spräche“, sagte ich.
„Jou“, gähnte Cleo, „klingt eigentlich ganz witzig.“
„Wir müssen das natürlich noch in Ruhe überdenken“, gab Cleos Mutter etwas diplomatischer zurück. „Aber nach allem, was Sie so erzählt haben, denke ich, dass das schon in Ordnung geht.“
„Das freut mich!“ Herr Grün steckte sich den Rest der Lakritzschnecke in den Mund. „Wie heißt es doch so schön: No risk, no fun, nicht wahr?“
*
Mädchen 1
Wir hatten zugesagt. Meine Eltern vertrauen Cleos Mutter. Und Cleos Mutter sagte, dass sie glaubte, dass wir keine Begleitperson benötigen würden.
Zumindest, nachdem Cleo gesagt hatte, dass er – wenn schon jemand mitkommen müsse, um auf uns achtzugeben – am liebsten seinen Vater dabeihätte. Auch wenn dann, wie er sagte, dessen neues Gspusi ebenfalls mitkommen würde – aber das wäre wohl zu ertragen. Und da fand Cleos Mutter, dass wir doch eigentlich schon alt genug wären, um alleine zu reisen.
„Wir werden die Ersten sein, die diesen Park besuchen“, protzte ich beim Eisessen mit Franziska. „Wir und noch eine Handvoll ähnlicher Fachidioten.“
Selbstironie ist wichtig bei Frauen, lieber Leser. Wer selbstironisch ist, hat mehr Chancen – auch wenn ich das eigentlich gar nicht nötig hätte, denn die Franzi frisst mir ohnehin aus der Hand.
Jedes Wochenende telefonieren wir, manchmal zwei oder drei Stunden lang. Außerdem machen wir seit Beginn der neunten Klasse einen Tanzkurs miteinander. Und es war die Franzi, die mich gebeten hat, diesen Tanzkurs mit ihr zu machen.
Und das hat sie bestimmt nicht bereut. Jeden Donnerstagabend fasse ich sie ehrerbietig bei Hand und Achsel, wirble sie herum, dass die anderen Paare zur Seite hüpfen, und führe meine Schritte so kunstgerecht, so über alle Maßen formvollendet, dass sie tatsächlich nur ein einziges Mal aussetzen musste, um eine Wunde, die ich ihr in den Fuß getreten hatte, verarzten zu lassen.
Ach, Franzi …
Wie schmachtend sie doch immer zu mir aufsieht und wie hübsch sie ist mit ihrer verwegenen Strubbelfrisur! Und wie schlau sie ist!
Es gibt, lieber Leser, ein paar Wahrheiten auf der Welt. Dass eins plus eins zwei ergibt, zum Beispiel. Oder dass es am Tag heller ist als in der Nacht. Oder dass Schnee kälter ist als Lava.
Zu diesen einfachen Wahrheiten gehört, dass Pistazieneis die mit Abstand beste Eissorte ist. Es gibt Menschen, die über die geistige Reife verfügen, das einzusehen, und solche, die für diese hohe Wahrheit – wie sage ich es am besten? – zu unbedarft sind. Solche Menschen werden ihr Leben lang Getriebene von Fake News und Verschwörungstheorien sein – nicht aber meine Franzi.
Die hat sich ein Grüne-Nudeln-Eis bestellt, das ist quasi ein Spaghetti-Eis auf Pistazienbasis. Ich habe mir wie immer einen Bananensplit bestellt, ausschließlich mit Pistazieneis und natürlich ohne Banane. Pistazieneis und Bananen passen beim besten Willen nicht zusammen.
„Oh Mann,“ sagte Franzi, „da tät ich auch gern mitkommen.“
„Das ist bestimmt machbar“, erwiderte ich lässig, während ich die Sahne unterrührte. Wenn die leicht angefroren ist, ist der Geschmacksorgasmus … äh … multipel.
„Es wäre bestimmt möglich, dich mitzunehmen. Ich müsste halt nochmal Rücksprache mit dem Professor halten.“
Mein Blick blieb an dem geschäftigen Kellnerpärchen hängen. Die alljährliche herbstliche Unruhe lag bereits in all ihren Worten und Bewegungen. In wenigen Wochen würden sie wieder gen Süden in ihre Winterquartiere fliegen.
Franzis Petrol-Augen strahlten. „Dann könnte ich einen Artikel für das Amperblatt schreiben.“ Ihr Vater kennt irgendwen, der irgendwen beim Amperblatt kennt. Wie zur Untermalung ihrer Worte zog sie ein Amperblatt aus der Tasche und legte es auf den Tisch. Unter der Stellenmarktrubrik las ich die Worte: „Dringend gesucht: Transgenderbeauftragter (m/w) zur Festanstellung.“
Ich rückte meinen Stuhl unmerklich in ihre Nähe. Das Schaben des Stuhlbeins auf dem Pflaster war allerdings so laut, dass sämtliche Gäste herüberlurten.
„Das könnte der Beginn einer großen Karriere sein“, knarzte ich geheimnisvoll. „Manche Männer würden für so einen Gefallen sicherlich einen Kuss einfordern … aber du kennst mich ja und weißt, dass ich meine Macht niemals ausnützen würde.“
Franzi biss in die herzförmige Waffel, die sie zuerst beiseitegelegt hatte. „Ja, das weiß ich“, achselzuckte sie.
Es verstrichen einige Sekunden.
„Ich meine“, fügte ich hinzu, „ich werde den Professor sicherlich sehr bitten müssen und was der Cleo sagen wird – daran möchte ich gar nicht denken.“
Stille.
„Aber ich mach’s trotzdem, wenn ich dir einen Gefallen damit tue.“
„Danke“, sagte Franzi.
Wir aßen unser Eis auf.
„Es wäre“, beendete ich das Schweigen, „lediglich eine Form des Anstands, mir dankbar zu sein.“
„Ich hab doch schon Danke gesagt!“
Wir bezahlten und trennten uns.
So eine Blamage!
Gott sei Dank war da noch der Kinoabend mit Julia.
Ach, meine liebe Juli …
*
Mädchen 2
„Scheiße, ist das krank“, wisperte sie. Und sie ergriff meine Hand so heftig, dass die Nachoschale kippte und die Salsa-Soße mir gemächlich über die Beine rann. Ich hätte sie wegwischen müssen, aber das hätte bedeutet, ihre Hand loszulassen. Ihre heiße, weiche Hand …
Der Dämon hatte sich gerade durchs Babyfon bemerkbar gemacht – das war echt schaurig. Aber ich spürte keine Furcht. Nur ihre Hand spürte ich. Und die Soße, die in den Wunden meiner immerzu aufgekratzten Haxen wie Säure brannte.
In meinem Kopf pochte es. Ich durfte auf gar keinen Fall zulassen, dass sie die Hand wieder wegnahm.
Der erste Schritt ist meine große Schwäche. Eine Schwäche, die mich schon unzählige Chancen gekostet hat. Im Nachgang hatte ich immer gewusst, was die richtige Reaktion gewesen wäre, ach! ich hatte es auch schon währenddessen gewusst! Und doch kann ich es drehen und wenden, wie ich will: Bei Mädchen den ersten Schritt zu machen, fällt mir nach wie vor schwer. Aber jetzt hatte Juli ihn gemacht – und ich durfte mich dem zweiten widmen.
Als der Dämon, der die Gestalt einer fahrenden ZAUDAMOM hatte, neben dem Protagonisten im Bett lag und das Kinopublikum aufschrie, legte ich meinen Arm um ihre Schulter und ergriff ihre verwaiste Hand mit meiner anderen. Lange saßen wir so herrlich umschlungen da. Lange, sehr lange. Aber immer noch zu kurz.
Als der Film aus war, wollte sich Juli aus dem Schwitzkasten lösen, aber ich nutzte die Gunst der Stunde und drückte ihr einen Kuss auf die glänzenden Labello-Lippen.
„Uäh!“, war die zärtliche Erwiderung. „Sag mal, spinnst du jetzt komplett?!“ Hätte sie eine Hand freigehabt, hätte sie mich gewiss von sich gestoßen.
„Was ist denn?“, rief ich aus und das Herz sank mir in die Unterhose.
„Lass mich los!“, kreischte sie. Ich ließ sie los.
„Ich dachte,“ erwiderte ich und versuchte, ihren Groll durch ruhig gesetzte Worte zu besänftigen, „du würdest … das auch wollen.“
„Nein!“ – Julis Gesicht war puterrot vor Scham und Zorn. „Auf keinen Fall!“
Einige Leute waren stehengeblieben und begafften uns. Erst jetzt bemerkte ich, dass das Licht schon wieder an und der Kinosaal bereits zur Hälfte geleert war.
„Und wieso hast du dich dann an mich rangewanzt?“
„Ich habe mich nicht rangewanzt! Ich hab dir nur die Hand gegeben, weil ich mich gefürchtet habe!“
Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf stieg. Ich kann die Logik der Frauen einfach nicht begreifen. Sorry, liebe Leser*in!
„Und dass das mit mir irgendwas macht, kannst du dir wohl nicht ausrechnen?!“
„Aber, aber …“ – das erste Mal sah sie betroffen aus – „… ich dachte, wir beide wären Kumpel.“
Jetzt war ich es, der brüllte: „Am Arsch lecken könnt ihr mich alle mit eurer Dreckskumpelei!!“
Juli wollte aufstehen und davoneilen, aber sie stolperte über die Nachoschale, stürzte und landete halb auf meinem Knie, dass ihr Gesicht vor Salsa-Soße triefte.
Da behauptete irgendwer von den hinteren Plätzen, genau gesehen zu haben, dass ich sie geschlagen hätte. Ich bestritt das zwar sofort, aber die Tatsache, dass Julis Augen aufgrund der Soßenschärfe von Tränen ganz verquollen waren und sie, die Hände auf die scheinbar blutende Nase gelegt, davonrannte, ließ die übrigen Kinobesucher an meiner Glaubwürdigkeit zweifeln.
Zuletzt kam der Kinobetreiber höchstpersönlich angewackelt, notierte meinen Namen und meine Anschrift, sprach mir ein Hausverbot auf Lebenszeit aus und begleitete mich mit unsanfter Gewalt zum Hinterausgang.
Dort stand ich lange, unfähig zu begreifen, was gerade geschehen war. Es war einer der Momente, an denen man noch nicht traurig ist, aber genau weiß, dass man in wenigen Minuten sehr, sehr traurig sein wird.
„Haben sie dich auch rausgeworfen?“, fragte Cleo. Erst jetzt bemerkte ich, dass er neben mir in der Dunkelheit stand. Mit rollenden Augen betrachtete er meine rotumhüllten Beine.
„Oider, was machst du denn hier?“, sagte ich.
Seit der neunten Klasse oidern wir uns. Ich würde dich, bester Leser, aber bitten, uns deshalb in keine Schublade zu stecken. „Warst du etwa auch in dem Horrorfilm?“
„Nein“, zischte Cleo. „Das ist mir zu albern. Ich war in dem neuen Disney-Remake.“
„Diesem Sklavenfilm? Onkel Remus’ Wunderland?“
„Die Sklavenszenen wurden alle rausgeschnitten. Der Film dauert meines Wissens nur noch sechszehneinhalb Minuten.“
„Und wieso haben sie dich rausgeworfen?“
So angefressen hatte ich meinen Freund schon lange nicht mehr erlebt. Jedes seiner Worte trug Verbrennungen dritten Graden auf der Haut: „Ich hatte einige Nachrichten und Anrufe auf mein Handy gekriegt und das hat wohl den einen oder anderen gestört. Und das, obwohl klar suggeriert wurde, dass man sein Handy bis auf Weiteres anlassen darf.“
„Darf man nicht“, gab ich zurück. „Vor jeder Vorstellung wird darauf hingewiesen, dass man das Handy ausschalten muss.“
„Eben nicht!“, herrschte mich Cleo an, dass ich einen Herzkasper bekam. „Es stand da: Wir bitten Sie während der Vorstellung – Komma – Ihr Handy auszuschalten!“
„Sag ich doch“, erwiderte ich.
Cleo starrte mich an wie einen Sonderschüler. „Wir bitten Sie während der Vorstellung – KOMMA!! – Ihr Handy auszuschalten. Klingelt da was?“
„Nein.“
„Wenn das Komma an dieser Stelle steht, dann heißt das, dass irgendwann während der Vorstellung einige Leute kommen, die das Publikum dann bitten, das Handy auszuschalten, kapiert? Mir Hausverbot zu erteilen, nur weil mein Handy ununterbrochen geläutet hat, ist also völlig inakzeptabel.“
Ich würdigte Cleos Problem keines weiteren Wortes.
Ich ging heim.
Ich legte mich ins Bett, betrachtete die Sterne und fragte mich, warum die Götter so grausam zu mir waren. Und warum mich die Mädchen immer nur als Kumpel haben wollten.
Zefix nochmal, dachte ich und biss mir vor Zorn die Unterlippe blutig: Ich wollte noch nie Kumpel eines Mädchens sein. Wann immer ich in meiner Freizeit mit weiblichen Geschöpfen rumhänge, will ich auch was von ihnen. Und zwar immer!
Eine Ausnahme bilden da bloß meine Mutter und meine Oma Inge, sonst niemand. Genau genommen, nicht einmal meine Schwester, denn mit der würde ich niemals rumhängen.
Über dem Nachbarhaus erhob sich eben der Jupiter. Cleo hatte mir erklärt, welche Sterne welche sind und mich auch einmal gütig, exakt zwei Sekunden lang, durch sein Teleskop gucken lassen.
Ich betrachtete den gelben Planeten und erinnerte mich daran, dass Jupiter doch die lateinische Bezeichnung für Zeus ist. Und ich fragte mich, ob es am Ende der Göttervater selber war, der mich vom Weltall aus betrachtete. Um mein tristes Schicksal auszuspionieren.
Hatte ich gesagt, dass es läuft, lieber Leser? Hatte ich mich in irgendeiner Weise positiv über mein Dasein geäußert?
Ach, da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens gewesen. Bei mir läuft überhaupt nix! Ich bin ein hoffnungsloser Versager!
Nur ein einziges Mal in meinem Leben ist es mir gelungen, ein Mädchen, das ich liebte, als Freundin zu gewinnen. Und das war in der siebten Klasse. Eine Italienerin namens Dacia war das gewesen. Aber heute herrscht zwischen uns beiden Funkstille.
Es gibt zwar ein Mädchen, das in mich verknallt ist, eine gewisse Sophie, aber die mag ich nicht. Und es gibt ein paar Mädchen wie die Franzi und die Juli, die gerne was mit mir unternehmen. Aber die wollen mich nur als Kumpel haben. Das war’s.
„Wie hast du das nur gemacht?“, fragte ich den Göttervater, nachdem ich meine Tränen mithilfe des Kissens getrocknet hatte. „Wie hast du es nur geschafft, all diese Frauen rumzukriegen? Geht das nur, wenn man sich in Tiere verwandelt? Oder gibt’s da noch was andres zu beachten?“
Da flimmerte der Jupiter, das erste Mal in meinem Leben sah ich, wie er flimmerte. Und ich begriff, dass der Göttervater meine Frage mit diesem Flimmern beantwortet hatte. Es war wie ein Zwinkern seines Auges gewesen.
Dann kam die Gewissheit: Es gab tatsächlich eine Erkenntnis, die ich bloß noch nicht kannte. Eine Erkenntnis, mit der man die Metamorphose vom Kumpel- zum Gspusi-Stadium einläuten konnte.
Und es war nicht Selbstachtung oder innere Ausgeglichenheit oder irgendein anderer schwuler Quatsch.
Ich kenne sie nicht, lieber Leser. Aber es gibt sie und ich komme schon noch drauf.
Darauf kannst du Gift nehmen!
*
Auf dem Franz-Joseph-Strauß-Flughafen
Cleo blickte auf sein Handy. Sein Gesicht strahlte.
„Dieser Park muss irgendwo bei … Bialystok sein.“
„Wohl eher Bia-ystok“, verbesserte ich ihn. „Schau, das L ist ja durchgestrichen.“
„Vielleicht soll es auch Minus L bedeuten …“
„Eine Stadt für Laktose-Intolerante?“
Cleo betrachtete die Anzeigetafel. „Unser Zielflughafen ist auf jeden Fall Warschau.“
Apropos L: Unsere drei L-ternteile hatten wir bereits verabschiedet. Und zwar unter Aufbringung nuklearer Energie. Am liebsten hätten sie uns in den Flieger getragen, uns angeschnallt und unsere Gesichter mit Taschentüchern und Spucke aufgehübscht – aber wir machten ihnen klar, dass wir sie von Herzen lieben und Zeit unserer Jugend sicherlich noch als Chauffeure gebrauchen würden – sonst aber eher gar nicht mehr.
Wir wollten eben durch die Sicherheitskontrolle, als eine Nachricht auf meinem Handy aufleuchtete.
„Ach je, schon wieder die Franzi“, stöhnte ich. Die letzten Wochen hatte sie immer wieder mit der Reise angefangen. Und ich hatte ihr immer wieder erklärt, dass ich Herrn Grün bereits gefragt, aber noch keine Antwort erhalten hätte. Selbstverständlich in der Hoffnung, sie damit abwimmeln zu können. Aber sie gab keine Ruh, sie wollte unbedingt mitkommen und freute sich schon so sehr auf dieses endgeile Abenteuer – und ihren Fuß in der Amperblatt-Tür. Da hab ich mich dann doch gezwungen gesehen, ihr zu schreiben, dass Herr Grün zwar ihre Anwesenheit begrüßt hätte, aber leider kein Flugticket mehr zu organisieren war, weil komplett ausgebucht.
Das war eine Super-Notlüge.
Dachte ich.
Doch Franzi hatte – wie sie mir soeben schrieb – auf eigene Faust ein Flugticket erstanden und befand sich offenbar schon auf dem Flughafengelände.
„Sie will wissen,“ beendete ich meine Ausführung, „wo wir beide sind. Sie würde gern noch einen Kaffee mit uns trinken, bevor das Boarding losgeht.“
Cleo erwiderte nichts. Aber ich sah, wie in seinem linken Auge eine Ader platzte.
„Ich kann doch nichts dafür“, verteidigte ich mich.
„Wer dann?“, fragte Cleo, grauenerregend ruhig.
„Ich hatte gehofft, sie damit beeindrucken zu können. Ich dachte, sie würde sich irgendwie … revanchieren.“
Cleo gelang, was noch keinem Menschen vor ihm gelungen war. Er antwortete und knirschte zeitgleich mit den Zähnen. Noch ein zweites Wunder und seiner Heiligsprechung steht meines Erachtens nichts mehr im Wege.