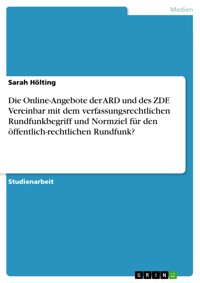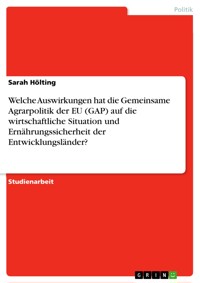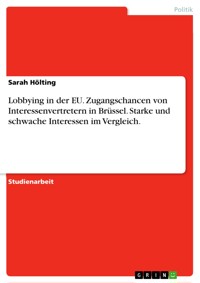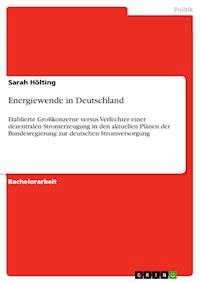
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Politisches System Deutschlands, Note: 1,3, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Auf den „verheerenden Atomunfall im japanischen Fukushima“ reagierte die deutsche Regierung prompt: Acht Atommeiler wurden abgeschaltet, bis 2022 sollen die verbleibenden neun Atomkraftwerke folgen. Künftig sollen die fehlenden Kapazitäten für die Stromproduktion jedoch verstärkt aus erneuerbaren Energien bezogen werden,und zwar „bis 2050 80 %“. Doch dieser beschleunigte Einsatz der Bundesregierung für die sogenannte „Energiewende“ spaltet die Köpfe. Besonders hitzige Diskussionen entfacht die Frage, wie das deutsche Stromversorgungsmanagement grundsätzlich gestaltet werden soll: zentral oder dezentral? Oder beides parallel? Die vorliegende Arbeit untersucht, für welchen Pfadweg sich die Regierung einsetzt und welche Interessengruppen sie mit ihren politischen Maßnahmen bisher unterstützt hat bzw. vermutlich auch in naher Zukunft weiter unterstützen wird. Überdies wird die Arbeit der Frage nachgehen, welchen Interessengruppen die Regierung besonders viel Mitspracherecht einräumt und nach möglichen Gründen für diese privilegierte Position suchen. Von Interesse werden außerdem die verschiedenen Argumente der unterschiedlichen Regierungsinstanzen, d.h. insbesondere der Ministerien, sein sowie die Widersprüche, in die sich die einzelnen Instanzen verstricken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Methodisches Vorgehen
3 Theoretischer Analyserahmen
3.1 Konkretisierung zentraler Begriffe : Interessen, Organisierte Interessen
3.2 Ansätze der Verbändeforschung: Einführung in die Thematik
3.3 Politikwissenschaftliche Einordnung von Interessengruppen: Vier Ansätze
3.3.1 Politikdimensionen der Politikfeldanalyse
3.4 INeo-) Pluralismus
3.5 Neokorporatismus
3.6 Paradigmenwechsel: Vom Korporatismus zum Lobbyismus?
3.7 Zwischenfazit
4 Typologisierung von Interessengruppen: Starke und schwache Interessen
4.1 Diffuser und spezieller Charakter
4.2 Allgemeine Strategien politischer Einflussnahme
4.3 Welche Strategie passt zu welcher Interessengruppe?
4.4 Kurzes Fazit: Organisationsfähigkeit und Zugangschancen
5 Einführung in die Problematik
5.1 Erneuerbare Energien (e.E.))
5.2 Konventionelle Energien (k.E.)
5.3 Stromversorgungssystem in Deutschland
5.3.1 Stromeinspeisung
5.3.2 Stromnetzbetreiber
5.3.3 Netzregelung
6 Energiekonzept 2010 und Energiepaket 2011
6.1 Ziel 1: Ausstieg aus der Kernenergie und Neubau k. Kraftwerke
6.1.1 Strategie 1: Marktintegration e.E./EEG und Marktprämie
6.1.2 Strategie 2: KapazitätsmechanismenJVersorgungssicherheitsverträge
6.1.3 Widersprüche im BMU: k. Kraftwerke vs. dezentrale Versorgung
6.1.4 Aktuelle Pläne zur Marktintegration: Pro k. Kraftwerke
6.1.5 Zwischenfazit
6.2 Ziel 2: Netzausbau
6.2.1 Strategie 3: Netzentwicklungsplan (NEP)
6.2.2 Kritik amNetzausbauplan
6.2.3 Verschärfung des Systemkonflikts durch den NEP 2012
6.2.4 Energieversorgungsunternehmen: Contra Dezentralität
6.2.5 Zwischenfazit
6.3 Ziel 3: Rekommunalisierung der Energieversorgung durch e.E.
6.3.1 Strategie 4: Unterstützung kommunaler Projekte durch die Regierung
6.3.2 Zwischenfazit
7 Fazit: Empirischer Teil und eigene Ansicht
8 Schlussfazit: Herstellung der Verbindung zum theoretischen Teil
Abkürzungsverzeichnis
Besondere Beg riffs Verwendungen
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
Auf den „verheerenden Atomunfall im japanischen Fukushima" (Spiegel.de, Link 1) reagierte die deutsche Regierung prompt: Acht Atommeiler wurden abgeschaltet, bis 2022 sollen die verbleibendenneun Atomkraftwerke folgen (Sueddeutsche.de, Link 1). Künftig sollen die fehlenden Kapazitäten für die Stromproduktion jedoch verstärkt aus erneuerbaren Energien bezogen werden, und zwar „bis 2050 (...) 80 %" (BMWi, 2012: 6).
2 Methodisches Vorgehen
Wie in der Einleitung erwähnt, möchte ich in der vorliegenden Arbeit herausarbeiten, welche Energie-Akteure gegenwärtig maßgeblich an den Entscheidungen zur Umstrukturierung des deutschen Energiesystems mitwirken und somit in Zukunft voraussichtlich die deutsche Stromversorgung beherrschen werden. Hauptaugenmerk liegt hier auf der potentiellen Durchsetzungskraft der folgenden zwei Akteursgruppen: Akteure, die eine dezentrale Stromversorgung aus e.E. anstreben (Ökostromanbieter, Umweltverbände, e.E.-Verbände, Ministerien, Kommunen, etc.) sowie Akteure, die eine zentrale Stromversorgung aus e.E. und/oder fossilen Energieträgern anstreben (vier etablierte Energieversorger E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW, Übertragungsnetzbetreiber, Ministerien, etc.).
Bevor ich im empirischen Teil versuchen möchte, eine realistische Einschätzung darüber zu erhalten, welche der o.g. Energie-Akteure derzeit stärkeren Einfluss auf den Energie-Kurs der Regierung nimmt, bedarf es zuvor einer Klärung der theoretischen und definitorischen Grundlagen. Ein theoretischer Analyserahmen ist notwendig, „da wissenschaftliche Beobachtung (...) immer theoriegeleitet ist, also immer von gewissen Annahmen und theoretischen Implikationen ausgeht, die der Analyse als Untersuchungsraster und Bezugspunkt dienen" (Schmedes, 2008: 51).
Da ich mich in meiner Arbeit mit der Interessenvermittlung auf nationaler Ebene beschäftige, werde ich verschiedene Theorien und Ansätze der Interessengruppenforschung als theoretische Grundlage heranziehen, wobei der Fokus auf der aktuellsten Theorie, dem Lobbyismus, liegen wird. Da der Lobbyismus eine Art Synthese aus Pluralismus und Korporatismus darstellt (Erklärung i.P. 3.6), sollen auch diesen beiden Theorien eigene, etwas knapper ausfallende Abschnitte gewidmet werden. Die Netzwerktheorie, die als Übergang vom Pluralismus und Korporatismus zum Lobbyismus begriffen werden kann, werde ich aussparen, da der Lobbyismus bereits die grundlegenden netzwerktheoretischen Ansätze beinhaltet und eine zu ausgiebige Beschäftigung mit allen Ansätzen generell die Seitenzahl der Arbeit sprengen würde. Auch die NPÖ sowie die Theorie der ,Kritischen Masse" sind für meine Arbeit weniger zielführend, da sie sich in zu geringem Maß mit der Makroebene (Staat-Verbände-Beziehung) befassen und die Meso- und Mikroebene lediglich i.F.v. theoretischen Szenarien ansprechen. Der Vorstellung der Ansätze wird die Erarbeitung eines grundlegenden Verständnisses von Politik auf Basis der Politikfeldanalyse sowie eine intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagenbegriffen „Interessen" und „Organisierte Interessen" vorausgehen. Anschließend werde ich auf die o.g. Ansätze und Theorien eingehen, wobei ich mich auf die Makro-Ebene, d.h. das „Verhältnis von Staat und Verbänden" (Schmid, 1998: 2) sowie auf die potentiellen Wege der Einflussnahme durch Interessengruppen konzentrieren werde. Auf die Mesoebene werde ich v.a. hinsichtlich der unterschiedlichen Vorstellungen über die Organisationsfähigkeit von Interessengruppen eingehen. Am Ende dieses Abschnittes werde ich in einem Fazit die für meine Themenstellung wichtigsten Aspekte der Ansätze zusammenfassen.[1]
Nach dem Fazit werde ich ein konkretes Verständnis von Interessengruppen erarbeiten, indem ich eine Klassifizierung von Interessengruppen in verschiedene Typen entwerfe (Typologisierung), die sich an den Theorien und Ansätzen der Interessengruppenforschung orientiert. Hieran wird sich eine Auseinandersetzung mit dem Einflussvermögen von Interessengruppen, das an ihren Zugangschancen zum politischen System ablesbar ist, anschließen. In diesem Zusammenhang wird es relevant sein, sich darüber hinaus mit den Strategien politischer Einflussnahme, die je nach Interessengruppentyp variieren, auseinanderzusetzen.
Mithilfe des Theorie-Teils, insbesondere der Typologisierung von Interessengruppen sowie deren theoretischen Zugangschancen und Einflussstrategien, möchte ich im Schlussfazit der Arbeit eine Antwort auf die Frage finden, warum bestimmte Typen von Interessengruppen aktuell mehr, andere weniger Einflussgewicht in der nationalen energiepolitischen Debatte haben, und ob die Annahmen der verschiedenen Theorien in der aktuellen energiepolitischen Debatte haltbar sind.[2]
Der Verknüpfung des theoretischen mit dem empirischen Teil im o.e. Schlussfazit wird der empirische Teil vorausgehen. Hier soll mithilfe von Gutachten, Studien, Informationsbroschüren, Analysen sowie Berichten und Artikeln herausgefunden werden, ob die Bundesregierung eher in die Richtung einer zentralen und/oder dezentralen Stromversorgungsmanagements tendiert, d.h. im Sinne welcher Akteursgruppe sie eher argumentiert. Auch hier werden vorab grundlegende Begriffe und Zusammenhänge geklärt, genauer werde ich die Begriffe erneuerbare Energien (e.E.) und konventionelle Energien (k.E.) definieren sowie das Stromversorgungssystem in Deutschland erläutern, um dann im Anschluss auf das Stromversorgungsprogramm der Regierung einzugehen. Darauf wird eine tiefgehende Erörterung der einzelnen politischen Maßnahmen und Vorhaben folgen, die mit Zwischenfazits unterbrochen wird.
3 Theoretischer Analyserahmen
3.1 Konkretisierung zentraler Begriffe : Interessen, Organisierte Interessen
Auf die politische Ebene gehoben, ist das Interesse nach Schubert/Klein in einer sehr umfassenden Definition als eine „Sammelbezeichnung für eine Vielfalt ökonomischer und sozialer Absichten und Forderungen, die von unterschiedlichen Gruppen und Organisationen an das politische System herangetragen werden" (2011: 147), zu verstehen. Eine engere Definition interpretiert Interesse als Nutzen, „d.h. als selbstbezogene oder egoistische Handlungsorientierung (self-interest), die auf Selbsterhaltung, die Erlangung von (materiellen) Vorteilen oder die relative oder absolute Verbesserung der eigenen Position in gegebenen sozialen Strukturen zielt" (Winter/Willems, 2007: 19). So wie jedes Individuum versuche nach Straßner auch jede Gruppe und Organisation über Durchsetzung seines Interesses Vorteile zu realisieren, oft gegen den Willen anderer, so dass das Interesse immer konfliktiven Charakters sei (2004: 17f). Da nach Alemann die politischen Forderungen und Handlungsorientierungen in beiden Definitionen (eng und umfassend) nicht ausreichend erfasst würden, differenziert er sie weiter aus: Der Antrieb, ein Interesse zu verfolgen, könne drei Gründe haben, die gleichzeitig die drei Dimensionen des Interessenbegriffes darstellen:
1. Interesse als individuelle Dimension: Der Antrieb, ein Interesse zu verfolgen, entspringt dem Wunsch, individuelle menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. (1987: 28)
2. Interesse als materielle Dimension: Der Antrieb, ein Interesse zu verfolgen, entspringt dem Wunsch, knappe materielle Güter, die über die „essentielle Basisversorgung hinausgehen" (Straßner, 2004: 18) zu erlangen bzw. Nutzen „angesichts von Knappheit und Mangel" (1987: 29) in der Interaktion mit anderen" (1987:28) zu erzielen oder zu vermehren.
3. Interesse als ideelle Dimension: Der Antrieb, ein Interesse zu verfolgen, entspringt dem Wunsch, Ideologien, d.h. eigene Vorstellungen oder Weltanschauungen wie Umweltschutz, zu artikulieren und zu rechtfertigen. Der Nutzen ist immaterieller Art. (1987: 28f)
Alemann hebt überdies das einfache Interesse vom Organisierten Interesse ab. Organisierte Interessen müssten verstanden werden als „freiwillig gebildete, soziale Einheiten mit bestimmten Zielen und arbeitsteiliger Gliederung (Organisation)" (1987: 30), die die individuellen, materiellen oder ideellen Interessen ihrer Mitglieder verfolgen. Dies tun sie „innerhalb der sozialen Einheit und/oder gegenüber anderen Gruppen, Organisationen und Institutionen" (1987: 30). Damit sind Organisierte Interessen auch als „intermediärer Raum" (Schmid, 1998: 16) zwischen einzelnen Individuen und „Institutionen des politischen und ökonomischen Systems" (Schmid, 1998: 16) zu begreifen, so dass dem Organisierten Interesse eine Vermittlerrolle zukommt.
Generell sei der Begriff Organisierte Interessen gleichbedeutend mit konkurrierenden Begriffen wie Interessenorganisationen und -gruppen, (Interessen-) Verbände oder Anglizismen wie „pressure group oder lobby" (Alemann, 1987: 29). (Alemann, 1987: 29ff). „Lobby" und „Pressure Group" sind sehr negativ konnotiert, da sie stark auf die einseitige Einwirkung über Druck hinweisen, ohne „die vielfältigen Wechselwirkungen und -beziehungen" (Triesch/Ockenfels, 1995: 15) zu berücksichtigen. Daher werde ich vorzugsweise den Begriff Interessengruppe bzw. Interest Group verwenden, womit ich mich Krafts Begründung anschließe, dass dieser Begriff „das vielfältige Spektrum der (...) Interessenvertretungen" (2006: 10) am besten wiedergibt und Verbände miteinschließt. Weiterhin ist Interessengruppe ein sehr neutraler Begriff, der sich nicht auf die politische Einflussnahme unter Ausübung von Druck beschränkt, sondern eine Art der Beeinflussung beschreibt, „die in irgendeiner Weise" (Kraft, 2006: 11) versucht wird. Hinsichtlich der Interessengruppenforschung, die sich primär mit der Beziehungsstruktur zwischen Staat und Verbänden und dem Einflussvermögen letzterer beschäftigt, folge ich Schmedes, der einzig Interessengruppen betrachtet, deren Hauptanliegen die Beeinflussung staatliche Entscheidungen ist (2008: 66), so dass Vereine wie Sportvereine herausfallen.
3.2 Ansätze der Verbändeforschung: Einführung in die Thematik