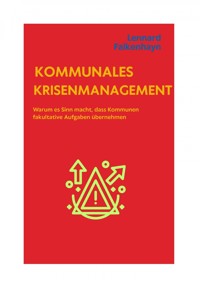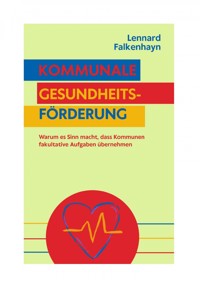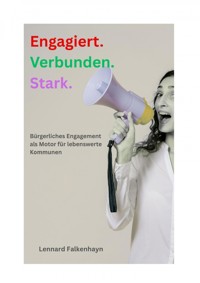
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bürgerliches Engagement in Kommunen Wie gemeinschaftliches Handeln Zukunft gestaltet – Wege, Chancen und Praxisbeispiele Bürgerschaftliches Engagement ist das Rückgrat lebendiger Kommunen. Dieses Buch zeigt, wie freiwilliges Mitwirken vor Ort mehr bewirken kann, als man oft denkt – von Nachbarschaftshilfe über Umweltprojekte bis hin zu digitaler Bürgerbeteiligung. Es beleuchtet, warum die Förderung dieses Engagements durch hauptamtliche Koordinatoren in Kommunen langfristig nachhaltige Wirkung entfaltet und warum sich Investitionen in Menschen und Gemeinschaften vielfach auszahlen. Ausführlich werden Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten und bewährte Praxisbeispiele vorgestellt, die den Weg zu erfolgreichem Engagement ebnen. Dabei spielt auch die Digitalisierung eine zentrale Rolle, ebenso wie die generationenübergreifende Zusammenarbeit und die Integration von Zugewanderten. Ein Plädoyer für eine stärkere Gemeinschaft, in der alle Bürgerinnen und Bürger Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Herausforderungen des demografischen Wandels, sozialer Ungleichheiten und globaler Krisen meistern. Ein unverzichtbarer Leitfaden für Kommunalpolitiker, hauptamtliche Mitarbeiter, Engagierte und alle, die sich für eine lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Engagiert. Verbunden. Stark.
Bürgerliches Engagement als Motor für
lebenswerte Kommunen
Lennard Falkenhayn
Impressum
Texte: © Copyright by Lennard Falkenhayn
Umschlaggestaltung: © Copyright by Carola Käpernick
Lennard Falkenhayn c/o C. Käpernick
Spitalstr. 38
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Hinweis zum Urheberrecht
Dieses EBook ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung des Inhalts – sei es ganz oder teilweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors untersagt. Dies gilt insbesondere für Kopien, Downloads, Weitergabe an Dritte oder die Nutzung in anderen Publikationen. Verstöße können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
Vorwort
Es war ein sonniger Samstagmorgen in einer kleinen Gemeinde, als eine Gruppe von Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkam, um den verwilderten Spielplatz im Ortskern wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Kinder und Familien zu verwandeln. Mit Werkzeugen, Farbe und viel Tatendrang machten sie sich ans Werk – ohne offizielle Einladung, ohne großen Plan, aber mit einer gemeinsamen Vision: den Ort lebenswerter zu gestalten. Was als spontane Initiative begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem nachhaltigen Projekt mit Unterstützung der Kommune, das nicht nur den Spielplatz, sondern das gesamte soziale Miteinander im Dorf bereicherte. Diese Geschichte steht beispielhaft für die Kraft des bürgerschaftlichen Engagements, das durch Eigeninitiative und gemeinsames Handeln Veränderungen bewirkt, die weit über das Offensichtliche hinausgehen.
Bürgerliches Engagement ist ein wesentlicher Pfeiler lebendiger und resilienter Gemeinschaften. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Herausforderungen vielfältiger und komplexer werden, gewinnt das freiwillige und eigenverantwortliche Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger in ihren Kommunen immer mehr an Bedeutung. Es handelt sich dabei um mehr als eine bloße Tätigkeit neben dem Beruf oder Alltag – es ist ein Ausdruck von Verbundenheit, Verantwortungsbewusstsein und dem Wunsch, die unmittelbare Lebenswelt aktiv mitzugestalten.
Die Kommunen bilden den Ort, an dem das Zusammenleben am unmittelbarsten erlebt wird. Sie sind somit der natürliche Rahmen für bürgerschaftliches Engagement, das dort am wirkungsvollsten sein kann. Doch um das Potential dieses Engagements voll auszuschöpfen, bedarf es einer gezielten Förderung, Koordination und professionellen Begleitung seitens der kommunalen Verwaltung und der politischen Entscheidungsträger. Die Investition in hauptamtliche Strukturen und koordinierende Anlaufstellen trägt maßgeblich dazu bei, Engagement zu bündeln, zu stärken und nachhaltig zu verankern.
Neben den klassischen Formen des Engagements eröffnen sich durch die fortschreitende Digitalisierung völlig neue Möglichkeiten. Digitale Plattformen, Apps und soziale Medien können als effektive Werkzeuge dienen, um Menschen zu vernetzen, Informationen zu verbreiten und Beteiligungsprozesse zu erleichtern. Gleichzeitig stellt die Digitalisierung neue Anforderungen an den Datenschutz, die digitale Inklusion und die Sicherstellung der Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen.
Dieses Buch beleuchtet die verschiedenen Facetten des bürgerschaftlichen Engagements in Kommunen – von den Beweggründen und Projekttypen über Fördermöglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zur Bedeutung der Digitalisierung. Es zeigt auf, wie durch strategische Planung, nachhaltige Unterstützung und innovative Ansätze das Engagement in der Kommune nicht nur gestärkt, sondern auch wirkungsvoll und zukunftsfähig gestaltet werden kann.
Langfristig betrachtet bringt die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement nicht nur einen immensen gesellschaftlichen Nutzen, sondern ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Sie führt zu sozialem Zusammenhalt, demokratischer Teilhabe und einer gesteigerten Lebensqualität vor Ort. Dies macht bürgerschaftliches Engagement zu einem unverzichtbaren Bestandteil einer modernen, lebendigen und nachhaltigen Kommunalentwicklung.
Einleitung
Bürgerschaftliches Engagement in Kommunen gewinnt angesichts gesellschaftlicher und demografischer Veränderungen immer mehr an Bedeutung. Dieses Buch beleuchtet umfassend, wie aktives Mitwirken und freiwilliges Engagement nicht nur das soziale Gefüge stärken, sondern auch ein zentraler Baustein für die Bewältigung drängender Herausforderungen in der kommunalen Entwicklung sind.
Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt viele Kommunen vor immense Aufgaben: Überalterung, schrumpfende Bevölkerungszahlen vor allem im ländlichen Raum und der damit verbundene Pflegenotstand sind Realität. Diese Probleme können nicht allein durch das Engagement von Ehrenamtlichen gelöst werden, doch gerade hier zeigt sich, wie wichtig eine „sorgende Gemeinschaft“ ist. Eine solche Gemeinschaft basiert auf dem Gedanken, dass Sorge füreinander nicht nur einseitig und professionell organisiert wird, sondern vielmehr auf gegenseitigem Geben und Nehmen beruht – getragen von einem solidarischen Miteinander, das unterschiedliche Generationen und soziale Gruppen verbindet.
Bürgerschaftliches Engagement fördert diese „sorgende Gemeinschaft“ nachhaltig, indem es soziale Netzwerke schafft, Hilfen koordiniert und Lebensqualität verbessert. Darüber hinaus trägt Engagement nachweislich positiv zur Gesundheit der Engagierten selbst bei. Es ermöglicht aktive Teilhabe und soziale Einbindung bis ins hohe Alter und wirkt so präventiv gegen Einsamkeit, Vereinsamung und gesundheitliche Beeinträchtigungen. In diesem Sinne ist Engagement ein wichtiger Baustein für gesundes Altern und stärkt die Resilienz ganzer Kommunen.
Das Buch ist so aufgebaut, dass es einen fundierten Überblick über die vielfältigen Facetten des bürgerschaftlichen Engagements bietet. Die ersten Kapitel erläutern die Grundlagen, erklären Begriffe und zeigen die Rolle der Kommune als Förderin und Koordinatorin des Engagements auf. Es folgen detaillierte Darstellungen zu Motivationen, Projektarten sowie Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Ebenso werden rechtliche Rahmenbedingungen und die Professionalisierung des Engagements thematisiert.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der systematischen Koordination durch hauptamtliche Stellen in der Kommune, die als zentrale Anlaufstellen für Engagierte fungieren. Hier wird gezeigt, wie nachhaltige Strukturen geschaffen werden können, die Engagement nicht nur unterstützen, sondern auch vernetzen und sichtbar machen.
Die Digitalisierung eröffnet neue Wege, Bürgerbeteiligung zu organisieren und Engagement zu fördern. Daher widmet sich ein eigenes Kapitel den Chancen und Herausforderungen digitaler Tools, dem Datenschutz und der digitalen Inklusion.
Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Kommunen illustrieren erfolgreiche Modelle und innovative Projekte, die Mut machen und als Inspiration dienen können. Abschließend wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben und Handlungsempfehlungen formuliert, um bürgerschaftliches Engagement langfristig zu stärken und wirksam in die kommunale Entwicklung zu integrieren.
Dieses Buch richtet sich an alle, die das Potenzial von Bürgerengagement erkennen und fördern möchten – von Verwaltungsfachleuten und politischen Entscheidungsträgern über hauptamtliche Koordinatoren bis hin zu engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Es soll dabei helfen, Engagement als unverzichtbare Ressource für lebenswerte, zukunftsfähige Kommunen zu verstehen und aktiv zu gestalten.
Kapitel 1: Einführung in das Bürgerliche Engagement Bürgerschaftliches Engagement ist das Fundament vieler lebendiger Gemeinschaften und ein Ausdruck demokratischer Teilhabe. Es steht für die freiwillige, eigenverantwortliche Beteiligung von Menschen am Gemeinwohl – ohne finanzielle Gegenleistung. Gerade in Kommunen, wo das direkte Miteinander und die lokalen Herausforderungen besonders spürbar sind, trägt bürgerschaftliches Engagement entscheidend zur Gestaltung des sozialen Lebens bei.
In einer Zeit, in der gesellschaftliche Veränderungen und der demografische Wandel viele Kommunen vor große Aufgaben stellen, gewinnt das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern eine noch größere Bedeutung. Es ermöglicht nicht nur praktische Hilfe, sondern schafft auch soziale Netzwerke und stärkt den Zusammenhalt. Dieses Kapitel legt die Basis für das Verständnis dieses wichtigen Themas und zeigt, welche Formen, Chancen und Herausforderungen bürgerschaftliches Engagement ausmachen.
1.1. Definition und Grundlagen
Bürgerschaftliches Engagement wird definiert als freiwillige, selbstbestimmte und unentgeltliche Tätigkeit, mit der Menschen ihre Zeit, Fähigkeiten und Ressourcen in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Es umfasst ein breites Spektrum von Aktivitäten – von Nachbarschaftshilfe, dem Mitwirken in Vereinen oder Initiativen, bis hin zu politischer Partizipation und kulturellen Beiträgen.
Ein prägnantes Zitat dazu stammt von Robert Putnam, einem bekannten Sozialwissenschaftler: "Engagement schafft soziale Bindungen, Vertrauen und gegenseitige Hilfe – das sind die Grundpfeiler jeder funktionierenden Gesellschaft."
Beispiel: Eine Frau, die regelmäßig für ihre älteren Nachbarn einkauft, oder eine Gruppe, die gemeinsam einen öffentlichen Park pflegt, zeigen, wie bürgerschaftliches Engagement ganz praktisch das Umfeld verbessert.
1.2 Historische Entwicklung in Deutschland
Das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert mit der Gründung von Vereinen und sozialen Bewegungen. Insbesondere die Arbeiterbewegung und kirchliche Initiativen förderten das ehrenamtliche Engagement als Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Engagement als Mittel zur Wiederherstellung demokratischer Strukturen genutzt. In den 1970er- und 1980er-Jahren kamen neue Formen, wie Umwelt- oder Frauenbewegungen hinzu, die das Verständnis von Engagement erweiterten.
Ein Beispiel aus der Geschichte ist die Gründung des Deutschen Roten Kreuzes oder der Caritas, die aus freiwilligen Initiativen entstanden sind und heute wichtige soziale Träger darstellen.
1.3 Bedeutung für die Gesellschaft
Bürgerschaftliches Engagement trägt wesentlich zum sozialen Zusammenhalt bei und fördert demokratische Werte. Es schafft Räume für Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung. Dabei profitieren nicht nur die Hilfsbedürftigen, sondern auch die Engagierten selbst – durch soziale Anerkennung, Zugehörigkeit und persönliche Entwicklung.
Wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte:
"Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht durch Menschen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und miteinander gestalten."
Beispiel: Nachbarschaftsnetzwerke, die sich in Zeiten von Krisen – wie der Corona-Pandemie – gegenseitig unterstützen, zeigen die Bedeutung von Engagement für den Erhalt sozialer Strukturen.
1.4 Bürgerliches Engagement vs. Ehrenamt
Während das Ehrenamt häufig als organisierte und formalisierte Tätigkeit verstanden wird, ist das bürgerschaftliche Engagement weiter gefasst. Es schließt auch informelle und spontane Aktivitäten ein, die nicht an eine Organisation gebunden sind.
Beispiel: Eine Person, die sich in einem Sportverein als Trainer engagiert, übt ein Ehrenamt aus. Dagegen zählt das gelegentliche Organisieren eines Straßenfestes oder die spontane Unterstützung einer Geflüchtetenfamilie zum bürgerschaftlichen Engagement.
Der Deutsche Freiwilligensurvey definiert Engagement deshalb bewusst weit: "Es umfasst alle freiwilligen Aktivitäten, die darauf abzielen, das Gemeinwohl zu fördern, unabhängig von Dauer, Organisation oder Formalisierung."
1.5 Formen des Engagements
Die Vielfalt des Engagements ist enorm. Es reicht von der Mithilfe in sozialen Einrichtungen, kulturellen Veranstaltungen, Umwelt- und Naturschutzprojekten, Bildungsinitiativen bis hin zur politischen Partizipation. Auch neue digitale Formen wie Online-Petitionen oder Nachbarschafts-Apps gewinnen an Bedeutung.
Ein praktisches Beispiel: In vielen Städten haben sich Bürgergruppen gegründet, die lokale Grünflächen pflegen oder Nachbarschaftshilfen via Apps organisieren. Das Projekt „Nachbarschaftshilfe digital“ in Berlin etwa verbindet Menschen, die Unterstützung suchen, mit Freiwilligen in der Nähe.
1.6 Herausforderungen und Chancen
Zeitmangel, Überforderung, fehlende Anerkennung und unzureichende Unterstützung gehören zu den häufigsten Hindernissen für Engagement. Viele Engagierte fühlen sich durch Bürokratie oder mangelnde Wertschätzung entmutigt. Gleichzeitig eröffnen sich durch Digitalisierung, neue Beteiligungsformen und den demografischen Wandel Chancen, mehr Menschen zu erreichen und unterschiedliche Zielgruppen einzubinden.
Zitat von Elinor Ostrom, Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften: "Die Fähigkeit von Gemeinschaften, sich selbst zu organisieren und gemeinsam Ressourcen zu nutzen, ist eine der wichtigsten Quellen nachhaltigen Engagements."
1.7 Aktuelle Trends und Entwicklungen
Bürgerschaftliches Engagement entwickelt sich stetig weiter und passt sich den gesellschaftlichen Veränderungen sowie neuen technologischen Möglichkeiten an. In den letzten Jahren lassen sich besonders zwei bedeutsame Trends beobachten: die Digitalisierung des Engagements und die verstärkte Bedeutung von niedrigschwelligen, lokalen Begegnungsangeboten wie Quartiertreffs.
Digitale Plattformen und soziale Medien eröffnen neue Wege für Engagement: Sie ermöglichen eine einfache Vernetzung, Informationsweitergabe und Koordination von Aktivitäten. Dadurch können Menschen schneller und unkomplizierter zusammenfinden – unabhängig von Zeit und Raum. Projekte wie Online-Nachbarschaftshilfen oder digitale Freiwilligenbörsen verzeichnen zunehmende Nachfrage. Gleichzeitig bringt die Digitalisierung aber auch Herausforderungen mit sich, etwa hinsichtlich Datenschutz, digitaler Kompetenz und der Gefahr, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen – insbesondere ältere Menschen – ausgegrenzt werden.
Parallel dazu wächst das Interesse an analogen, lokal verankerten Begegnungs- und Unterstützungsformen. Quartiertreffs sind hier ein hervorragendes Beispiel. Sie bieten Menschen jeden Alters einen niederschwelligen Ort der Begegnung und des Austauschs im unmittelbaren Wohnumfeld. Wichtig ist, dass sie sich an unterschiedliche Zielgruppen richten und dabei verschiedene Bedürfnisse bedienen.
So etablieren sich etwa Elterntreffs, in denen junge Familien zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsame Aktivitäten zu organisieren. Diese Treffpunkte fördern die soziale Vernetzung in einer Lebensphase, die oft mit Isolation und Stress verbunden ist.
Für ältere Menschen sind Seniorenstammtische ein bewährtes Format, um Einsamkeit vorzubeugen, Gemeinschaft zu erleben und aktuelle Themen zu besprechen. Hier werden neben geselligem Beisammensein auch praktische Hilfen organisiert, beispielsweise Begleitung zu Arztbesuchen oder Einkaufshilfen.
Ein weiteres Beispiel sind Smartphone- und Computerkurse in Quartiertreffs, die speziell auf ältere Menschen zugeschnitten sind. Sie helfen dabei, digitale Kompetenzen zu erweitern, den Zugang zu digitalen Informationen und Angeboten zu erleichtern und so digitale Teilhabe zu fördern. Durch diese Maßnahmen wird verhindert, dass ältere Menschen im Zuge der Digitalisierung abgehängt werden.
Solche Quartiertreffs fungieren nicht nur als Orte der Begegnung, sondern auch als Knotenpunkte für bürgerschaftliches Engagement. Sie ermöglichen es, Freiwillige für verschiedene Aufgaben zu gewinnen, Engagement zu koordinieren und lokale Projekte zu initiieren. Dabei profitieren alle Beteiligten: Engagierte finden Anerkennung und Sinn, Hilfesuchende erhalten Unterstützung und die Kommune gewinnt an sozialer Stabilität.
Neben der zunehmenden Diversifizierung der Zielgruppen und Angebote lässt sich auch ein Trend zu flexiblen Engagementformen beobachten. Berufstätige, Eltern oder Studierende haben oft wenig Zeit, sich langfristig und regelmäßig zu binden. Flexible, projektbezogene oder digitale Engagementmöglichkeiten bieten hier Lösungen, die sich besser an individuelle Lebenssituationen anpassen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aktuelle Entwicklungen im bürgerschaftlichen Engagement von einer Mischung aus traditionellen, analogen Formen wie Quartiertreffs und innovativen, digitalen Beteiligungsangeboten geprägt sind. Diese Vielfalt eröffnet neue Chancen, um möglichst viele Menschen zur Mitgestaltung ihrer Kommune zu motivieren und eine lebendige, resiliente Gemeinschaft zu fördern.
Kapitel 2: Die Rolle der Kommune im bürgerschaftlichen Engagement Die Kommune spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, bürgerschaftliches Engagement zu fördern, zu koordinieren und nachhaltig zu verankern. Kommunale Verwaltungen und politische Gremien sind häufig die ersten Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren möchten. Zugleich stehen sie vor der Herausforderung, vielfältige Interessen, Ressourcen und Bedarfe zu bündeln, um gemeinschaftliches Engagement effektiv zu unterstützen.
Bürgerschaftliches Engagement gelingt dort am besten, wo Kommunen klare Strukturen, Unterstützungsmöglichkeiten und eine wertschätzende Haltung gegenüber den Engagierten schaffen. Dies umfasst sowohl die Bereitstellung von Ressourcen wie Räumen und Fördermitteln als auch die Entwicklung von Rahmenbedingungen, die freiwilliges Engagement erleichtern und sichtbar machen.
2.1 Kommunale Verantwortung und Engagementförderung Kommunen tragen eine besondere Verantwortung, ein Umfeld zu schaffen, in dem bürgerschaftliches Engagement gedeihen kann. Sie sind als politische und administrative Akteure zugleich Initiator, Partner und Förderer. Diese Rolle beinhaltet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Engagement erleichtern – beispielsweise durch rechtliche Klarheit, Beratungsangebote oder finanzielle Unterstützung.