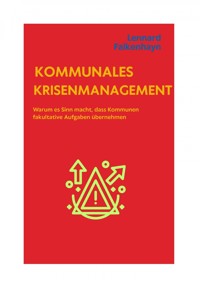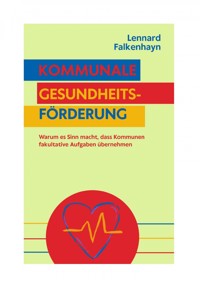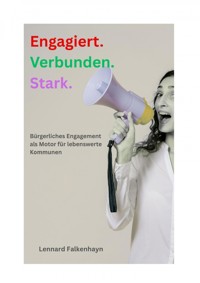Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kommunale Einnahmen rechtssicher gestalten – Ein Handbuch für Verwaltung und Politik Wie kann eine Kommune ihre Einnahmen sichern, ausbauen und zugleich rechtlich unangreifbar gestalten? Dieses umfassende Handbuch bietet eine systematische Darstellung der klassischen und modernen Einnahmequellen deutscher Kommunen – von Steuern, Gebühren und Beiträgen über Zuweisungen und wirtschaftliche Betätigungen bis hin zu innovativen Finanzierungsmodellen wie Crowdfunding, Sponsoring und digitalen Erlösstrategien. Auf Grundlage aktueller Gesetze, Urteile und Verwaltungspraxis zeigt dieses E-Book, wie neue Einnahmen rechtssicher eingeführt, kalkuliert und politisch vermittelt werden können. Konkrete Beispiele, Mustersatzungen und Hinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung machen das Werk zu einem praxisnahen Begleiter für Kommunalverwaltungen, Ratsmitglieder, Kämmereien und kommunale Berater. Mit einem Blick in die Zukunft wird deutlich: Kommunen haben Spielräume – wenn sie sie verantwortungsvoll und rechtskonform nutzen. Ein unentbehrlicher Leitfaden für alle, die an der finanziellen Handlungsfähigkeit ihrer Kommune arbeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kommunale Einnahmen neu denkenZwischen Pflichtaufgaben, Innovation und Rechtssicherheit
Lennard Falkenhayn
Impressum
Texte: © Copyright by Lennard Falkenhayn
Umschlaggestaltung: © Copyright by Carola Käpernick
Lennard Falkenhayn c/o C. Käpernick
Spitalstr. 38
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Hinweis zum Urheberrecht
Dieses EBook ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung des Inhalts – sei es ganz oder teilweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors untersagt. Dies gilt insbesondere für Kopien, Downloads, Weitergabe an Dritte oder die Nutzung in anderen Publikationen. Verstöße können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
Einleitung
Die Finanzierung kommunaler Aufgaben zählt zu den zentralen Herausforderungen moderner Verwaltungspraxis. Kommunen sind in Deutschland Träger der öffentlichen Selbstverwaltung und damit verpflichtet, eine Vielzahl öffentlicher Leistungen zu erbringen. Diese reichen von der Daseinsvorsorge über Bildungseinrichtungen bis hin zur lokalen Infrastruktur. Eine solide Einnahmebasis bildet die unerlässliche Grundlage für die Erfüllung dieser Aufgaben. Die Frage, wie eine Kommune ihre Einnahmen rechtssicher, planbar und gleichzeitig bürgernah gestaltet, ist daher von strategischer Bedeutung.
Die kommunale Finanzverfassung in Deutschland basiert auf dem Grundsatz der Finanzautonomie der Gemeinden, verankert in Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG. Danach steht den Gemeinden das Recht zu, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“. Dies schließt das Recht ein, Einnahmen zu erheben – insbesondere durch Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte. Die tatsächliche Ausgestaltung dieser Einnahmearten unterliegt jedoch einer Vielzahl rechtlicher Rahmenbedingungen, die durch Landesgesetze, Bundesgesetze sowie die kommunale Satzungshoheit konkretisiert werden.
Angesichts zunehmender Aufgabenlasten und gleichzeitig stagnierender oder rückläufiger Schlüsselzuweisungen sehen sich viele Kommunen gezwungen, neue oder bislang ungenutzte Einnahmequellen zu erschließen. Diese Entwicklung wird nicht selten von rechtlichen Unsicherheiten begleitet, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit neuer Abgaben mit der bestehenden Gesetzes- und Rechtsprechungslage. Zahlreiche gerichtliche Entscheidungen – etwa zur Zulässigkeit der Zweitwohnungssteuer (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.02.2005 – 10 C 10.04) oder zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen – zeigen die juristische Komplexität kommunaler Abgabenpolitik auf.
Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus dem Erfordernis politischer Akzeptanz. Einnahmeentscheidungen stehen regelmäßig unter dem Eindruck öffentlicher Kritik, was vor allem bei der Einführung neuer Gebühren und Steuern zu beobachten ist. Gleichzeitig dürfen Kommunen die rechtlich gebotenen Verfahren – insbesondere die ordnungsgemäße Kalkulation von Gebühren oder die sachliche Begründung neuer Aufwandsteuern – nicht vernachlässigen. Eine saubere rechtliche Herleitung und ein transparentes Verwaltungsverfahren dienen dabei nicht nur der formellen Rechtssicherheit, sondern auch dem Vertrauen in kommunalpolitische Entscheidungen.
Ziel dieses E-Books ist es, die rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen kommunaler Einnahmeerhebung systematisch darzustellen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über die klassischen Einnahmequellen sowie über neue und innovative Möglichkeiten zur Haushaltsstärkung. Besonderer Fokus liegt auf der rechtssicheren Ausgestaltung von Abgaben und den damit verbundenen formellen Anforderungen. Dieses Werk versteht sich als praxisnahes Nachschlagewerk für kommunale Entscheidungsträger, Verwaltungsfachkräfte sowie beratende Gremien im Bereich Kommunalfinanzen und -recht. Teil I – Grundlagen der kommunalen Einnahmen Die Finanzierung kommunaler Aufgaben setzt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen und strukturellen Grundlagen kommunaler Einnahmen voraus. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Thema der Finanzwirtschaft, sondern vor allem auch um ein Thema des öffentlichen Rechts. Die Regelung der Einnahmen ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, deren Grenzen und Möglichkeiten im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland präzise normiert sind. Die Einnahmenseite des kommunalen Haushalts bildet die Grundlage dafür, dass Kommunen ihre gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllen können.
Die Einnahmequellen stehen nicht isoliert, sondern sind Teil eines umfassenden Systems, das sich aus verfassungsrechtlichen Vorgaben, einfachgesetzlichen Bestimmungen und verwaltungspraktischen Erfordernissen zusammensetzt. Dabei spielt die Finanzverfassung des Grundgesetzes eine maßgebliche Rolle, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Ergänzend treten die Kommunalabgabengesetze der Länder hinzu, welche die konkrete Ausgestaltung der Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen auf kommunaler Ebene regeln.
Kommunale Einnahmen lassen sich systematisch in verschiedene Kategorien einteilen: Steuern, Gebühren, Beiträge, Zuweisungen, Umlagen sowie sonstige Einnahmen. Diese Klassifikation dient nicht nur der Haushaltsklarheit, sondern hat auch tiefgreifende rechtliche Konsequenzen. So unterliegt beispielsweise die Erhebung von Gebühren dem sogenannten Äquivalenzprinzip, während Steuern keine unmittelbare Gegenleistung voraussetzen dürfen. Beiträge wiederum setzen einen individuellen Vorteil des Abgabepflichtigen durch eine konkrete Maßnahme der Kommune voraus. Die Rechtsnatur und Zweckbindung dieser Einnahmearten sind grundlegend verschieden.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die kommunale Einnahmeerhebung grundsätzlich dem Vorbehalt des Gesetzes unterliegt. Jede Form der Abgabenerhebung muss daher auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, sei es durch Bundesrecht, Landesrecht oder im Rahmen der kommunalen Satzungshoheit. Die Gemeinden verfügen innerhalb dieses Rahmens über einen Gestaltungsspielraum, der jedoch von der kommunalen Rechtsaufsicht überwacht wird. Die Ausübung dieses Ermessens bedarf sorgfältiger juristischer Prüfung, um Rechtsstreitigkeiten und Beanstandungen durch Aufsichtsbehörden zu vermeiden.
Die folgenden Kapitel dieses Teils widmen sich zunächst dem verfassungsrechtlichen Fundament der kommunalen Finanzhoheit, sodann den landesrechtlichen Vorgaben durch die Kommunalabgabengesetze und schließlich der verfassungsrechtlich garantierten, jedoch in der Praxis eingeschränkten Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden im Spannungsfeld mit der Landesaufsicht. Dieses Fundament bildet die unverzichtbare Grundlage für jede rechtssichere kommunale Einnahmepolitik.
Verfassungsrechtlicher Rahmen: Artikel 28 GG und Finanzverfassung Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland garantiert in Art. 28 Abs. 2 GG das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden. Dieses umfasst das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Dazu zählt ausdrücklich auch die Finanzhoheit als Teilbereich der kommunalen Selbstverwaltung. Die Finanzverfassung ist jedoch nicht isoliert zu betrachten, sondern in den Gesamtkontext des Grundgesetzes eingebettet, insbesondere in die föderale Kompetenzordnung sowie in die Art. 104a ff. GG, welche die Verteilung von Einnahmen und Ausgaben zwischen Bund, Ländern und Kommunen regeln.
Art. 106 GG enthält die maßgeblichen Bestimmungen zur Verteilung der Steuererträge zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Den Gemeinden stehen danach insbesondere Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu sowie das Aufkommen aus örtlichen Steuern, zu denen die Gewerbesteuer und die Grundsteuer zählen. Diese Regelung bildet die Basis für die steuerliche Einnahmeautonomie der Kommunen. Zugleich unterliegt diese Autonomie gewissen Einschränkungen: Die Einführung neuer kommunaler Steuern ist nur in dem Maße zulässig, wie sie nicht mit gleichartigen Bundessteuern kollidiert (vgl. Art. 105 GG, sog. Steuerfindungsrecht).
Neben der Einnahmenverteilung behandelt die Finanzverfassung auch Fragen der Finanzverantwortung. Nach Art. 104a GG trägt grundsätzlich jede Ebene ihre eigenen Ausgaben. Kommunen haben daher die Pflicht, ihre Aufgaben im Rahmen eigener Einnahmen zu finanzieren. Diese Grundregel wird ergänzt durch den kommunalen Finanzausgleich, der auf Landesebene durchgeführt wird und zur Aufgabe hat, finanzielle Unterschiede zwischen wirtschaftsstarken und finanzschwachen Kommunen auszugleichen. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit solcher Ausgleichsmechanismen wurde u. a. durch das BVerfG im Rahmen mehrerer Entscheidungen bestätigt (vgl. z. B. BVerfG, Beschl. v. 04.05.2021 – 2 BvF 1/20).
Ein zentrales Prinzip der kommunalen Finanzverfassung ist die sogenannte Konnexitätsregel („Wer bestellt, bezahlt“), die in verschiedenen Landesverfassungen verankert ist und durch Art. 104a Abs. 1 GG gestützt wird. Dieses Prinzip verpflichtet Länder dazu, den Kommunen die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn sie ihnen neue Aufgaben übertragen. In der Praxis ist die Durchsetzung dieses Prinzips jedoch oft mit rechtlichen Auseinandersetzungen verbunden, etwa über die Frage, ob eine neue Aufgabe tatsächlich als „übertragen“ im Sinne des Konnexitätsprinzips zu werten ist.
Insgesamt schafft die Finanzverfassung des Grundgesetzes die rechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Kommunen ihre Einnahmepolitik gestalten können. Sie garantiert ihnen einerseits einen eigenständigen finanziellen Spielraum, begrenzt diesen aber andererseits durch die bundesstaatliche Ordnung und die Aufsicht durch die Länder. Jede kommunale Einnahmeentscheidung muss sich daher im Spannungsfeld von Selbstverwaltung und übergeordneter Finanzverfassung verorten.
Kommunalabgabengesetze der Länder
Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung kommunaler Abgaben wird in Deutschland maßgeblich durch die Kommunalabgabengesetze (KAG) der einzelnen Bundesländer bestimmt. Diese Landesgesetze konkretisieren die Vorgaben des Grundgesetzes sowie der Landesverfassungen hinsichtlich der Ausgestaltung kommunaler Abgabenerhebung. Sie regeln insbesondere die Voraussetzungen und Verfahren zur Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen auf kommunaler Ebene. Trotz ihrer föderalen Ausprägung enthalten die KAGs weitgehend übereinstimmende Grundstrukturen.
Ein zentraler Inhalt aller Kommunalabgabengesetze ist die Ermächtigung zur Erhebung von Abgaben durch kommunale Satzung. Die gesetzliche Grundlage im KAG ist erforderlich, da die Abgabenerhebung einen Eingriff in das Eigentum darstellt (Art. 14 GG) und damit dem Vorbehalt des Gesetzes unterliegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Pflicht zur gesetzlichen Grundlage in ständiger Rechtsprechung bekräftigt (vgl. BVerwG, Urt. v. 26.04.1988 – 8 C 98.86). Nur auf Basis einer wirksamen Satzung ist die Abgabenerhebung zulässig.
Die KAGs enthalten zudem Regelungen zu den einzelnen Abgabearten. Während Steuern ohne Gegenleistung erhoben werden, setzen Gebühren eine konkrete Verwaltungs- oder Benutzungsleistung voraus. Beiträge wiederum knüpfen an die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Vorteils durch eine öffentliche Maßnahme an. Für jede Abgabeart gelten besondere Voraussetzungen hinsichtlich Bemessungsgrundlage, Entstehungstatbestand und Abgabepflicht. Die Kommunen müssen diese differenzierten Anforderungen beachten, wenn sie entsprechende Abgabesatzungen erlassen.
Ein weiterer zentraler Regelungskomplex betrifft die Gebührenkalkulation. Die meisten KAGs verlangen, dass Gebühren kostendeckend, aber nicht kostendeckend übersteigend erhoben werden dürfen (sog. Kostenüberschreitungsverbot). Grundlage hierfür ist das Äquivalenzprinzip, wonach Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen müssen. Fehler bei der Gebührenkalkulation führen regelmäßig zur Nichtigkeit der Satzung oder zu Rückforderungsansprüchen. Zahlreiche gerichtliche Entscheidungen beschäftigen sich mit der Plausibilität und Transparenz kommunaler Kalkulationen (vgl. z. B. OVG NRW, Urt. v. 23.11.2017 – 9 A 1624/15).
Die Kommunalabgabengesetze stellen damit das zentrale gesetzliche Fundament für die rechtssichere Einnahmepolitik der Kommunen dar. Ohne Beachtung der dort niedergelegten Vorgaben ist weder die Einführung neuer Einnahmequellen noch die Änderung bestehender Regelungen rechtlich zulässig. Die KAGs konkretisieren zudem das verfassungsrechtlich verbürgte Selbstverwaltungsrecht und schaffen Rechtssicherheit im Vollzug kommunaler Abgabenentscheidungen.
Kommunale Selbstverwaltung vs. Landesaufsicht
Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist ein tragendes Strukturprinzip des Grundgesetzes (Art. 28 Abs. 2 GG). Dieses Recht sichert den Gemeinden eine eigenverantwortliche Gestaltung ihrer Angelegenheiten zu, insbesondere auch im Bereich der Finanzhoheit. In der Praxis ist diese Selbstverwaltungsbefugnis jedoch nicht schrankenlos, sondern steht unter dem Vorbehalt der Gesetze. Eine dieser Schranken ist die Kommunalaufsicht durch die Länder, die auf Grundlage der jeweiligen Kommunalverfassungen und Landesverwaltungsverfahrensgesetze ausgeübt wird.
Die Kommunalaufsicht dient der Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit kommunalen Handelns. Sie unterscheidet zwischen Fachaufsicht und Rechtsaufsicht. Während die Fachaufsicht bei delegierten Aufgaben des Landes eingreift, ist bei eigenen Aufgaben der Kommune regelmäßig nur eine reine Rechtsaufsicht zulässig. Im Bereich der Einnahmeerhebung bedeutet dies, dass die Landesbehörden insbesondere die Vereinbarkeit von Satzungen mit dem KAG und anderen Vorschriften überprüfen können. Die Aufsichtsbehörde ist dabei nicht berechtigt, eigene finanzpolitische Vorstellungen durchzusetzen, sondern darf lediglich die Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns kontrollieren (vgl. BVerwG, Urt. v. 28.04.1999 – 8 C 13.98).
Die Selbstverwaltungsfreiheit der Kommune kollidiert in der Praxis häufig mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben der Aufsicht. Dies ist insbesondere bei genehmigungspflichtigen Haushaltssatzungen, Kassenkrediten oder bei Sanierungsfällen der Fall. In solchen Konstellationen kommt es regelmäßig zu Konflikten zwischen kommunalen Entscheidungsträgern und der Kommunalaufsicht. Gleichwohl bleibt die Kompetenz zur Einnahmenerhebung bei der Gemeinde, solange sie nicht gegen höherrangiges Recht verstößt.