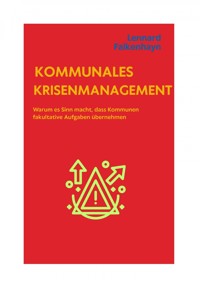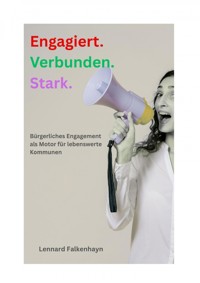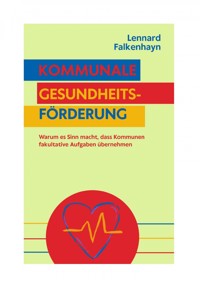
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gesundheit in kommunaler Verantwortung – Strategien für eine resiliente Zukunft Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit – sie ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Stabilität und soziale Gerechtigkeit. Dieses E-Book zeigt praxisnah und fundiert, wie Kommunen ihre Rolle in der Gesundheitsförderung aktiv gestalten können: als Gestalterinnen gesunder Lebensverhältnisse, als Koordinatorinnen von Netzwerken und als Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Auf Basis aktueller Forschung, bewährter Praxisbeispiele und strategischer Empfehlungen bietet das Buch einen systematischen Leitfaden zur Planung, Umsetzung und Verstetigung kommunaler Gesundheitsförderung. Neben zentralen Themen wie Prävention, Teilhabe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden auch Finanzierung, Qualitätssicherung und die Rolle politischer Steuerung umfassend behandelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Umsetzbarkeit in unterschiedlichen kommunalen Kontexten – von kleinen Landgemeinden bis hin zu Großstädten – sowie auf dem Zukunftskompass Gesundheit als Orientierungsmodell für die strategische Weiterentwicklung vor Ort. Ein unverzichtbares Werk für Fachkräfte in Verwaltung, Gesundheitswesen, Sozialplanung und kommunaler Politik – und für alle, die Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kommunale Gesundheitsförderung
Warum es Sinn macht, dass Kommunen fakultative
Aufgaben übernehmen
Lennard Falkenhayn
Impressum
Texte: © Copyright by Lennard Falkenhayn
Umschlaggestaltung: © Copyright by Carola Käpernick
Lennard Falkenhayn c/o C. Käpernick
Spitalstr. 38
79359 Riegel am Kaiserstuhl
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Hinweis zum Urheberrecht
Dieses EBook ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung oder Bearbeitung des Inhalts – sei es ganz oder teilweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Autors untersagt. Dies gilt insbesondere für Kopien, Downloads, Weitergabe an Dritte oder die Nutzung in anderen Publikationen. Verstöße können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
Vorwort
Gesundheit ist weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie ist ein grundlegender Bestandteil individueller Lebensqualität und sozialer Teilhabe – und sie entsteht dort, wo Menschen leben, lernen, arbeiten und alt werden: in der Kommune. Städte, Gemeinden und Landkreise sind zentrale Gestaltungsräume für gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse. In ihnen bündeln sich soziale, politische, ökologische und ökonomische Einflussfaktoren, die die gesundheitliche Lage von Bevölkerungsgruppen maßgeblich prägen.
In den vergangenen Jahren hat sich die kommunale Gesundheitsförderung zunehmend als eigenständiges Handlungsfeld etabliert. Gesetzliche Rahmenbedingungen, wie das Präventionsgesetz, und gesundheitswissenschaftliche Konzepte, wie der Setting-Ansatz oder “Health in all Policies”, haben dazu beigetragen, Gesundheitsförderung als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe zu verstehen. Dabei geht es nicht nur um Programme oder Einzelmaßnahmen, sondern um die systematische Verankerung gesundheitsförderlicher Strukturen in den kommunalen Alltag.
Dieses Buch stellt die kommunale Gesundheitsförderung in ihrer ganzen Vielfalt dar – von ihren Grundlagen über zentrale Handlungsfelder bis hin zu bewährten Praxisbeispielen und zukunftsweisenden Strategien. Es zeigt, wie kommunale Akteurinnen und Akteure mit geeigneten Methoden, Kooperationen und Strategien Einfluss auf die Gesundheit vor Ort nehmen können – sei es in Bildungseinrichtungen, im öffentlichen Raum, in Quartieren oder im digitalen Raum.
Ziel ist es, ein praxisnahes, aber zugleich fachlich fundiertes Nachschlagewerk zu bieten, das zur Orientierung, Reflexion und Weiterentwicklung kommunaler Gesundheitsaktivitäten beiträgt. Die Verbindung von theoretischem Hintergrund, methodischem Werkzeug und Best-Practice-Erfahrungen ermöglicht eine strukturierte Auseinandersetzung mit der Frage, wie Gesundheit vor Ort gestaltet und nachhaltig gefördert werden kann – heute und in Zukunft.
Kapitel 1: Grundlagen der kommunalen Gesundheitsförderung Gesundheit ist ein grundlegender Faktor gesellschaftlicher Entwicklung. Sie beeinflusst Bildungschancen, Erwerbsfähigkeit, soziale Teilhabe und Lebensqualität – und wird gleichzeitig durch politische, soziale, ökologische und wirtschaftliche Bedingungen geprägt. Insbesondere die lokale Ebene – die Kommune – spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hier wirken vielfältige Einflussfaktoren zusammen, die Gesundheit begünstigen oder beeinträchtigen können: Wohnverhältnisse, Mobilitätsangebote, Bildungsinfrastruktur, soziale Netzwerke, Umweltbedingungen und vieles mehr.
Die kommunale Gesundheitsförderung setzt genau an diesen Bedingungen an. Sie zielt darauf ab, die gesundheitlichen Chancen aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern, strukturelle Ungleichheiten abzubauen und gesundheitsförderliche Lebenswelten aktiv zu gestalten. Dabei steht nicht das individuelle Verhalten im Vordergrund, sondern die Veränderung von Verhältnissen und Rahmenbedingungen, die Gesundheit ermöglichen und erhalten. Gesundheitsförderung wird damit zu einer politischen, gesellschaftlichen und planerischen Aufgabe.
In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte, historischen Entwicklungen und fachlichen Einordnungen der kommunalen Gesundheitsförderung vorgestellt. Dabei geht es sowohl um definitorische Klärungen als auch um die Frage, warum Gesundheitsförderung für Kommunen von zentraler Bedeutung ist, wie sie als Querschnittsaufgabe verstanden werden kann und worin sie sich von individueller Gesundheitsförderung unterscheidet.
1. Definition und Zielsetzung
Kommunale Gesundheitsförderung bezeichnet sämtliche strukturbezogenen Maßnahmen, Strategien und Prozesse, die in Städten, Gemeinden oder Landkreisen darauf abzielen, die gesundheitliche Situation der Bevölkerung zu verbessern. Im Gegensatz zur kurativen Medizin, die auf die Behandlung von Krankheit fokussiert, verfolgt die Gesundheitsförderung das Ziel, Gesundheit zu erhalten und zu stärken – insbesondere durch die Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse.
Zentrale Grundlage ist die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1986, die Gesundheitsförderung als einen Prozess definiert, „allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“. Dieser Ansatz legt den Fokus auf Ressourcen, Lebenskompetenzen und soziale Bedingungen statt ausschließlich auf Risikofaktoren oder Krankheitserreger. Kommunale Gesundheitsförderung adaptiert dieses Konzept auf die Ebene der Städte und Gemeinden und nutzt dabei ihre Gestaltungsmacht im lokalen Raum.
Ziele kommunaler Gesundheitsförderung sind unter anderem:
• die Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit,
• die Verbesserung gesundheitsbezogener Lebensqualität,
• die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten (Settings),
• die Prävention nichtübertragbarer Krankheiten,
• die Stärkung von Selbsthilfe und Gesundheitskompetenz,
• die Unterstützung von Partizipation und Empowerment.
Wesentlich ist dabei der sogenannte Setting-Ansatz. Er geht davon aus, dass Gesundheit dort entsteht, wo Menschen leben und handeln – in Kitas, Schulen, Betrieben, Quartieren, Vereinen oder Verwaltungseinrichtungen. Ziel ist es, diese Lebenswelten so zu gestalten, dass gesundheitsfördernde Strukturen zur Normalität werden.
Die kommunale Ebene ist dabei besonders geeignet, weil sie die Lebensverhältnisse direkt beeinflussen kann: von der Stadtplanung über die soziale Infrastruktur bis zur kommunalen Politik. Gleichzeitig kann sie lokale Netzwerke aktivieren, ressortübergreifende Strategien entwickeln und partizipative Verfahren etablieren – wichtige Voraussetzungen für eine wirksame Gesundheitsförderung.
2. Historische Entwicklung
Die kommunale Gesundheitsförderung ist kein neues Phänomen, doch ihre heutige Ausprägung ist Ergebnis eines längeren gesellschaftlichen und politischen Wandels. Bereits im 19. Jahrhundert wurde in vielen Städten damit begonnen, gesundheitsschädliche Umweltbedingungen zu bekämpfen – etwa durch Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohnraumsanierung oder Hygienekampagnen. Diese frühen Formen kommunaler Gesundheitsinterventionen waren stark auf Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung fokussiert und richteten sich in erster Linie auf technische Infrastrukturmaßnahmen.
Mit der Entwicklung des Wohlfahrtsstaats im 20. Jahrhundert rückte zunehmend auch die soziale Dimension von Gesundheit in den Fokus. Kommunen übernahmen Aufgaben der Gesundheitsfürsorge, etwa durch den Ausbau von Gesundheitsämtern, Schulgesundheitspflege oder kommunaler Sozialarbeit. Dabei stand lange Zeit die individuelle Prävention im Vordergrund – etwa durch Impfprogramme, Früherkennung oder Ernährungsberatung.
Ein Paradigmenwechsel vollzog sich in den 1980er-Jahren mit dem Aufkommen der Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta. Hier wurde erstmals systematisch gefordert, gesundheitsfördernde Strukturen zu schaffen und nicht nur auf individuelles Verhalten zu setzen. Dieser Ansatz wurde in Deutschland durch Programme wie „Gesundheitsfördernde Schule“, „Gesunde Städte“ oder das Präventionsnetzwerk NRW aufgegriffen. Kommunen begannen, Gesundheitsförderung verstärkt als integrierte und ressortübergreifende Aufgabe zu verstehen.
Die 1990er- und 2000er-Jahre waren geprägt von Pilotprojekten, Vernetzungsansätzen und dem Aufbau lokaler Gesundheitskonferenzen. Gesundheitsförderung wurde zunehmend in die kommunale Stadtentwicklung eingebunden – etwa im Rahmen der „Sozialen Stadt“ oder von Quartiersmanagementprogrammen. Auch die Rolle von Krankenkassen als Kooperationspartner gewann an Bedeutung.
Ein wesentlicher Meilenstein war die Verabschiedung des Präventionsgesetzes im Jahr 2015. Es gab der kommunalen Gesundheitsförderung erstmals eine bundesgesetzliche Grundlage und stärkte die Rolle von Kommunen bei der Umsetzung nationaler Gesundheitsziele. Seitdem wurden bundesweit zahlreiche kommunale Präventionsketten, Settingprojekte und integrierte Gesundheitsstrategien gefördert und implementiert.
Heute ist kommunale Gesundheitsförderung ein dynamisches Handlungsfeld, das zwischen Gesundheitswesen, Sozialpolitik, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung angesiedelt ist – und das sich stetig weiterentwickelt.
3. Relevanz für Kommunen
Kommunen stehen in besonderer Verantwortung, wenn es um die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger geht. Sie sind die Verwaltungsebene, die dem Alltag der Menschen am nächsten ist, und verfügen über unmittelbare Gestaltungsmöglichkeiten in zahlreichen gesundheitsrelevanten Bereichen: von der Verkehrsplanung über die Bildungsinfrastruktur bis hin zur Umweltpolitik. Deshalb kommt der kommunalen Gesundheitsförderung eine zentrale Bedeutung zu.
Gesundheit ist ein Querschnittsthema, das nahezu alle kommunalen Handlungsfelder betrifft. So beeinflussen städtebauliche Maßnahmen die Bewegungsmöglichkeiten, Luftqualität und Lärmbelastung in einem Quartier. Kita- und Schulpolitik wirkt sich direkt auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern aus. Die Sozialpolitik bestimmt mit, wie gut Menschen Zugang zu Gesundheitsleistungen, Beratung oder gesunder Ernährung haben. Und nicht zuletzt haben auch Kultur-, Sport- oder Umweltpolitik gesundheitliche Auswirkungen, etwa durch Angebote zur Teilhabe oder durch klimabezogene Anpassungsmaßnahmen.
Zugleich sind Kommunen mit konkreten gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert: demografischer Wandel, soziale Ungleichheit, psychische Erkrankungen, Bewegungsmangel, Klimawandel, Migrationsdynamiken oder Pandemiefolgen. Diese Themen lassen sich nicht allein durch das Gesundheitssystem lösen – sie erfordern integrierte kommunale Strategien.
Hinzu kommt, dass die gesundheitliche Lage innerhalb einer Kommune stark variiert. Zwischen verschiedenen Stadtteilen, Quartieren oder Bevölkerungsgruppen bestehen oft erhebliche Unterschiede in Bezug auf Lebenserwartung, Gesundheitsverhalten oder Krankheitsrisiken. Kommunale Gesundheitsförderung ermöglicht es, auf diese Ungleichheiten gezielt einzugehen – etwa durch lebensweltorientierte Projekte, sozialraumbezogene Gesundheitsförderung oder quartiersbezogene Präventionsketten.
Für Kommunen bieten sich durch Gesundheitsförderung zudem langfristige Effekte: Weniger Gesundheitskosten, höhere Lebensqualität, bessere Bildungsergebnisse, stärkere Sozialbindung und mehr Teilhabe sind nur einige der möglichen positiven Wirkungen. Eine gesunde Bevölkerung ist auch wirtschaftlich relevant – etwa durch geringere Fehlzeiten, höhere Erwerbsbeteiligung und mehr ehrenamtliches Engagement.
Schließlich eröffnet Gesundheitsförderung auch neue Möglichkeiten für Beteiligung und Zusammenarbeit. Sie bringt Verwaltung, Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft in den Dialog – und stärkt die kommunale Demokratie.
4. Gesundheit als Querschnittsaufgabe
Die Anerkennung von Gesundheit als Querschnittsaufgabe ist eine zentrale Voraussetzung für wirksame kommunale Gesundheitsförderung. Dabei geht es darum, Gesundheit nicht als isoliertes Handlungsfeld zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil aller relevanten Politik- und Verwaltungsbereiche. Dieser Ansatz, der in der internationalen Gesundheitsförderung als „Health in all Policies“ (HiAP) bekannt ist, fordert dazu auf, gesundheitliche Aspekte systematisch in Entscheidungsprozesse aller Politikfelder einzubeziehen.
In der kommunalen Praxis bedeutet dies, dass Gesundheit auch dort mitgedacht wird, wo sie auf den ersten Blick nicht im Fokus steht: in der Stadtplanung, im Wohnungsbau, im Bildungswesen, im Verkehr, in der Kultur- oder Sportförderung. Eine bewegungsfreundliche Verkehrsplanung, barrierefreie öffentliche Räume, gesundes Schulessen oder klimaangepasste Stadtentwicklung sind Beispiele dafür, wie verschiedene Ressorts zur Förderung von Gesundheit beitragen können.
Die Umsetzung des Querschnittsansatzes erfordert vor allem organisatorische und strukturelle Veränderungen. Dazu gehören:
• die Einrichtung interdisziplinärer Arbeitsgruppen oder Steuerungskreise,
• die Festlegung gemeinsamer Gesundheitsziele,
• die Integration gesundheitsbezogener Indikatoren in die kommunale Planung,
• die Einführung von Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen bei größeren Projekten,
• die systematische Verankerung von Gesundheitsthemen in Verwaltungsvorlagen und
politischen Beschlüssen.
Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die ressortübergreifende Kommunikation. Fachämter müssen lernen, gemeinsam zu planen, Daten auszutauschen und Verantwortung zu teilen. Dabei kann eine koordinierende Stelle – etwa im Gesundheitsamt oder beim Bürgermeisteramt – als Schnittstelle fungieren und Prozesse moderieren.
Der Querschnittsansatz bedeutet auch, dass Gesundheit nicht allein in der Verantwortung des Gesundheitssektors liegt. Vielmehr wird sie zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die von verschiedenen Akteuren gemeinsam getragen wird – Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Bürgerschaft.
Gesundheit als Querschnittsaufgabe zu begreifen, bedeutet letztlich, Gesundheit zu einem Kriterium guter Kommunalpolitik zu machen. Damit wird Gesundheitsförderung nicht zum Zusatzangebot, sondern zu einem integralen Bestandteil nachhaltiger und zukunftsfähiger Stadt- und Gemeindepolitik.
5. Unterschiede zur individuellen Gesundheitsförderung Während individuelle Gesundheitsförderung auf das Verhalten einzelner Personen abzielt, etwa durch Bewegungsprogramme, Ernährungstipps oder Rauchentwöhnung, richtet sich kommunale Gesundheitsförderung vor allem auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse und sozialen Rahmenbedingungen. Dieser Unterschied ist grundlegend für das Verständnis und die Planung entsprechender Maßnahmen.
Individuelle Gesundheitsförderung fokussiert primär auf Bildung, Motivation und Selbstverantwortung. Sie versucht, Menschen zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu befähigen – etwa durch Beratung, Trainings oder Informationskampagnen. Solche Angebote sind wichtig und können wirkungsvoll sein, stoßen aber an Grenzen, wenn strukturelle Barrieren bestehen: Armut, Wohnverhältnisse, mangelnde Teilhabe oder psychische Belastungen können individuelles Gesundheitsverhalten erheblich einschränken.
Kommunale Gesundheitsförderung setzt genau hier an. Sie strebt an, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass gesunde Entscheidungen einfacher werden. Beispiele sind:
• der Ausbau sicherer Geh- und Radwege,
• der Zugang zu bezahlbaren, frischen Lebensmitteln,
• kostenlose Bewegungsangebote im öffentlichen Raum,
• Begrünung und Entsiegelung zur Stressreduktion,
• soziale Treffpunkte zur Förderung des Wohlbefindens.
Ein weiterer Unterschied besteht in der Reichweite und Nachhaltigkeit. Individuelle Maßnahmen erreichen meist nur bestimmte Gruppen – oft die, die ohnehin schon gesundheitsaffin sind. Kommunale Maßnahmen hingegen wirken auf die gesamte Bevölkerung oder auf ganze Stadtteile. Sie können langfristig Veränderungen in der Infrastruktur, in Normen oder in Verwaltungsprozessen bewirken.
Auch die Steuerung unterscheidet sich: Während individuelle Gesundheitsförderung oft von Krankenkassen oder Bildungsträgern verantwortet wird, liegt die Verantwortung für kommunale Gesundheitsförderung bei der öffentlichen Verwaltung. Das erfordert politische Unterstützung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und oft auch neue Verwaltungsstrukturen.
Beide Ansätze schließen sich jedoch nicht aus, sondern ergänzen einander. Kommunale Gesundheitsförderung schafft den Rahmen, innerhalb dessen individuelle Maßnahmen wirksam werden können. Die Kombination aus verhaltens- und verhältnisorientierten Ansätzen ist daher zentral für eine ganzheitliche Gesundheitsstrategie.
Kapitel 2: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen Die Gesundheitsförderung in kommunalen Kontexten bewegt sich in einem komplexen Geflecht aus politischen Zielsetzungen, gesetzlichen Grundlagen und institutionellen Verantwortlichkeiten. Während die praktische Umsetzung auf kommunaler Ebene erfolgt, wird der Rahmen durch nationale und länderspezifische Strategien sowie durch das Sozialrecht vorgegeben. Die politische Verankerung von Gesundheitsthemen ist entscheidend dafür, welche Ressourcen, Prioritäten und Handlungsspielräume den Kommunen tatsächlich zur Verfügung stehen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen fungieren dabei nicht nur als Begrenzung, sondern auch als Ermöglichung. Das Präventionsgesetz, die Regelungen im Sozialgesetzbuch und die föderale Kompetenzverteilung schaffen normative Orientierung und legen Verantwortlichkeiten fest. Gleichzeitig eröffnen sie Spielräume für kommunale Akteurinnen und Akteure, gesundheitsfördernde Maßnahmen bedarfsorientiert zu gestalten und lokal umzusetzen. Um die Potenziale dieser Rahmensetzungen voll ausschöpfen zu können, bedarf es jedoch fundierter Kenntnisse der einschlägigen Gesetze, Programme und Strukturen.
1. Gesundheitsziele auf Bundes- und Länderebene
Gesundheitsziele auf Bundes- und Landesebene bieten strategische Orientierung für die Ausgestaltung gesundheitsfördernder Maßnahmen. Sie bündeln prioritäre Handlungsfelder und sollen dazu beitragen, gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen und die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhöhen.
Auf Bundesebene werden die sogenannten Nationalen Gesundheitsziele im Rahmen des Kooperationsverbundes gesundheitsziele.de entwickelt. Dieser Zusammenschluss aus Akteurinnen und Akteuren der Politik, Wissenschaft, Sozialversicherung, Selbsthilfe und Praxis arbeitet unter Federführung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an der Formulierung, Konkretisierung und Fortschreibung dieser Ziele. Beispiele sind: „Gesund aufwachsen“, „Gesund älter werden“ oder „Depressionen verhindern“.
Diese Ziele sollen nicht isoliert betrachtet, sondern in Strategien überführt und in die Strukturen der Gesundheitsversorgung sowie der Gesundheitsförderung integriert werden. Sie bieten auch einen wichtigen Bezugsrahmen für Förderprogramme und Maßnahmenplanung auf kommunaler Ebene. Für viele dieser Ziele wurden spezifische Teilziele und Indikatoren entwickelt, die eine Umsetzung auf regionaler Ebene erleichtern.
Auch die Bundesländer haben eigene Gesundheitsziele definiert, oft im Rahmen ihrer Landesgesundheitskonferenzen oder Landesrahmenvereinbarungen nach § 20f SGB V. Diese sind in der Regel an die bundesweiten Ziele angelehnt, greifen aber landesspezifische Problemlagen, demografische Entwicklungen und regionale Gesundheitsunterschiede auf.
Für Kommunen sind Gesundheitsziele insbesondere dann hilfreich, wenn sie als strukturgebender Rahmen für lokale Gesundheitsstrategien genutzt werden. Sie ermöglichen die Priorisierung von Maßnahmen, erleichtern die Evaluation und tragen zur besseren Verständigung unter verschiedenen Akteursgruppen bei. Voraussetzung ist jedoch eine bewusste Auseinandersetzung mit den Inhalten und die aktive Übersetzung in kommunale Kontexte.
2. Gesetzliche Grundlagen (z. B. Präventionsgesetz)
Die gesetzlichen Grundlagen der Gesundheitsförderung bilden das Fundament für Planung, Finanzierung und Durchführung kommunaler Maßnahmen. Zu den zentralen Regelwerken zählt insbesondere das Präventionsgesetz (PrävG), das 2015 in Kraft trat. Es zielte darauf ab, Prävention und Gesundheitsförderung systematisch in den verschiedenen Lebenswelten zu verankern und dabei die Verantwortung der Sozialversicherungsträger zu erweitern.
Kernstück des PrävG ist die Neufassung von § 20 SGB V, wonach die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet sind, Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten wie Kitas, Schulen, Betrieben oder Quartieren zu erbringen. Gleichzeitig sollen sie mit anderen Trägern im Rahmen von Landesrahmenvereinbarungen kooperieren. Auch der Aufbau von Kooperationsstrukturen – insbesondere die Stärkung der Kommunen als strategische Partner – ist ausdrücklich vorgesehen.