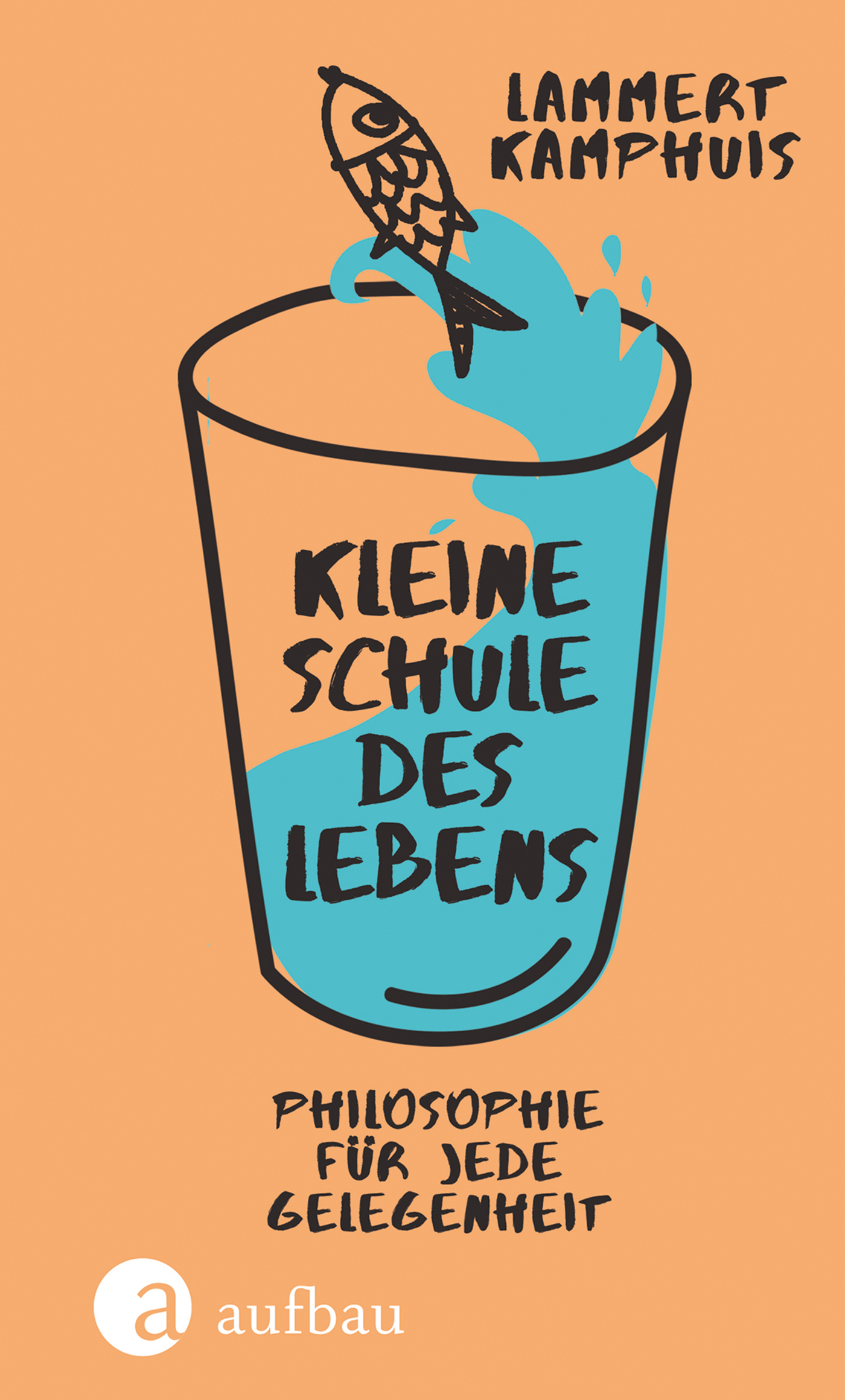17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Philosophie Mauern einreißen.
Kennen Sie Menschen, die immer recht haben wollen? Oder die endlosen Diskussionen, bei denen jeder nur auf seinem Standpunkt beharrt? Kommt es Ihnen seltsam vor, dass es für jedes Problem nur eine „richtige“ Lösung geben soll?
Lammert Kamphuis, einer der bekanntesten Philosophen der Niederlande, hält dagegen. Sein Buch ist Analyse und Werkzeug zugleich: eine längst fällige Einladung, unsere Denkgewohnheiten zu hinterfragen und geistige Flexibilität zurückzugewinnen, um wieder richtig miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ein philosophischer Kompass, der nicht nur klüger macht, sondern auch mutiger.
»Für diejenigen, die zu wenig Zeit haben, Nietzsches gesammelte Werke zu lesen, ist dies eine praktische Anleitung: eine Art Yoga für den Geist, mit nützlichen Übungen, um das bewegliche Denken zu trainieren.« De Standaard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Philosophie ist keine elitäre Disziplin, sondern eine jahrhundertealte Tradition des Übens: die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören, der Mut, andere Perspektiven ernst zu nehmen, und die Einsicht, dass wir durch dieses Einlassen auf das Fremde klüger und kreativer werden.
Unser Denken ist oft wie eine Mauer, hinter der wir uns verschanzen. Mithilfe der Philosophie können wir lernen, diese Mauern einzureißen und eine neue, offene Haltung zu entwickeln – gegenüber uns selbst, anderen und der Welt. Denn Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir bereit sind, den Dialog zu suchen und auch die unangenehmen Antworten auszuhalten.
Für alle, die nicht nur eine Meinung haben wollen, sondern auch Mut, sie zu ändern.
Über Lammert Kamphuis
Lammert Kamphuis, geboren 1983, studierte Philosophie und Theologie. Er ist Autor zahlreicher Bücher und ein gefragter Referent im Wirtschafts- und Bildungsbereich. Außerdem lehrt er an der Schule des Lebens in Amsterdam. Mit seinem Buch „Kleine Schule des Lebens“, das 2020 bei Aufbau erschien, wurde er einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Heute gilt er in den Niederlanden als "einer der inspirierendsten Redner des Augenblicks" (Nouveau).
Bärbel Jänicke ist Übersetzerin aus dem Niederländischen. Sie studierte Philosophie, Kunstgeschichte und Archäologie in Frankfurt am Main und Saarbrücken und lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lammert Kamphuis
Entpolarisiert euch!
Mit Philosophie gegen die Spaltung der Gesellschaft
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Vorwort
Anleitung zum Lesen dieses Buchs
Feedback
1 Eine Welt aus Schwarz und Weiß
2 Die heutige Gesellschaft erinnert mich immer mehr an meine frühere Kirche
3 Woher kommt dieser neue Dogmatismus?
4 Lieber träge als gelenkig
Unsere Trägheit entlarvt
Confirmation Bias
Motiviertes Denken
Kognitive Dissonanzreduktion
Self-Serving Bias
Dunning-Kruger-Effekt
Frequenzillusion
Wir sind nicht so rational, wie wir meinen
Erklärungen für unsere Trägheit
5 Philosophie als Ermutigung, in Bewegung zu bleiben
6 Trainieren Sie Ihre Gelenkigkeit
Hinterfragen Sie Ihre eigenen Überzeugungen mit den Skeptikern
Frischen Sie Ihre Sichtweise mit den Stoikern auf
Mit Spinoza herauszoomen
Wagen Sie es mit Hipparchia und Schopenhauer, alles in Frage zu stellen
Lernen Sie aufmerksam hinzusehen mit Simone Weil
Mit Levinas Andersdenkende aufsuchen
Führen Sie gelenkige Gespräche mit Sokrates
Nutzen Sie mit Nussbaum Ihren Zorn für etwas Gutes
Intermezzo: Plädoyer gegen perspektivische Gelenkigkeit
7 Darf ich dann nie mehr eine Meinung zu etwas haben?
Seien Sie für die Möglichkeit offen, dass Meinungen manchmal nebeneinander bestehen können
Bedenken Sie, dass jemand, der eine andere Meinung hat, nicht unbedingt ein böswilliger Idiot ist
Lernen Sie, sich zu vervielseitigen
Stellen Sie Fragen – um Ihr eigenes Wissen zu erweitern oder den anderen dazu zu bewegen, die Dinge anders zu sehen
Stellen Sie den Standpunkt der Gegenpartei so stark wie möglich dar
Seien Sie transparent in Bezug auf Ihre eigenen Interessen und zeigen Sie, dass Ihre Position darüber hinausgeht
Suchen Sie nach dem Wunsch hinter der höhnischen Bemerkung
Präsentieren Sie Ihre Ideen und Argumente so, dass sie widerlegbar sind.
8 Die Macht der Unwissenheit
Zum Schluss: Liste von Übungen in Gelenkigkeit
Individuelle Übungen
Gemeinsame Übungen
Dank
Quellen
Bücher
Filme / Dokumentationen
Zitierte Studien und Experimente (in der in diesem Buch besprochenen Abfolge)
Erläuterungen
Impressum
Wir sind zu klein Um alles zu überblicken Auch wenn uns gelegentlich Ein Licht aufgeht Tappen wir in unserem Denken Doch meist im Dunkeln Denn unseren eigenen Irrtum Wollen wir nicht sehn.
– Stef Bos
Vorwort
Anleitung zum Lesen dieses Buchs
Dieses Buch lässt sich auf zwei Arten lesen. Sie können mit den Kapiteln 1 bis 4 beginnen, in denen ich darauf eingehe, wie süchtig wir danach sind, recht zu haben, und erst dann die Kapitel 5 bis 8 lesen, in denen ich Sie mit Möglichkeiten vertraut mache, wie man geistig flexibel, ja, gelenkig bleibt. Am Ende des Buches erwartet sie eine Aufstellung von konkreten Übungen, die im Buch vorkommen. Wenn Ihnen nicht der Sinn danach steht, mit »der Sonne, die in unserem Denken untergeht« anzufangen, können Sie auch gleich mit dem zweiten Teil beginnen. Danach können Sie im ersten Teil nachlesen, warum wir diese Übungen so dringend brauchen. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Seien Sie gelenkig und entscheiden Sie selbst, welche Reihenfolge Sie mehr anspricht!
Feedback
Im Fortgang des Buches werde ich einige Male zur Bescheidenheit in Bezug auf unser eigenes Wissen aufrufen: Das Ausmaß unserer Unwissenheit ist größer als unser wirkliches Wissen. »Wir sind zu klein, um uns über alles zu erheben.« Das gilt natürlich auch für mich als Autor. Sollten Sie auf Ungenauigkeiten stoßen oder das Gefühl haben, dass meine Sichtweise zu einseitig ist, können Sie mir gerne eine Nachricht senden. Auf meiner Website https://www.lammertkamphuis.nl finden Sie mehrere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Auf diese Weise geben Sie mir die Möglichkeit, in einem späteren Druck etwaige Verbesserungen vorzunehmen. Ich freue mich, wenn mich jemand dazu herausfordert, meine eigenen Gewissheiten in Frage zu stellen.
1Eine Welt aus Schwarz und Weiß
Vorher aber möchte ich bemerken, dass ich von keinem der Dinge, die ich sagen werde, mit Sicherheit behaupte, dass es sich in jedem Fall so verhalte, wie ich sage.
– Sextus Empiricus
Ich komme aus einer Welt aus Schwarz und Weiß, ohne jegliche Grautöne. In meiner Jugend nickte ich beifällig zu den Worten Jesu: »Wer nicht für mich ist, ist gegen mich«. Es gab keinen Mittelweg. In einem viel zitierten Text verurteilt Jesus eine Gruppe von Christen, weil sie lau sind – statt warm oder kalt. Ihrer Lauheit wegen wird er sie aus seinem Munde ausspeien. Das Letzte, was wir, die etwa 120.000 Gläubigen in den Niederlanden, wollten, war, ausgespien zu werden. Wir waren schließlich auserwählt, in einem Bund mit Gott zu leben. Obwohl wir in dieser Welt waren, waren wir doch nicht von dieser Welt. Wir waren Fremde hier auf Erden, und diese Ausnahmestellung wurde kultiviert und zelebriert.
Jesu Warnung, kein ungleiches Gespann mit Ungläubigen zu bilden, nahmen wir uns zu Herzen: »Zieht weg aus ihrer Mitte und sondert euch ab.« Diese Absonderung wurde nicht halbherzig vollzogen. Unsere Kirche hatte ihre eigenen Grundschulen, Sekundarschulen, eine Fachoberschule, eine Hochschule und eine Universität. Diese Säule stand stolz bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in einem Land, in dem die »Entsäulung«[1] schon seit Jahrzehnten im Gange war. Wir hatten unsere eigene Zeitung und sogar eine eigene politische Partei in der ersten und der zweiten Kammer des Parlaments. Alle Voraussetzungen waren geschaffen, um uns niemals mit jemandem außerhalb des Bundesvolkes anfreunden zu müssen. So konnten wir vermeiden, lau oder grau, oder irgendetwas zwischen Gut und Böse zu werden. Es war glasklar, wer zu denen gehörte, die im Licht standen, und wer zu jenen, die in der Dunkelheit standen. Diese Trennung war eindeutig, und wir standen, Gott sei Dank, auf der richtigen Seite.
Die Welt außerhalb unserer sorgfältig aufgebauten Minigesellschaft war von Heiden bevölkert, die keine guten Taten vollbringen konnten. In unserem Glaubensbekenntnis lernten wir, dass es nur durch den Glauben möglich war, Gutes zu tun. Der Pastor erklärte uns außerdem, dass die Christen aus anderen Kirchen mit ihrem Glauben alle falschlägen. Wir wären die einzig wahre Kirche. Als Reaktion darauf kursierte in den übrigen christlichen Niederlanden ein Witz über Petrus, der die Menschen nach ihrem Tod im Himmel willkommen heißt. Während seiner Führung ermahnt er sie plötzlich zur Stille. Nachdem sie an einer geschlossenen Tür vorbeigekommen sind, an der ein Schild zum Schweigen gemahnt, fragt jemand, warum sie dort nicht sprechen durften, woraufhin Petrus erklärt: »Dort sitzen die befreiten Reformierten. Sie glauben, dass sie hier alleine sind.«
Unser Glaubensbekenntnis bestand aus einhundertneunundzwanzig Fragen und Antworten, verteilt auf zweiundfünfzig Sonntage. So konnte der Pfarrer jeden Sonntagmittag eine gewisse Anzahl von Antworten erläutern. An den Wochentagen mussten wir in die Kirche kommen. Wir hatten die Antworten brav auswendig gelernt, und am Mittwochabend wurden sie vom Pfarrer abgehört. Die Fragen stellte er: »Woran erkennt ihr euer Elend?«, »Was soll ein Christ glauben?«, »Was ist euer einziger Trost im Leben und im Sterben?« Wir mussten die Antworten aufsagen. Damit war sicherlich nicht die Absicht verbunden, diese Antworten in Frage zu stellen. Sie leiteten sich ja aus dem unfehlbaren Wort Gottes ab. Wie könnte man es als Mensch wagen, daran zu zweifeln? Das wäre ja noch schöner!
Zu Beginn des Gottesdienstes wurde manchmal traurig verkündet, dass sich jemand der »Aufsicht und Zucht der Kirche« entzogen habe. Dann verlief diese unbestreitbare Linie zwischen Gut und Böse plötzlich durch Familien hindurch. Ich hörte einmal eine Mutter, deren Kind aus der Kirche ausgetreten war, sagen, wie schrecklich es sei, zu erkennen, dass ihr Sohn nun ihr Gegner geworden sei. Sie empfinde es jedoch als Trost, dass sich damit die Worte Jesu bewahrheiteten: »Meint nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen […] Denn ich bin gekommen, einen Mann mit dem Vater zu entzweien und eine Tochter mit der Mutter und eine Schwiegertochter mit der Schwiegermutter; und zu Feinden werden dem Menschen die eigenen Hausgenossen.«
Mit 18 Jahren beschloss ich, eine Ausbildung zum Pfarrer zu machen. Man hatte mir immer wieder gesagt, ich sei dazu geeignet, junge Menschen an die Kirche zu binden und sie so vor den ewigen Höllenqualen zu bewahren. Nach mehreren Jahren des Theologiestudiums beschloss ich, außerdem noch Philosophie zu studieren. Vielleicht würde es mir helfen, die Ungläubigen besser zu verstehen, sodass ich auch sie von der Wahrheit überzeugen könnte. Mein erstes Philosophieseminar dauerte drei Stunden. Der Dozent endete, aber hatte offensichtlich vergessen, Antworten auf die Fragen zu geben, die wir diskutiert hatten. Als ich den Seminarraum verließ, fragte ich ihn, ob er nächste Woche die Antworten liefern würde. Er müsse mich enttäuschen, sagte er. »Hier geht es mehr darum, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben.« Auf der Zugfahrt von Utrecht nach Kampen entstand bei mir der erste Riss in meinem festgefügten Weltbild. Etwas Licht fiel in das Abteil.
Sieben Jahre später brach ich unter Schmerzen und Mühen aus der dogmatischen Schwarz-Weiß-Welt meiner Jugend aus (in meiner Kindheit war »dogmatisch« eines der schönsten Komplimente, die man bekommen konnte – mein Vater war sogar Professor für Dogmatik). Der Preis dafür war hoch. Ich verlor meine Anstellung, viele Freundschaften gingen in die Brüche und ich wurde in den Augen vieler zum schwarzen Schaf der Familie. Aber dennoch fühlte ich mich beschwingt und frei. Ich hoffte, in eine Welt voller Farben und zahlreicher Grautöne hineinzutanzen. Begriffe wie Toleranz, Freiheit, Zweifel, Dialog und wachsende Einsicht waren Musik in meinen Ohren. Doch stattdessen finde ich mich zu meinem Entsetzen in den letzten Jahren in einer Gesellschaft wieder, die der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, immer ähnlicher wird. Wir schließen uns in neue Schwarz-Weiß-Kammern ein.
2Die heutige Gesellschaft erinnert mich immer mehr an meine frühere Kirche
Das ganze Problem mit der Welt ist, dass Spinner und Fanatiker sich immer so sicher sind, und weisere Menschen so voller Zweifel.«
– Bertrand Russell
Wir leben in einer Zeit, in der es immer weniger Verständnis für Andersdenkende gibt. Während der Corona-Pandemie hörte ich von Familien, die aufgrund von Meinungsverschiedenheiten auseinanderbrachen. Die Uneinigkeit nahm manchmal so große Ausmaße an, dass Kinder und Eltern nicht mehr miteinander sprachen. Als ich diese Geschichten hörte, kam es mir wie ein Déjà‑vu aus meiner Jugend vor. Die Gesellschaft ist in Lager gespalten (»Kampen« – zu Deutsch: Lager – war übrigens der vielsagende Ortsname der Stadt, in der die Theologische Universität meiner Kirche stand – nomen est omen). Man steht entweder auf der guten oder der schlechten Seite. Einen Mittelweg scheint es nicht mehr zu geben. Wenn wir nicht aufpassen, beziehen wir unsere Stellungen und graben uns darin tief ein. Jeder außerhalb unserer Stellungen wird mit Worten des Unverständnisses beschossen. Das passiert in der Öffentlichkeit, aber ebenso in Freundeskreisen, Organisationen und Beziehungen.
Eines Abends war ich mit einigen befreundeten Autoren zum Essen verabredet. Einer von ihnen erzählte, dass er beschlossen habe, aus Umweltschutzgründen nie wieder zu fliegen. Das scheint mir eine gut vertretbare Position zu sein. Wir unterhielten uns ganz entspannt über seine Beweggründe. Alle lobten seine Entscheidung; einige sagten, sie würden nun auch weniger fliegen, ganz damit aufzuhören, sei aber gegenwärtig noch ein zu großer Schritt für sie. Einig waren wir uns alle darin, dass es letztendlich besser wäre, wenn alle auf nicht notwendige Flüge verzichten würden. Einige Wochen zuvor hatte ich mit Erstaunen in einem Buch gelesen, dass die zivile Luftfahrt nur für zwei bis drei Prozent der weltweiten CO2‑Emissionen verantwortlich ist. Darin wurde vor einer einseitigen Fokussierung auf die Frage, ob man fliegen solle oder nicht, gewarnt; sie könne die Aufmerksamkeit von anderen umweltbelastenden Faktoren ablenken. Ich war gespannt, wie meine Tischgenossen auf diese Warnung reagieren würden. Von dem Moment an, als ich diesen Gedanken zur Sprache brachte, änderte sich die Atmosphäre schlagartig. Zunächst äußerte man Misstrauen gegenüber der Quelle meiner Recherche; sie stamme wohl aus einem Kreis von Klimawandelleugnern. Als ich darauf hinwies, dass dies nicht der Fall sei und diese Zahlen auch auf der Website der staatlichen Behörden zu finden seien, wurden mein Verständnis und mein Gedächtnis angezweifelt. Wahrscheinlich hätte ich die Statistik falsch gelesen. Dann wurden meine Intentionen kritisch unter die Lupe genommen. Warum führte ich überhaupt so eine Information an? Auf wessen Seite stand ich eigentlich? Einer der letzten Kommentare des Gesprächs lautete, dass Menschen wie ich das Problem seien, an dem dieser Planet zugrunde gehen werde.
Alex Datema ist Vorsitzender der Vereinigung BoerenNatuur (zu Dt.: BauernNatur) und selbst auch Bauer. Während der Bauernproteste im Jahr 2022 als Reaktion auf die angekündigte Stickstoffpolitik der Regierung wurde er von vielen Talkshow-Redakteuren angefragt. In den Vorgesprächen stellte sich jedoch heraus, dass seine Auffassung zu nuanciert war. Letzten Endes wurde er zu keiner einzigen Sendung eingeladen: »Ich passe nicht ins Bild: Wir haben jemanden auf der linken Seite, wir haben jemanden auf der rechten Seite, die sind sich nicht einig. Ich hingegen glaube, man muss die beiden miteinander verbinden, das ist meine Auffassung. […] Wenn man im Fernsehen nur Leute miteinander konfrontiert, die unterschiedlicher Meinung und nicht bereit sind, einander zuzuhören und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, wie sollen die Menschen vor Ort dann nach einer Lösung suchen?« Die meisten Diskussionen im Fernsehen sind zu einem Spektakel geworden. Talkshows vermitteln den Eindruck, als gäbe es zu fast jedem möglichen Thema nur zwei Standpunkte, die dann auch noch diametral entgegengesetzt sind.
Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist auch im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zu beobachten. Seit der Eskalation dieses Konflikts im Jahr 2023 habe ich in einer Reihe von Gesprächen darüber doch tatsächlich die Frage gehört: Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Das wirkt, als handele es sich dabei um einen Sportwettkampf, bei dem man eines der beiden Teams anfeuert. In einem solchen Rahmen wird das Betrauern einer bestimmten Gruppe von Opfern schnell als bedingungslose Unterstützung für eine der beiden Seiten interpretiert. Mit einem binären Ansatz wird man der Komplexität dieser tragischen Situation nicht gerecht. Außerdem verringert diese Denkweise die Bereitschaft, sich die Standpunkte anderer anzuhören.
Aus den Jahresberichten der IPU (Interparlamentarische Union) geht hervor, dass die Bedrohungen von Politikern weltweit zunehmen. In den Niederlanden hat sich die Zahl bis 2022 sogar verdoppelt. Und das Schlimmste ist vielleicht, wie vorhersehbar die Reaktionen auf solche Bedrohungen sind. Das eine Lager verurteilt sie bedingungslos, das andere verurteilt sie auch, aber … möchte doch noch eine Randbemerkung dazu machen. Immer wenn sich eine öffentliche Person einen Ausrutscher leistet, läuft es nach demselben Muster ab. Dann kann man sich im Voraus schon ausrechnen, wer darüber einen Aufstand macht und wer das lieber links liegen lässt.
Auch innerhalb von Organisationen kommt es unter Kollegen leicht zu einer Spaltung in verschiedene Lager. Ich habe von einem Unternehmen gehört, in dem unter Mitarbeitern ein Dialog zur Einrichtung von Unisex-Toiletten angestoßen wurde. Innerhalb kürzester Zeit konnte von einem konstruktiven Austausch darüber keine Rede mehr sein. Entweder man gehörte zu den »nicht-binären Kulturmarxisten« oder zum Lager der »konservativen Sexisten«. In beiden Fällen gab es genug Gründe, sich nicht mehr zuhören zu müssen.
In jüngster Zeit wurde ich mehrfach von Organisationen angesprochen, deren Diskussion über den Umgang mit dem Thema Homeoffice vollkommen festgefahren war. Mehr als ein Jahr lang wurden verschiedene Szenarien geprüft und die Vor- und Nachteile jedes Szenarios aufgelistet. Zu einer Entscheidung führte das jedoch nicht. Geben wir den Mitarbeitern völlige Freiheit? Verpflichten wir sie, an einem, zwei oder drei Tagen im Büro zu sein? Und dürfen sie dann selbst entscheiden, an welchen Tagen? Der Prozess verlief im Sande, denn irgendwann hatte jeder Position bezogen, und es war keinerlei Bewegung mehr möglich. Das merkte ich auch, als ich in einer dieser Organisationen ein Gespräch moderierte: Wenn jemand ein Argument vorbrachte, nickte die eine Hälfte des Raumes und die andere Hälfte schaute aus dem Fenster und rollte mit den Augen. Altbekannte Steckenpferde wurden aus dem Stall geholt, abgestaubt und geritten. Es wurden keine offenen Fragen gestellt, und die Stimmung sank weit unter den Gefrierpunkt.
Selbst die Liebe, sicherlich eines der am schwersten zu fassenden Themen, bleibt vom Denken in Gegensätzen nicht verschont. Auf einer Geburtstagsfeier spreche ich mit Lara. Sie spielt dienstagabends in einer Hockeymannschaft und hatte mir kürzlich beim anschließenden Bier erzählt, dass sie und ihr Freund eine Pause einlegen wollen. Sie war noch nicht fertig mit Erzählen, als ihr in der Kneipe schon die Meinungen nur so um die Ohren flogen – von »das wird nie funktionieren, eine Pause ist etwas für Feiglinge, die sich noch nicht trauen, Schluss zu machen« bis hin zu »macht es gleich, das ist der beste Weg, um herauszufinden, ob ihr noch zusammen sein wollt: ein Mann weiß erst, was ihm fehlt, wenn die Frau nicht mehr da ist«. Statt eines Gesprächs über ihre besondere Situation entwickelte sich eine Debatte zwischen diesen beiden entgegengesetzten Ansichten.
Leider ertappe ich mich selbst auch mit einiger Regelmäßigkeit dabei, in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Ein Bekannter von mir hat sich nicht impfen lassen. Ich spreche mit ihm kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und äußere meine Sorgen darüber, wozu Putin fähig ist. Er schüttelt mitleidig den Kopf und bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass sich ein Philosoph wie ich lammfromm von den Mainstream-Medien (MSM) einwickeln lässt und nicht sieht, dass die NATO Russland zu diesem Schritt provoziert hat. Ich stecke ihn meinerseits in die Schublade der »conspirituality« (eine Verschmelzung von »conspiracy«, zu Dt.:Verschwörungsmentalität, und »spirituality«, zu Dt.: Spiritualität), er steckt mich seinerseits in die Schublade der schwächlichen Anhänger der MSM, und wir sprechen danach monatelang nicht mehr miteinander.
Einer meiner Freunde, mit dem ich seit Jahren gute Gespräche führe, erzählt mir eines Tages, dass er sich zunehmend für das Christentum begeistert. Er besucht sogar hin und wieder kirchliche Veranstaltungen. Ich höre mich selbst denken: »Oh nein, verliere ich ihn jetzt an die Kirche?« Ein absurder Gedanke: Als ob es keine Freundschaft geben könnte, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat, was das Übernatürliche betrifft.