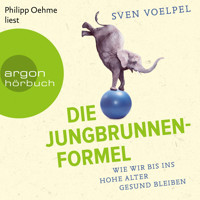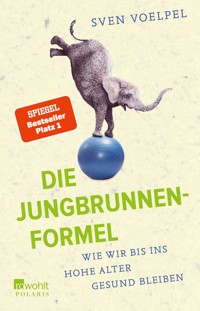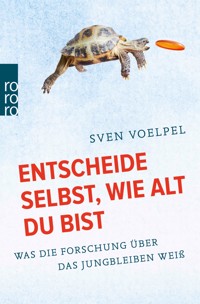
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland altert, und zwar rasant. Das verändert nicht nur Gesellschaft, Politik und Kultur, dieses Thema betrifft jeden ganz persönlich. Aber: Was ist das überhaupt – «Alter»? Und geht es zwingend mit Gebrechen und Einsamkeit einher? Sven Voelpel stellt dar, welche Kriterien für das Altsein und Sich-alt-Fühlen eine Rolle spielen, und zieht dazu zahlreiche Studien heran. Die gute Nachricht: Wir können, in weitaus größerem Maße als bisher gedacht, beeinflussen, ob wir alt sind oder nur älter werden. Sven Voelpel zeigt, wie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sven Voelpel
Entscheide selbst, wie alt du bist
Was die Forschung über das Jungbleiben weiß
Über dieses Buch
Deutschland altert, und zwar rasant. Das verändert nicht nur Gesellschaft, Politik und Kultur, dieses Thema betrifft jeden ganz persönlich. Aber: Was ist das überhaupt – «Alter»? Und geht es zwingend mit Gebrechen und Einsamkeit einher? Sven Voelpel stellt dar, welche Kriterien für das Altsein und Sich-alt-Fühlen eine Rolle spielen, und zieht dazu zahlreiche Studien heran. Die gute Nachricht: Wir können, in weitaus größerem Maße als bisher gedacht, beeinflussen, ob wir alt sind oder nur älter werden. Sven Voelpel zeigt, wie.
Vita
Sven C. Voelpel, Jahrgang 1973, ist Professor für Betriebswirtschaft an der Jacobs University Bremen sowie Gründungspräsident der WISE Group und des WDN - WISE Demografie Netzwerks. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Demographischer Wandel, Diversity und Leadership sowie effektive Führung und lebenslange Höchstleistung. Als einer der führenden Altersforscher Deutschlands berät er Regierungen sowie eine Vielzahl von Organisationen, darunter die Bundesagentur für Arbeit, die Allianz SE, die Daimler AG, die Deutsche Bahn, Deutsche Bank und die Otto Group. Bei Rowohlt Polaris erschien im Mai 2020 sein neues Buch "Die Jungbrunnen-Formel".
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie, Werbeagentur,
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur
ISBN 978-3-644-57031-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Ausgangslage: Was heißt hier «Alter»?!
Das kalendarische Alter – Wie wenig nackte Zahlen verraten
Wann ist man alt?
Lebensphasen und Lebensverläufe früher und heute
Junge Alte & alte Junge
Blick in die Zukunft: Alter im 22. Jahrhundert? Abgeschafft!
Das biologische Alter – Wie unsere Lebensweise uns jung hält oder altern lässt
Der Fluch der Gene? Warum wir altern
Was wir verlieren, wenn wir älter werden
Plastizität: Marathonlauf mit 100, Altersdiabetes mit 12
Das Rätsel der Allerältesten
Das Geheimnis der «blauen Zonen»
Die grauen Zellen und die Klugheit des Alters
Für Körper und Geist: Fitness first!
Das gefühlte Alter – Wie unser Selbstbild das Alter beeinflusst
Außen Falten, innen jung?
Zufrieden oder verbittert? Persönlichkeit und das Alter
«Schon alt» oder «noch jung»? Unser Selbstkonzept
Körper und Geist: Wie wir uns alt denken oder jung bleiben
Ab 60 hört der Spaß auf? Sexualität
Wandel oder Verlust? Psychologie der Lebensspanne
Das soziale Alter – Wie andere uns alt machen oder jung halten
Einsiedlerinnen und Einsiedler altern schneller
Zeige mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist
Von alten und neuen Altersrollen: Fitnessdiktat statt Ruhestand?
Rente mit 63? 73? 93? Warum es uns guttut, länger zu arbeiten
Geld macht doch glücklich: Alter und Finanzen
Heim oder Hawaii, Wohnung oder WG: Wie wollen wir leben?
Fazit: 10 Gebote für ein glückliches Alter
Literaturverzeichnis
Danksagung
Das kalendarische Alter –
Wie wenig nackte Zahlen verraten
«Hier tanzen 180 Jahre!», ruft der ältere Herr, der sich mit seiner Sandkastenliebe auf der Silberhochzeit seiner Tochter zu beschwingten Walzerklängen dreht, durchaus ein wenig vorsichtig, aber taktsicher. Er: 92. Sie: 88. Richtig gerechnet also. Ganz schön alt, wenn man aufs Geburtsdatum blickt. Und bemerkenswert jung, wenn man auf die Tanzfläche schaut. Die Frage drängt sich auf: Wann ist man «alt»? Im Fußball zählt man spätestens ab Mitte 30 zu den «Alten Herren», was Oliver Kahn freilich nicht daran gehindert hat, bis kurz vor seinem 39. Geburtstag das Bayern-Tor zu verteidigen. Als Unternehmer ist man hingegen mit 50 «im besten Alter»; als Staatenlenker wiederum läuft man erst jenseits der 60 zur Hochform auf. Und niemand ist auf die Idee gekommen, Papst Franziskus oder Queen Elisabeth II. den Ruhestand zu empfehlen, als sie 80 bzw. 90 Jahre alt wurden. Sind die beiden etwa gar nicht «alt»?
Wussten Sie schon,
… dass unser Gehirn von der Geburt bis ins hohe Alter neue Synapsen bildet?
… dass 70-Jährige im Schnitt eloquenter und emotional intelligenter sind als 20-Jährige?
… dass die meisten Menschen mit 60 oder 70 Jahren zufriedener sind als mit 40?
Wann ist man alt?
«In meiner Kindheit begleitete ich meine Großmutter häufig auf den Bauernhof ihres Schwagers. Dort lebte eine ältere unverheiratete Großtante. Schwarz gekleidet, mürrisch, gebückt, mit Kopftuch und Krückstock, jagte sie mir eine Heidenangst ein. Zu ähnlich war sie der Hexe in meinem Märchenbuch. Heute weiß ich, dass diese Frau, die mir damals unbeschreiblich alt vorkam, Anfang, höchstens Mitte 70 war», erzählt mir eine Mitarbeiterin.
Wäre diese ältere Großtante nicht vor dem Ersten, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden, hätte sie das Kind vermutlich in Jeans und Bluse begrüßt, der Krückstock wäre ihr wahrscheinlich dank Hüftoperation erspart geblieben. Womöglich hätte sie in den siebziger Jahren eine Ausbildung absolviert, und vielleicht würde sie heute das Singleleben in ihrer Stadtwohnung genießen, zwischen Yoga-Kurs und sozialem Engagement hin- und herpendelnd. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich das Leben im Alter radikal gewandelt – und wird es noch weiter tun. Es wird also höchste Zeit, dass dies auch in den Köpfen ankommt! Was heißt heute noch «alt»?
Jeder von uns hat sein eigenes Bild vom Alter im Kopf, das geprägt wird von familiären Vorbildern, gesellschaftlichen Rollenmodellen und der öffentlichen Diskussion über das Alter. Die Debatte wird bestimmt von Stichworten wie «Demenz», «Überalterung der Gesellschaft» und «leeren Rentenkassen». Und so springen uns Meldungen, dass bei den über 85-Jährigen mehr als drei Viertel und selbst von den über 90-Jährigen rund zwei Drittel bei wachem Verstand sind, höchst selten in großen Lettern von den Titelseiten entgegen. Auch die Beobachtung, dass Prognosen zum drohenden Pflegenotstand aus den neunziger Jahren sich bereits heute als zu pessimistisch erwiesen haben, ist offenbar keinen Artikel wert (vgl. Korte 2014, S. 212, S. 322). Stattdessen gehen alle Vorhersagen von konstanten Pflegequoten aus und ignorieren, dass wir nicht nur älter werden als jemals zuvor, sondern dank unseres Wissens über gesunde Lebensführung und aufgrund des medizinischen Fortschritts auch im höheren und hohen Alter immer fitter sind (siehe Kapitel 2 – Das biologische Alter). Das Internetlexikon Wikipedia macht da keine Ausnahme und reduziert das Alter ebenso knapp wie unzutreffend auf einen Lebensabschnitt, der mit «einem allgemeinen körperlichen Niedergang verbunden ist», und ignoriert dabei die vielfältigen Chancen, die diese Lebensphase heute zu bieten hat. So gesehen, ist es kaum verwunderlich, dass nur die allerwenigsten Menschen wissen: Sie können sich allein schon deswegen auf das Alter freuen, weil sie mit den Jahren ganz automatisch immer glücklicher und zufriedener werden. «Das Glück ist ein U», stellte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 23.07.2013 unter Berufung auf eine umfangreiche Studie der London School of Economics fest. Befragt wurden 23000 Menschen aus mehr als 50 Nationen. Das Ergebnis: Die meisten von ihnen waren mit ungefähr 20 am glücklichsten. Danach sank die Zufriedenheit kontinuierlich bis etwa zum 50. Lebensjahr – um dann völlig überraschend wieder anzusteigen. Zu den wesentlichen Ursachen hierfür zählt sicherlich, dass sich in der «Rushhour des Lebens» zwischen 30 und Mitte 40 alles um Leistung dreht. Außerdem ist sie von der Notwendigkeit geprägt, berufliche und private Herausforderungen in Einklang zu bringen. Für mehr Zufriedenheit im Alter machen Forscher dementsprechend vor allem altersbedingte Gelassenheit und die Korrektur überzogener Erwartungen verantwortlich.
Eine öffentliche Debatte, die von Negativvokabeln beherrscht wird, halte ich deshalb für verheerend, denn sie flüstert uns ein, das Alter sei notwendigerweise eine Zeit des Rückzugs, der schwindenden Möglichkeiten, wenn nicht gar des Siechtums. Aus der Psychologie wissen wir, dass unsere Erwartungen und Gedanken unser Handeln entscheidend mitbestimmen. Wem wiederholt suggeriert wird, dass er alt, nutzlos und hilflos ist, verhält sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechend. Legendär ist in diesem Zusammenhang ein Experiment der Harvard-Psychologin Ellen J. Langer aus dem Jahr 1979, bei dem sie die Hälfte der Bewohner eines Altenheimes mit Hilfe des entsprechenden Mobiliars und Radio- und Fernsehsendungen aus der Zeit in das Jahr 1959 zurückversetzte und ihnen gleichzeitig mehr Eigenverantwortung für ihren Alltag übertrug. Nach nur einer Woche fühlten sich die Teilnehmer des Experiments nicht nur jünger und fitter, sondern sie waren auch nachweislich aktiver als die Vergleichsgruppe, für die sich nichts geändert hatte. Gedächtnisleistung, Gelenkigkeit, selbst das Hörvermögen hatte sich messbar verbessert. Counterclockwise heißt das Buch, in dem Langer ihren gleichnamigen Ansatz ausführlich erläutert, auf Deutsch Die Uhr zurückdrehen (Langer 2011). In Kapitel 3 – Das gefühlte Alter wird dieses Experiment im Abschnitt «‹Schon alt› oder ‹noch jung›?» noch einmal ausführlich behandelt. An dieser Stelle bleibt festzuhalten: Was wir tun und können, hängt entscheidend davon ab, was wir uns zutrauen. Möglicherweise ist manch 75-Jähriger nur deshalb auf den Rollator angewiesen, weil ihm seine Umgebung vermittelt, in seinem Alter sei das zwar bedauerlich, aber «normal» – anstatt ihn zu ermutigen, nachlassende Kraft und Koordination durch regelmäßige Bewegung oder mit dem Gang ins nächste Fitnessstudio zurückzugewinnen. Keinesfalls ein Ding der Unmöglichkeit, wie folgende Anekdote eindrucksvoll unterstreicht: Ein Freund, Gründer einer Agentur für Personalentwicklung und Sponsoring im Leistungssport, erzählte mir von einem Foto, das ihm sein Physiotherapeut gezeigt hatte. Darauf zu sehen: eine 78-jährige Frau, die in den Niederlanden in ein Altersheim eingewiesen worden war. Aufgrund ihrer Osteoporose hatten ihr die Ärzte ein Korsett verordnet, um die Knochen zu stützen. Ihr Neffe, ebenfalls Physiotherapeut, schätzte dies bei einem Besuch als vollkommen falsche Herangehensweise ein, da die Knochen sich durch die nun fehlende Belastung (zusätzlich) abbauen würden. Er zeigte seiner Tante stattdessen Übungen, die sie täglich ausführte. Nach einigen Wochen wurde sie wieder aus dem Altersheim entlassen. Auf besagtem Bild sieht man die 78-Jährige übrigens routiniert eine 50-Kilo-Hantel über ihren Kopf stemmen!
Medizin und Sportwissenschaft bestätigen einhellig, dass maßvolles Training noch im hohen Alter erstaunliche Effekte haben kann – und zwar auch bei denjenigen, die Sport in den Jahrzehnten zuvor lediglich aus dem Fernsehen kannten. Nur haben heutzutage die meisten Menschen – und bei den 75-Jährigen sind es sicherlich die allermeisten! – beim Stichwort «Training» in aller Regel ambitionierte 20-, 30-, 40-Jährige im modischen Sportdress vor Augen und eben nicht den Senior oder die Seniorin mit grauen Haaren.
Doch zurück zu der Frage «Wann ist man alt?». Wie sieht es bei Ihnen selbst aus? Beginnt Ihr Alter mit 60 Jahren, mit 70 oder gar erst nach Ihrem 80. Geburtstag? Vielleicht befragen Sie sich kurz selbst, bevor Sie weiterlesen. Ein Blick in die Vergangenheit fördert Erstaunliches zutage. Pat Thane, Historikerin am Londoner King’s College, resümiert in ihrem Buch Das Alter. Eine Kulturgeschichte: «Als ‹alt› galt man fast immer und überall, wenn die eigenen Fähigkeiten nicht mehr ausreichten, sich selbst zu versorgen, das Überleben zu sichern.» In Antike wie Moderne, in Europa wie jenseits des Atlantiks herrschte bemerkenswerte Einigkeit darüber, dass man «frühestens zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr» alt ist (Thane 2005, S. 17). Alter wird also schon lange eher an individuelle Befindlichkeiten und Möglichkeiten geknüpft als an ein Geburtsdatum. Alltagsbeobachtungen stärken diese Auffassung. Ein 30-jähriger Alkoholiker, der seit Jahren auf der Straße lebt, wird an Körper und Geist wahrscheinlich älter sein als ein 70-Jähriger mit festem Dach über dem Kopf, der sich gesund ernährt und ausreichend bewegt. Wenn Ihnen dieser Vergleich zu krass ist, dann schauen Sie sich doch einfach einmal Fotos Ihres letzten Klassentreffens an. Wer bei einem 30- oder 40-jährigen Jahrgangstreffen seine ehemaligen Mitschülerinnen und -schüler wiedergesehen hat, stellt fest, dass Menschen, die früher «gleichaltrig» waren und aussahen, sich mit der Zeit auffällig auseinanderentwickelt haben. Es gibt die erstaunlich jung Gebliebenen, die durchschnittlich Gealterten und diejenigen, die «ganz schön alt aussehen».
Keine Frage: Wir altern sehr unterschiedlich. Doch laut der sogenannten Dänischen Zwillingsstudie (sie versammelt die Lebens- und medizinischen Daten von 75000 Zwillingen aus einer Zeitspanne von 130 Jahren – 1870 bis 2000) bestimmen die Gene – innerhalb gewisser biologischer Grenzen – nur etwa zehn Prozent der durchschnittlichen Lebenszeit eines Menschen. Für die restlichen 90 Prozent zeichnen wir selbst durch unseren Lebensstil verantwortlich. Auch wenn andere Studien zu dem Schluss kommen, dass statt zehn etwa 30 Prozent des Alterungsprozesses auf das Konto unserer Gene gehen (mehr dazu im nächsten Kapitel), lässt sich generell sagen: Der weit größere Anteil ist unter Einstellung und Lebensführung zu verbuchen. Die nackten Zahlen hingegen verraten nur wenig über unser Alter.
Insofern ist es nicht sonderlich überraschend, was eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Jahr 2012 zum Thema «Altersbilder der Gesellschaft» zutage förderte. Auf die Frage «Wann ist jemand für Sie alt?» werde heute immer seltener eine konkrete Zahl genannt: «Vielmehr wird der Begriff ‹Alter› zunehmend als Beschreibung nachlassender Vitalität am Lebensende verstanden.» Jemand gilt demzufolge für rund ein Drittel als «alt», wenn «Beeinträchtigungen auftreten», für ein weiteres Drittel, wenn er oder sie «auf Betreuung bzw. Pflege angewiesen» ist, und nur für das letzte Drittel, wenn «ein bestimmtes Lebensalter erreicht» ist. Im Verständnis vieler Menschen wäre jemand, der bis ins hohe Alter selbstständig und agil bleibt und dann krankheitsbedingt binnen weniger Wochen stirbt, nur während dieser letzten Krankheitswochen wirklich «alt». Entsprechend wollten 43 Prozent der Interviewten sich bei der Frage danach, wann «das Alter» denn beginne, auch auf ausdrückliche Nachfrage nicht auf eine bestimmte Zahl festlegen. Bei denjenigen, die sich zu einer Zahl durchrangen, verschob sich die angegebene Altersgrenze mit dem eigenen Lebensalter erwartungsgemäß nach hinten: Für Befragte zwischen 16 und 29 ist jemand im Schnitt mit 61 Jahren alt, für Befragte über 60 hingegen erst mit 76 Jahren (Institut für Demoskopie Allensbach 2012, S. 6ff.).
Lebensweisheiten und flotte Sprüche wie «60 ist das neue 50» oder «75 ist das neue 60» spiegeln dieses Verständnis ebenso wie der Kommentar eines jungen Hörers in einer Radiosendung zum Tode von Helmut Schmidt im November 2015. Der Altbundeskanzler sei mit 96 Jahren «jünger gewesen als drei 32-Jährige»! Aus dieser Warte ist eine gewisse Gebrechlichkeit allein noch kein Kriterium fürs Altsein, solange jemand im Geiste jung geblieben ist und es versteht, seine Lebenserfahrung in Weitsicht und Souveränität zu übersetzen und dabei ohne kleinliche Besserwisserei auszukommen. Wer Friedrich Nowottny (Jahrgang 1929), Peter Scholl-Latour (Jahrgang 1924) oder Margarete Mitscherlich (Jahrgang 1917) um ihr neunzigstes Lebensjahr herum in Interviews und Fernsehsendungen erlebte, wird dies nur bestätigen können. Genauso wie jeder, der Großeltern hatte, die sich aufrichtig für die Kindheitssorgen interessierten, Geschichten vorlasen, geduldig das Schachspielen erklärten oder bei den Hausaufgaben halfen. Und so fühlen sich tatsächlich immer weniger Menschen in der zweiten Lebenshälfte alt, ganz einfach, weil ihr Aktionsradius sich gegenüber dem früherer Generationen vergrößert hat, weil der medizinische Fortschritt viele ihrer Beschwerden lindert und weil die ersten echten Gebrechen erst sehr spät einsetzen, mit etwas Glück weit jenseits der 80.
Lebensphasen und Lebensverläufe früher und heute
Bis ins 19. Jahrhundert hinein betrug die mittlere Lebenserwartung in Europa nur 40 bis 45 Jahre. Inzwischen hat sich die durchschnittliche Lebensspanne hierzulande fast verdoppelt, auf knapp 78 Jahre bei Männern und knapp 83 Jahre bei Frauen. Die schockierend niedrige Zahl vergangener Zeiten wird allerdings durch die seinerzeit sehr hohe Säuglingssterblichkeit verzerrt. «Wer zu vorindustrieller Zeit die ersten Lebensjahre überstand und das Erwachsenenalter erreichte, hatte durchaus gute Chancen, 60 Jahre oder älter zu werden», resümiert Pat Thane (2005, S. 9). Seit dem 16. Jahrhundert gab es daher in Europa bildliche Darstellungen des Älterwerdens, die den Lebensweg von der Geburt bis ins hohe Alter dokumentierten. Im 19. Jahrhundert wurden diese sogenannten Lebenstreppen in großen Auflagen gedruckt, sie hingen in zahlreichen Wohnstuben und Werkstätten und prägten das Bild der Menschen vom Alter entscheidend mit. Was auf ihnen zu sehen ist? Wie das Stichwort «Treppe» vermuten lässt, geht es erst einmal aufwärts, meist in Zehnerschritten: «Zehn Jahr ein Kind / Zwanzig Jahr ein Jüngling / Dreißig Jahr ein Mann / Vierzig Jahr wohlgetan / Fünfzig Jahr stille stahn», heißt es erläuternd zu einer dieser Abbildungen, auf der die Stufen nacheinander vom Schulkind, Soldaten/Studenten, Verehrer, Bräutigam und gesetzten Herrn besetzt sind. Von da an geht es dann wieder stetig abwärts: «Sechzig Jahr geht’s Alter an / Siebzig Jahr Greis / Achtzig Jahr weiß / Neunzig Jahr Kinderspott / Hundert Jahr Gnade von Gott».
Während der 60-Jährige noch weise in die Ferne blickt, wird der Rücken anschließend immer krummer, bis der Stock durch Krücken ersetzt wird. Am Ende steht schließlich der hilflose Alte, das Schreckgespenst des Alters bis in unsere Tage (vgl. Lucke et al. 2009, S. 136). Im kollektiven Gedächtnis wurde das Alter so als Phase des Abstiegs und des Verlusts verankert, und zwar sowohl im Leben der Männer als auch in dem der Frauen. Die weibliche Lebenstreppe orientierte sich entsprechend der gesellschaftlichen Rolle an Familienpflichten (Heirat, Kindererziehung, Betreuung der Enkel), mündete aber ebenfalls unweigerlich in Siechtum und Hilflosigkeit. Unter solchen Vorzeichen ist das Erreichen eines hohen Alters vielleicht wirklich nur bedingt erstrebenswert. Dass hinter dieser Abwertung des Alters aber auch handfeste wirtschaftliche Absichten steckten, nämlich der Appell an die ältere Generation, den Nachfolgenden beizeiten Vermögen und Wirtschaft zu überlassen, wurde dabei nicht offen thematisiert (vgl. Ehmer 2008, S. 52). Und auch in unserer Zeit ist vielen Jüngeren der Wunsch nicht fremd, «die Alten» sollten sich in ihre Rolle fügen und sich beizeiten aufs «Altenteil zurückziehen».
Offenbar haben unsere Vorstellungen vom Alter noch einiges gemeinsam mit den Lebenstreppen des Biedermeiers – etwa jene, was sich in welcher Lebensphase «gehört» und was nicht. So verbannen diese Bilder das Turteln in die Jugend und legen nahe, dass das mittlere Lebensalter in erster Linie dem Tätigsein gewidmet ist, während das letzte Lebensdrittel allein dem Ruhestand im Schaukelstuhl oder Fernsehsessel gehört.
Verliebte «Greise», die sich der Lächerlichkeit preisgeben, malten schon Lucas Cranach der Ältere wie auch sein Sohn Lucas Cranach der Jüngere im 15./16. Jahrhundert (z.B. «Der alte Narr», «Die verliebte Alte»). Im 20. Jahrhundert beschrieb dann Bertolt Brecht in seiner Erzählung «Die unwürdige Greisin» (1939), wie die Kinder einer vitalen 72-Jährigen sich darüber empören, dass die Mutter nach einem langen arbeitsreichen Leben endlich ihre Unabhängigkeit genießt. Ihr vermeintlich «unwürdiges» Verhalten besteht vor allem darin, dass sie das große Haus nicht für einen ihrer Söhne und dessen Familie räumt, obwohl diese in recht bescheidenen Verhältnissen lebt, und jeden zweiten Tag im Restaurant isst, statt ihr Geld für die Erben zu sparen. Und auch als man vor gut zwei Jahrzehnten die «Älteren» mit Mitte 50 scharenweise in den Vorruhestand schickte, um «Platz zu machen für die Jungen», fragte kaum jemand laut und öffentlichkeitswirksam nach, ob man in diesem Alter nicht doch mehr leisten kann als Rasen mähen, Kreuzworträtsel lösen und ZDF gucken.
Dabei kann man es gar nicht deutlich genug sagen: Altersstufen und -phasen sind willkürliche Setzungen, die der tatsächlichen Verschiedenartigkeit von Persönlichkeiten, Kompetenzen und Lebensbedingungen nicht ansatzweise gerecht werden. Das gilt für die ersten Lebensjahre, wo noch nicht jeder mit sechs «reif» für die Schule ist, während mancher sich schon mit vier im Kindergarten langweilt. Und auch die merkwürdig widersprüchlichen Bestimmungen im deutschen Recht unterstreichen dies auf anschauliche Weise. So ist man mit Vollendung des 14. Lebensjahres zwar straf- und religionsmündig, darf Filmveranstaltungen aber nur bis 22 Uhr besuchen. Mit 16 wird man dann erst zwei Stunden später, um Mitternacht, aus Gaststätten und Kinos verbannt, kann aber den Segelflugschein machen und unter Auflagen heiraten. Da kann man sich schon mal die Frage stellen: Werden verheiratete Sechzehnjährige auch um 24 Uhr nach Hause geschickt? Noch offensichtlicher wird es bei der Bekleidung öffentlicher Ämter: Bürgermeister kann man in Bayern nämlich bereits mit 21, in Nordrhein-Westfalen mit 23 und in Baden-Württemberg erst mit 25 Jahren werden. Heißt das etwa, in Baden-Württemberg leben mehr Spätentwickler? Genauso lange, nämlich bis 25, können Eltern unter bestimmten Bedingungen wiederum Kindergeld für ihr Kind beziehen.
All dies deutet darauf hin, dass es im jungen Alter eine ganze Fülle von Lebenssituationen und Persönlichkeitsformen gibt. Dessen ungeachtet wird das Alter gern über einen Kamm geschoren, als seien «die Alten» eine uniforme Masse in Grau und Beige. So beträgt das Höchstalter für die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat in Hessen 67 Jahre, Schöffe und Notar darf man bundesweit nur bis 70 sein. Konrad Adenauer, der 1949 mit 73 Jahren erstmals zum Bundeskanzler gewählt und noch zwei weitere Male (1957 und 1961) in diesem Amt bestätigt wurde, hätte also keine Chance gehabt, Schöffe an einem Amtsgericht in der deutschen Provinz zu werden.
Es ist wohl vor allem dem demographischen Wandel und dem in manchen Arbeitsfeldern herrschenden Fachkräftemangel zu verdanken, dass man heute, wenn auch zögerlich, beginnt, über einen flexiblen Renteneintritt und variable Arbeitszeitmodelle nachzudenken, die der tatsächlichen Bandbreite des Alterns angemessen sind. (Mehr dazu in Kapitel 4 – Das soziale Alter.)
Wie könnte ein plausibles Gegenmodell zur Lebenstreppe in unseren Köpfen aussehen? Für Erik Erikson, einen angesehenen Psychologen, der unter anderem in Berkeley und Harvard lehrte, ist das Leben keine Treppe, die nach Erreichen des Plateaus in der Lebensmitte wieder nach unten führt. Erikson geht vielmehr von einer stetigen Entwicklung aus, einem Weg des Lebens, auf dem in jeder Phase Höhen und Tiefen zu meistern sind. Eriksons «Lebenswanderung» verläuft in acht Etappen vom Säuglingsalter bis zum Alter, das für ihn in Anlehnung an das klassische Rentenalter mit 65 beginnt. Jede dieser Entwicklungsphasen ist durch typische Herausforderungen und Krisen gekennzeichnet: So muss das Kleinkind lernen, sich von der Mutter zu lösen und ein autonomes Ich zu entwickeln, während das Schulkind etwas leisten möchte und Selbstbewusstsein entwickelt, wenn es sich als erfolgreich erlebt und Versagensängste überwindet. Die Herausforderungen des Alters bestehen nach Erikson vor allem darin, das bisherige Leben mit all seinen positiven und weniger positiven Bestandteilen zu akzeptieren sowie ein übergeordnetes Interesse an Mensch und Gesellschaft auszubilden. Gemeint ist damit der Blick über den familiären Tellerrand hinaus und der Wunsch, erworbenes Wissen weiterzugeben. Werden diese Anforderungen positiv bewältigt, erwachsen daraus Weisheit und Integrität. Scheitert der alternde Mensch und hadert mit seinem Leben, drohen Verzweiflung und Lebensekel. Wem es allerdings gelingt, mit dem Alter persönlich zu reifen, ist anschließend umso mehr in der Lage, sich auf andere einzulassen und empathisch auf sie zu reagieren – dafür liefert auch die Hirnphysiologie Indizien (vgl. Korte 2014, S. 190ff.). Eriksons Botschaft ist klar: In jeder Phase kann sich ein Mensch entwickeln, neu positionieren und seine Persönlichkeit um neue Facetten bereichern.[*] Mit 80 Jahren ein Unternehmen zu leiten mag nur wenigen möglich sein. Doch 80-Jährige haben das Potenzial, einen Beitrag zu leisten und anderes zu geben als 30-Jährige (siehe Kapitel 2 – Das biologische Alter).
Das Leben ist gerecht! Es nimmt uns stetig bestimmte Möglichkeiten, unbestritten, aber es gibt uns auch laufend neue: Schon ab dem dritten Lebensjahr können wir keine echte Zweisprachigkeit mehr entwickeln, schon mit 25 schlägt uns jeder 5-Jährige beim Memoryspielen und mit 40 können wir nicht mehr das Wochenende durchtanzen und montags fit zur Arbeit gehen. Dafür können wir mit 60 die Lebenserfahrung verbuchen, die uns in komplexen Situationen erfolgreicher entscheiden lässt als mit 20, und mit 70 vielleicht so viel Abstand zu uns selbst entwickeln, dass wir anderen toleranter, empathischer und großzügiger begegnen als jeder 40-Jährige.
15. Januar 2009: Die Bilder gingen um die Welt. Wenige Tage vor seinem 58. Geburtstag gelang es Chesley B. Sullenberger, einen Airbus 320 notzulanden – mitten in New York City auf dem Hudson River. Die Passagiere harrten nach der Evakuierung des Flugzeugs im Fluss oder auf den Tragflächen aus, bis sie von herbeieilenden Schiffen gerettet wurden. Erforderlich wurde die spektakuläre Notwasserung durch Vogelschlag und Schubausfall auf beiden Triebwerken kurz nach dem Start im New Yorker Flughafen LaGuardia. Alle 150 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder überlebten. Ob einem 30-jährigen Piloten mit weniger Flugerfahrung dieses Kunststück auch gelungen wäre, ist zweifelhaft.
Jugend ist nicht immer ein Vorteil, Alter nicht immer ein Nachteil. Bergsteiger nähmen nur ungern Kletterer unter 25 auf schwierige Bergtouren mit, berichtete einmal Paul Baltes, inzwischen verstorbener Nestor der Altersforschung in Deutschland. Ihre Risikobereitschaft sei zu hoch und könne die gesamte Gruppe in Gefahr bringen (Baltes 2010, S. 234/Nachdruck von 2004). Bevor Missverständnisse aufkommen: Es geht hier nicht darum, die Generationen gegeneinander auszuspielen, sondern darum, ein einseitig negatives und damit den Einzelnen einengendes Altersbild wieder geradezurücken.
Interessant ist auch die Frage, wie viele Phasen ein Leben überhaupt hat. Erikson postulierte wie erwähnt acht: Säuglingsalter, Kleinkindalter, Spielalter, Schulalter, Adoleszenz, frühes Erwachsenenalter (Zeitraum, in dem man einen Partner bzw. eine Partnerin findet), Erwachsenenalter und Alter. In den 1960er Jahren brachte er damit das Leben jenseits der 65 unter einen einzigen großen Hut. Heutige Wissenschaftler sehen das weitaus differenzierter. Das hängt sowohl mit der gestiegenen Lebenserwartung als auch mit der größeren Fitness der «Seniorinnen und Senioren» zusammen. Innerhalb von 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung in Westeuropa von gut 40 auf rund 80 Jahre nahezu verdoppelt. Für Deutschland verzeichnete das Statistische Bundesamt Anfang 2015 eine mittlere Lebenserwartung von 82 Jahren und 10 Monaten für Frauen, bei den Männern waren es 77 Jahre und 9 Monate (Pressemitteilung Nr. 143 vom 22.04.2015). Dabei werden immer mehr Menschen weit älter als 80 Jahre. Darüber hinaus habe sich die Sterblichkeit der über 80-Jährigen seit den 1960er Jahren in vielen Ländern mehr als halbiert, meldeten Rostocker Demographie-Forscher Anfang 2013.[*] Allein die Zahl der 100-Jährigen hat sich in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2010 mehr als verdoppelt, und zwar von knapp 6000 auf über 13000, so die Zweite Heidelberger Hundertjährigen-Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung 2013. Viel spricht dafür, dass sich diese Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen wird.
Es gibt also immer mehr Menschen, die erfreulich lange leben. Zudem stellt sich das Leben mit 85 für die meisten anders dar als mit 65. Die gute Nachricht ist: Sehr viele von uns bekommen im Vergleich zu unseren Großeltern zwei überwiegend gesunde Lebensjahrzehnte zusätzlich. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen daher inzwischen vom «dritten Lebensalter» (bis um die 80 Jahre) und vom «vierten Lebensalter» (ab etwa 80 Jahren), dementsprechend auch von «jungen Alten» und «alten Alten». 20 Jahre mehr Leben! Stellen Sie sich bitte für einen kurzen Moment vor, was Sie in dieser Zeit noch alles tun, erleben, anstoßen können. Was hat sich in den letzten 20 Jahren für Sie getan? Was könnte sich also in den nächsten 20 Jahren nicht alles tun? Vorausgesetzt natürlich, Ihre Planung für die zweite Lebenshälfte endet nicht bei einem diffusen «Wenn ich erst mal in Rente bin, will ich endlich gar nichts machen». Dass die meisten von uns mehr Leben geschenkt bekommen, ist leider erst in wenigen Köpfen angekommen. Viele von uns stecken noch in den Denkmustern unserer Großeltern fest, denen nach vielen Jahren oft körperlich harter Arbeit nur ein paar Jahre blieben, die sich prima mit Ausruhen auf der Gartenbank füllen ließen. Und so stolpern wir buchstäblich planlos in einen sehr viel längeren Lebensabschnitt.
In der US-Komödie Man lernt nie aus (Originaltitel: The Intern, 2015) spielt Robert de Niro einen 70-Jährigen, der nach über 40 Jahren als Vertriebsleiter bei einer Telefonbuchfirma in den Ruhestand geht. Nach wenigen Wochen langweilt der Witwer sich allerdings schrecklich. Daran ändern auch die Reisen nichts, die er nun endlich unternimmt. Denn wenn die Wohnungstür nach der Rückkehr wieder hinter ihm ins Schloss fällt, kehrt schlagartig auch die Langeweile zurück. Schließlich beginnt er ein Seniorenpraktikum in einem Internet-Start-up, wo seine Lebenserfahrung nach einigen Tagen des Fremdelns plötzlich gefragt ist. Unterhaltungskino, zugegeben. Doch wie wäre es bei Ihnen, sobald Sie die Abschiedsfeier anlässlich Ihres Rentenstarts im Unternehmen hinter sich haben? Wie sieht Ihr Plan aus? Wer mit 50 erste Überlegungen anstellt, wie sein Wunschleben mit 80 aussehen könnte, ist eindeutig im Vorteil.
Das sogenannte vierte Lebensalter beginnt für Soziologen und Altersforscher wie Paul Baltes mit etwa 80 Jahren. Formaler Anhaltspunkt ist, dass zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Menschen der eigenen Alterskohorte gestorben ist. Ab 80, spätestens ab 85 spricht man von «Hochaltrigkeit». Verlängert sich die Lebenserwartung weiter, wovon auszugehen ist, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht erst 90- oder 100-Jährige als hochaltrig ansehen.
Für den niederländischen Mediziner Rudi Westendorp kommt es darauf an, im dritten Lebensalter ein möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen, während das vierte Lebensalter, das häufig von Gebrechlichkeit begleitet wird, davon geprägt ist, die persönliche Handlungsfähigkeit so gut es geht aufrechtzuerhalten (Westendorp 2015, S. 214ff.). Viele Leserinnen und Leser nehmen solche Botschaften vielleicht mit gemischten Gefühlen auf. Kein Wunder, wir haben ja auch eine jahrelange mediale «Gehirnwäsche» hinter uns, die uns bei «85» an Schnabeltasse und Rollator, wenn nicht gar ans Pflegeheim denken lässt, statt uns die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich genau dies verhindern lässt. Dass das geht und selbst die jüngsten starren Phasenmodelle des Lebens mit Vorsicht zu genießen sind, zeigen die Beispiele im nächsten Abschnitt.