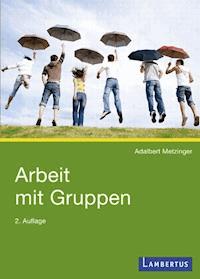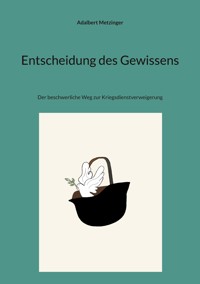
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch erzählt die Geschichte des Autors von seiner Kriegsdienstverweigerung ab der Antragsstellung 1969 bis zur Anerkennung 1975. Von der Wehrerfassung und Musterung bis zu den Verhandlungen vor dem Prüfungsausschuss, der Prüfungskammer und dem Verwaltungsgericht werden wesentliche Stationen seiner Gewissensentscheidung geschildert. Ebenso wird von dem Engagement des Autors innerhalb der DFG-VK und der Friedensbewegung berichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Geschichte der Kriegsdienstverweigerung in der BRD
3. Anerkennungsverfahren
3.1 Wehrerfassung und Musterung
3.2 Eignungs- und Verwendungsprüfung (EVP)
3.3 Begründung meines KDV-Antrags
3.4 Prüfungsausschuss
3.5 Fragen und Themen in den KDV-Prüfungsverfahren
3.6 Prüfungskammer
3.7 Glaubwürdigkeit des Kriegsdienstverweigerers
3.8 Verwaltungsgericht
3.9 Zahlen zur Kriegsdienstverweigerung
3.10 Einberufungsbescheide
3.11 Musterungen
4. Engagement für die Kriegsdienstverweigerung
4.1 Arbeitskreis Kriegsdienstverweigerung Ottersweier
4.2 Arbeitskreis Kriegsdienstverweigerung Bühl
5. Inhaftierte Kriegsdienstverweigerer in der Bundesrepublik Deutschland
6. Letzte Aktionen
7. Beratung und Beistand
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Seit ich meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung beim Kreiswehrersatzamt Offenburg 1969 einreichte, befand ich mich in einer über fünf Jahre dauernden Auseinandersetzung mit der Institution Bundeswehr, um meine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu erreichen. Während dieses langwierigen Konfliktprozesses sammelte ich viele Unterlagen, die teils von mir, teils von verschiedenen Stellen der Bundeswehr, Gerichten und Rechtsanwälten stammen. Meine Geschichte dokumentiert die bürokratischen Hürden der Kriegsdienstverweigerung und das fragwürdige Inquisitionsverfahren, aber auch die persönlichen Schwierigkeiten wie z. B. Ängste, psychische Belastung, Frustrationen und Stress bis zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ab dem Anfang meiner Kriegsdienstverweigerung fühlte ich mich besonders in meinem Heimatort als jemand, der von der Norm bezüglich der Ableistung des Wehrdienstes ab-weicht. War ich doch der erste in Ottersweier, der den Kriegsdienst verweigerte. Mit dieser Entscheidung stieß ich bei einem Teil der jüngeren, aber mehr noch bei älteren Dorfbewohnern auf Ablehnung. Häufig wurde mein Vater als langjähriger Gemeinderat und Stiftungsrat der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes wegen meiner Kriegsdienstverweigerung angesprochen. Erfreulicherweise hat er mich und meine Entscheidung aber gegenüber Kritik immer verteidigt, was mir den wichtigen familiären Rückhalt auch in der Öffentlichkeit gab. Selbst in meiner Klasse am Wirtschaftsgymnasium Rastatt hatte ich bezüglich Kriegsdienstverweigerung eine Sonderrolle, denn von den 19 männlichen Mitschülern verweigerte kein einziger. Mit meiner Kriegsdienstverweigerung stand ich in Ottersweier am Anfang allein auf weiter Flur. Später, besonders nachdem ich im September 1971 den KDV-Arbeitskreis in Ottersweier ins Leben gerufen hatte, fanden sich in meiner Heimatgemeinde zunehmend Mitstreiter und weitere Kriegsdienstverweigerer. Meine Kriegsdienstverweigerung war keine Entscheidung im luftleeren Raum, sondern war bestimmt von den Erfahrungen meiner Erziehung, von der Auseinandersetzung mit mir selbst und der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung. Wegweisend stellte ich mir dabei die Frage: „Kann ich es vor meinem Gewissen verantworten am Kriegsdienst, ganz gleich in welcher Form, teilzunehmen?“ Wer wie ich als Kriegsgegner nach seiner ehrlichen Überzeugung den Krieg dem Bereich des Bösen zuordnet und ihn als ein Verbrechen an der Menschheit im Sinne eines in sittlicher Hinsicht besonders verwerflichen Verhaltens einstuft, für den ergibt sich aus der Natur der Sache ein seelischer Zwang zur Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe. Im Rahmen meiner politischen Bewusstseinsbildung konnte ich in vielen persönlichen Gesprächen innerhalb meiner Familie, mit Freunden, Bekannten und Mitschülern meine Position zur Kriegsdienstverweigerung offensiv vertreten. Mein individueller Einsatz für meine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer führte zu einer nachhaltigen Beschäftigung mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung. Die Erfahrungen mit meiner Kriegsdienstverweigerung motivierten mich spätestens aber 1971 zu einem politischen Engagement in antimilitaristischen Gruppen (Arbeitskreise, VK, DFG-VK). Dadurch konnte ich mit den verschiedenen Gruppierungen und unterschiedlichen Aktionen in der Öffentlichkeit für die Kriegsdienstverweigerung Gehör verschaffen und relativ viele junge Männer auf die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung aufmerksam machen. Der Prozess meiner Politisierung im Zusammenhang mit meiner Kriegsdienstverweigerung wurde aber auch durch die Studenten- und Schülerbewegung gegen Ende der 1960er Jahre unterstützt.
Aus heutiger Sicht ist diese Form der Kriegsdienstverweigerung ein historisch interessantes, zugleich aber auch ein in unserer Gesellschaft weitgehend verschwundenes Thema. Die Kriegsdienstverweigerung stellte anfangs in der Bundesrepublik Deutschland ein Novum dar, das es vorher so im deutschen Militär noch nicht gegeben hatte. Die geschichtliche Bedeutung der Kriegsdienstverweigerung liegt nicht nur in der Vergangenheit, sondern sollte auch auf die Gegenwart zielen, um spezielle Probleme eines Teils von jungen Menschen in Erinnerung zu rufen und auf dieses wichtige Grundrecht aktuell hinzuweisen. Seit 1990 am Ende des Ost-West-Konflikts hat sich das Aufgabenspektrum der Bundeswehr stark verschoben, denn die Neuausrichtung der Bundeswehr richtete sich von nun an vermehrt auf Auslandseinsätze wie z. B. in Afghanistan und Mali. Seit 1992 bis 2019 kamen bei diesen Einsätzen 114 Soldaten ums Leben. Diese Toten sollten auch eine Mahnung sein, dass seit der Einführung einer Freiwilligenarmee im Jahr 2011 das Recht auf Kriegsdienstverweigerung sich primär auf aktive Soldaten und Reservisten richtet, aber von diesem Personenkreis kaum wahrgenommen wird. So haben z. B. vom Juli 2011 bis Juni 2014 nur 115 Soldaten einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt (davon 13 Soldatinnen).
Seit Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen hat, sind Kriegsdienstverweigerung und Desertion, besonders in der Ukraine und Russland sowohl für mögliche Wehrpflichtige als auch für Soldaten, ein wichtiges Thema. So haben z. B. etwa 3 000 Männer aus der Ukraine, die in diesem Krieg nicht kämpfen wollten, in Moldawien Asyl beantragt. Im Mai und Juni 2022 wurden in der Ukraine ein Kriegsdienstverweigerer zu drei Jahren Haft auf ein Jahr Bewährung und im anderen Fall zu vier Jahren auf drei Jahre Bewährung verurteilt. In der Ukraine gibt es zwar ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber das ukrainische Verteidigungsministerium hat Anfang September 2022 offiziell bestätigt, dass die Möglichkeit zum Verweigern des Kriegsdienstes bereits seit Kriegsbeginn ausgesetzt wurde. Auf russischer Seite gibt es ebenfalls Wehrdienstflüchtlinge, die sich rechtzeitig den Rekrutierungen zu Militär und Krieg durch die Flucht ins Ausland entzogen und dort um Asyl gesucht haben. Wie wir es in Deutschland mit Deserteuren halten, besonders mit Blick auf russische Verweigerer, hat bei Medien und Politik zu einer komplexen Diskussion geführt. Bekannt ist, dass von 2 500 Anträgen auf Asyl durch russische Kriegsdienstverweigerer bislang gerade mal 55 anerkannt wurden (vgl. Bochow, Acher- und Bühler Bote, 02.06.2023). Diese geringe Zahl ergibt sich aus dem Umstand, dass Wehrdienstverweigerung und Desertion in Deutschland kein Asylgrund sind. Auch in Deutschland hat der Krieg in der Ukraine das Thema Kriegsdienstverweigerung neu entfacht, denn seit Ausbruch dieses Krieges ist erstmals wieder die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland deutlich gestiegen.
Schlagzeilen wie z. B. „Immer mehr Bundeswehrsoldaten verweigern den Dienst“ weisen darauf hin, dass vermehrt Soldatinnen und Soldaten aus dem Dienst entlassen werden wollen. Auch bei Reservisten und Ungedienten haben die Verweigerer zugenommen. Die Zahl der Verweigerungen erhöhte sich von 209 im gesamten Jahr 2021 auf 1 042 (223 Soldatinnen und Soldaten, 266 Reservistinnen und Reservisten und 593 Ungediente) im Jahr 2022. Bei den Ungedienten waren 2021 nur 23 Anträge eingegangen. Die meisten Antragsteller begründeten ihre Verweigerung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YOUGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wäre im Falle eines Angriffes auf Deutschland nur jeder Zehnte Deutsche zum Kriegsdienst bereit (Februar 2023). Freiwillig würden sich allerdings nur fünf Prozent der Deutschen zum Kriegsdienst melden. Fast jeder vierte Deutsche (24 Prozent) würde im Kriegsfall so schnell wie möglich das Land verlassen. Die Ergebnisse weisen auf eine gestiegene Angst der deutschen Bevölkerung vor einer militärischen Konfrontation hin. Der Krieg in der Ukraine hat zudem das Thema Kriegsdienstverweigerung in Deutschland wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Die Umfrageergebnisse deuten auf eine äußerst geringe Bereitschaft zum Kriegsdienst hin und die angestiegene Zahl der Kriegsdienstverweigerer im Jahr 2022 zeigen, dass sich besonders jüngere Menschen mit der Kriegsdienstverweigerung auseinandersetzen.
Dieses Buch schildert den beschwerlichen Weg und meine dabei gemachten Erfahrungen hin zu meiner Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ebenso wird das sich daraus entwickelnde politische Engagement auf dem Gebiet der Kriegsdienstverweigerung berücksichtigt. In die Darstellung fließen sowohl subjektive Erinnerungen als auch sachbezogene Informationen mit ein. Das Buch erhebt weder den Anspruch auf eine umfassende und repräsentative Analyse noch auf eine wissenschaftliche Bewertung der Kriegsdienstverweigerung.
2. Geschichte der Kriegsdienstverweigerung in der BRD
In der Geschichte Deutschlands war bis 1945 im Fall eines Krieges eine Kriegsdienstverweigerung nur durch eine Desertion möglich. Im Ersten Weltkrieg wurde Kriegsdienstverweigerung als Fahnenflucht oder Landesverrat mit Zuchthaus bestraft. Im NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kriegsdienstverweigerung als Wehrkraftzersetzung meistens mit der Todesstrafe geahndet. Die NS-Justiz hat ab dem Beginn des Zweiten Weltkriegs mindestens 30 000 Deserteure zum Tode verurteilt und ungefähr 23 000 derartige Urteile wurden auch vollstreckt. Insgesamt sind etwa 350 000 bis 400 000 deutsche Soldaten desertiert. Das entspricht bei rund 18,2 Millionen Soldaten einer Desertionsquote von ca. zwei Prozent. Unter dem Eindruck der Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur während des Zweiten Weltkriegs hielt die Mehrheit des Parlamentarischen Rates einen verfassungsrechtlichen Schutz der Kriegsdienst-verweigerung für geboten. Auf Antrag der SPD wurde im April 1948 im Parlamentarischen Rat die Aufnahme eines Satzes, der in das 1949 verabschiedete Grundgesetz aufgenommen wurde, formuliert: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen wer-den“ (Art. 4 Abs. 3 GG). Damit war das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgrün-den ein echtes Grundrecht geworden, dessen zentraler Zweck es war, den Einzelnen vor dem Zwang zu bewahren, töten zu müssen. Das Grundgesetz von 1949 sah ursprünglich für den neu zu gestaltenden Staat eine eigene Armee nicht vor. Die Mehrzahl der Bevölkerung lehnte in den ersten Nachkriegsjahren eine Wiederbewaffnung ab, so wie z. B. auch der spätere Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß: „Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen“ (Der Spiegel, 02.01.1957). Seit 1950 wurde der Ruf nach einer eigenen Wehrmacht unter Bundeskanzler Adenauer stärker. Dies führte zu kontrovers geführten Debatten, was aber trotzdem 1955 zum Beginn der Aufstellung der Bundeswehr führte. Bereits 1954 war die Bundesrepublik Deutschland der NATO beigetreten.
Das im Juli 1956 verabschiedete Wehrpflichtgesetz legte bezüglich der Kriegsdienstverweigerung in § 25 fest: „Wer sich aus Gewissengründen der Beteiligung an jeder Waffenanwendung zwischen den Staaten widersetzt und deshalb den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, hat statt des Wehrdienstes einen zivilen Ersatzdienst außerhalb der Bundeswehr zu leisten.“ Der Wehrersatzdienst bzw. Zivildienst wurde erst 1961 bundesweit eingeführt. Dieser „Abschreckungsdienst“ dauerte aber immer einige Monate länger als der Dienst bei der Bundeswehr. Von vornherein wurden aber die Kriegsdienstverweigerer in eine Außenseiterrolle gedrängt und galten sogar als „systemzersetzend“. Gängige Bezeichnungen waren: Schwächlinge, Feiglinge, Drückeberger, Vaterlandsverräter usw. Bis etwa 1968 machten nur wenige Wehrpflichtige von ihrem Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch, weshalb bis etwa 1968 die Zahl der Verweigerer recht niedrig blieb. Andererseits wurden aber 1963 noch 90 Prozent aller Antragssteller anerkannt. 1968 erhielten bereits weniger als zwei Drittel eine Anerkennung und im Jahr 1970 wurden erstmals weniger als die Hälfte anerkannt. Insbesondere durch die Studentenbewegung, damit zusammenhängende veränderte Einstellungen zu Gesellschaft und Staat und den Vietnam-Krieg wurde vielen jungen Männern bewusst, dass sie nicht mehr so unkritisch und konformistisch zur Bundeswehr gehen wollten. Dadurch bedingt erhöhte sich die Anzahl der Kriegsdienstverweigerer zunehmend. Viele zogen auch damals nach Westberlin, weil diese Stadt von der Wehrpflicht ausgenommen war.
„Wem bewusst ist, dass er im Atomzeitalter lebt,
und sich dem Militärdienstzwang nicht widersetzt –
Wer gedankenlos in die Kaserne trottet,
obwohl er den Kriegsdienst verweigern kann –
den kann ich nicht einmal mehr bedauern.
Der hat nur durch einen Irrtum sein Großhirn bekommen,
das Rückenmark hätte ihm vollkommen genügt.“
(Albert Einstein)
Erst 1983 wurde die Gewissensprüfung weitgehend abgeschafft und durch ein schriftliches Anerkennungsverfahren ersetzt. Dadurch bedingt stieg die Anerkennungsquote im schriftlichen Verfahren auf über 90 Prozent. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 entstand eine Berufsarmee, wodurch sich die Kriegsdienstverweigerung in erster Linie nur noch auf aktive Soldaten und Reservisten bezog.
3. Anerkennungsverfahren
Es war der 10. Dezember 1969, als ich meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellte. Er wurde von mir per Einschreiben mit dem folgenden Wortlaut an das zuständige Kreiswehrersatzamt Offenburg gerichtet:
„Hiermit beantrage ich meine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen gemäß Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und gemäß § 25 des Wehrpflichtgesetzes.“
Als ich abschließend den Antrag mit meinem Namen unterschrieben hatte, fiel mir ein schwerer Stein vom Herzen. Obwohl ich bereits bei der Wehrerfassung und der Musterung gewisse allgemeine Vorbehalte gegenüber dem Wehrdienst hegte, hatte ich bei den ersten konkreten Berührungspunkten mit der Institution Bundeswehr mein Gewissen nicht sonderlich gespürt und mich mit der speziellen Problematik kaum auseinandergesetzt. Einerseits hatte ich es irgendwie verbummelt und andererseits kreisten meine Gedanken im Alltagstrott viel zu häufig um andere Sachen bzw. Themen. Meine damalige Mentalität wichtige Entscheidungen gerne solange wie möglich hinauszuschieben und der Umstand, dass ich wegen des Schulbesuchs vorerst wegen meiner Zurückstellung sowieso nicht eingezogen werden konnte, hatten meinen Klärungsprozess und meine Gewissenserforschung zum geeigneten Zeitpunkt verzögert. Leider erfuhr ich erst später, dass ein bei der Wehrerfassung oder bei der Musterung gestellter Antrag vor der Einberufung zur Bundeswehr schützte, denn er hat dann eine „aufschiebende Wirkung“, die bis zur 2. Instanz – der Prüfungskammer – bestehen blieb. Wer also später verweigert, kann ohne Rücksichtnahme auf seinen Antrag und ohne „Gewissensprüfung“ einberufen werden. Außerdem verleiht der frühzeitig gestellte Antrag eine bessere Ausgangsposition im Anerkennungsverfahren, da die Glaubwürdigkeit des Verweigerers bei früher Antragsstellung meistens weniger angezweifelt wird als bei späterer Antragstellung. Deshalb war mir jetzt bei meiner Entscheidung den Kriegsdienst zu verweigern bewusst, dass ich auch vor meiner Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zur Bundeswehr einberufen werden konnte. Bedauerlicherweise fing ich erst nach meiner Musterung richtig an, mich mit der Problematik Kriegsdienstverweigerung zu beschäftigen. Danach reifte bei mir innerhalb von ca. neun Monaten intensiver Erforschung dieses Themas meine Entscheidung und der nicht immer leichte Klärungsprozess führte endgültig zu meinem Entschluss, den Kriegsdienst zu verweigern. Rückblickend muss ich gestehen, dass ich noch recht uninformiert und oberflächlich zur Kriegsdienstverweigerung stand, als ich das erste Mal mit der Bundeswehr konfrontiert worden war. Ich meine damit die sogenannte „Aufforderung zur Wehrerfassung“.
Seit Bildung der Bundeswehr und der damit verbundenen Wehrpflicht im Jahr 1956 verweigerte bis 1967 nur eine kleine Minderheit. Erst ab 1968 stieg die Zahl der Verweigerer deutlich an, denn die Zunahme von 5 963 (1967) auf 11 952 (1968) bedeutete eine Erhöhung von 5 989 Anträgen, was er einer Verdoppelung gleichkam. 1969 betrug die Zahl der Kriegsdienstverweigerer 14 420, zu denen ich nun auch gehörte. Die KDV-Anträge stiegen 1977 auf 69 969 und 1989 auf 77 400 an. Während des 2. Golfkrieges im Jahr 1991 erhöhten sich die Antragszahlen auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer auf die „Rekordmarke“ von 151 212. Zwischen dem 01.01.2002 und dem 31.12.2012 wurden 1 179 691 Anträge gestellt, davon entfielen 31 985 auf Soldaten (vgl. Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Aufgaben, 06.03.2013). Von 1956 bis 1983 war die Gewissensentscheidung sowohl in einer schriftlichen Begründung als auch in einem mündlichen Prüfungsverfahren glaubhaft zu machen.
3.1 Wehrerfassung und Musterung
Im Herbst 1968 wurden die Wehrpflichtigen meines Geburtsjahrganges 1950 durch das „Mitteilungsblatt“ meiner Heimatgemeinde O. zum Wehrdienst im Rahmen der Wehrerfassung aufgerufen:
„Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes sind alle Männer vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt im Geltungs-bereich des Wehrpflichtgesetzes (Bundesrepublik ohne Berlin) haben, wehrpflichtig. Männliche Personen können bereits ein halbes Jahr vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres erfasst werden (§ 15 Abs. 6 des Wehrpflichtgesetzes).“
Zum Schluss dieser öffentlichen Aufforderung wurde die reibungslose Abwicklung dieses Verwaltungsaktes noch durch eine Strafandrohung betont:
„Wehrpflichtige, die der Aufforderung, sich zu melden, nicht Folge leisten, begehen eine Ordnungswidrigkeit, die nach § 45 des Wehrpflichtgesetzes mit einer Geldbuße geahndet werden kann.“
In meiner Schulklasse am Wirtschaftsgymnasium und im Dorf bei meinen ehemaligen Schulkameraden von der Volksschule unterhielten wir uns zwar über die Wehrerfassung, aber es erfolgte dabei nie eine kritische Auseinandersetzung mit dem kommenden Wehrdienst.
Mit Datum vom 7. März 1969 wurde ich schließlich zur Musterung beim Kreiswehrersatzamt Offenburg geladen. Außer dem Personalausweis oder Reisepass musste man folgende Unterlagen mitbringen:
1. Nachweise über Schul- und Berufsausbildung,
2. Nachweise über eine technische oder krankenpflegerische Ausbildung,
3. Freischwimmer- oder Rettungsschwimmerzeugnis,
4. Führerschein für Kraftfahrzeuge, Flugzeuge und Wasserfahrzeuge,
5. Nachweis über Polizeivollzugsdienst, Annahmeschein für den Polizeivollzugsdienst (Bundesgrenzschutz oder Polizei der Länder),
6. ein Passbildung, sofern dies bei der Erfassung noch nicht vorgelegt worden ist,
7. bereits in Ihrem Besitz befindliche ärztliche Unterlagen, Brillenrezepte oder Brillen sowie Versorgungsbescheide,
8. Unterlagen, die zu einem Antrag auf Befreiung oder Zurückstellung vom Wehrdienst noch nicht eingereicht wurden. Außerdem war eine Sport- und Badehose mitzubringen.
Bei unentschuldigtem Fernbleiben konnte gemäß § 44 Abs. 2 WPflG, die Vorführung des Musterungsunwilligen durch die Polizei angeordnet werden und ferner gemäß § 45 des WPflG eine Geldbuße gegen ihn festgesetzt werden. Um 7.45 Uhr mussten sich die Musterungskandidaten im Kreiswehrersatzamt einfinden und wurden dann in Bade- oder Sporthose untersucht. Eine oberflächliche medizinische Untersuchung führte bei mir Oberregierungsmedizinalrat Dr. Schmidt durch, der mich z. B. 20 Kniebeugen vorführen ließ. Ebenso wurde auch mein Schädel gemessen, wahrscheinlich damit bei der Bundeswehr der Stahlhelm richtig passt. Ein Blutbild wurde nicht durchgeführt. Wie gesagt, es handelte sich um eine Untersuchung mit Fließbandcharakter, die deshalb keine fundierten Ergebnisse oder Erkenntnisse erbringen konnte.
Mit dem Tauglichkeitsgrad „T“ gehörte ich zu den 67,9 Prozent des Geburtsjahres 1950, die ebenfalls tauglich waren. Die drei weiteren Tauglichkeitsgrade des Geburtsjahres 1950 teilten sich wie folgt auf:
21,6 Prozent waren eingeschränkt tauglich
8,8 Prozent waren vorübergehend tauglich
1,7 Prozent waren dauernd untauglich
Von den tauglich gemusterten Wehrpflichtigen des Geburtsjahres 1950 wurden zum Grund-wehrdienst herangezogen:
Grundwehrdienst 73,8 Prozent
Ersatzdienst 2,1 Prozent
(vgl. Deutscher Bundestag, 28.02.1974)
Nach Abschluss der Musterung händigte mir der Vorsitzende des Musterungsausschusses Regierungsamtmann Lange zunächst das ärztliche Untersuchungsergebnis mit dem Tauglichkeitsgrad T (=tauglich) aus und überreichte mir den Musterungsbescheid. Er beglückwünschte mich zu meinem erfreulichen Gesundheitszustand und gab mir dann noch den Wehrpass. Damit gehörte ich nun zur Ersatz-Reserve I und unterlag gleichzeitig nach dem § 24 Wehrpflichtgesetz der Wehr-überwachung. Als jetzt Wehrpflichtiger hatte ich deshalb u. a.
a) jede Änderung meines ständigen Aufenthaltes oder meiner Wohnung binnen einer Woche, im Verteidigungsfall innerhalb 48 Stunden, dem zuständigen Kreiswehrersatzamt meines Weg- und Zuzugortes zu melden,
b) Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörden mich unverzüglich erreichen,
c) auf Aufforderung der zuständigen Wehrersatzbehörde mich persönlich zu melden,
d) im Bereitschafts- und Verteidigungsfall auf entsprechende Anordnung der Bundesregierung unverzüglich zurückzukehren, wenn ich mich außerhalb des Geltungsbereichs des Wehrpflichtgesetzes aufhalte,
e) die Absicht, meinem ständigen Aufenthaltsort länger als 8 Wochen fernzubleiben dem zuständigen Kreiswehrersatzamt unverzüglich schriftlich oder mündlich zu melden,
f) den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurückstellung und den Abschluss und einen Wechsel ihrer beruflichen Ausbildung sowie einen Wechsel ihres Berufes dem Kreiswehrersatzamt ebenfalls mitzuteilen.
Ein Zuwiderhandeln konnte damals im Rahmen eines Bußgeldverfahrens, wenn sie vorsätzlich begangen wurde, mit einer Geldbuße bis zu eintausend DM und wenn sie fahrlässig begangen wurde, mit einer Geldstrafe bis zu dreihundert DM geahndet werden.
3.2 Eignungs- und Verwendungsprüfung (EVP)
Vom Kreiswehrersatzamt Freiburg erhielt ich die Ladung zur Eignungsprüfung, denn nach den Vorschriften der §§ 3 Abs. 1 Satz 2 und 20a des Wehrpflichtgesetzes „sind Sie verpflichtet, sich vor ihrer Einberufung zum Wehrdienst auf die Eignung für bestimmte Verwendungen prüfen zu lassen.“ Ich sollte mich deshalb am 13. Mai 1969 in Rastatt in der Militärstraße 4 zur Eignungsprüfung vorstellen. Der Straßenname passte haargenau zur Eignung für das Militär und zur Institution Bundeswehr. Da dieser Überprüfung ein zeitlich genauer Prüfplan zugrunde lag, wurde ein pünktliches Erscheinen für unbedingt erforderlich gehalten, und es wurde empfohlen, „Kaltverpflegung“ mitzubringen. Ungefähr 20 bis 30 junge Männer, die alle Schüler an Gymnasien waren, saßen wie bei einer Klassenarbeit in einem Raum und erwarteten die Aufgaben. Zu allererst mussten wir Prüflinge innerhalb von 10 Minuten zu verschiedenen vorgegebenen Themen einen Kurz-Aufsatz schreiben. Ich wählte dabei das Thema „Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten?“ Voller Offenheit bekannte ich in meinen Ausführungen, dass ich mich dann noch mehr und besser über die Kriegsdienstverweigerung und den Bundeswehrdienst informieren würde. Danach wurden gewisse Bestandteile der Intelligenz getestet, in dem sprachliche Kompetenzen überprüft wurden (Rechtschreibtest und Wortverständnistest). Anschließend wurden ein Rechentest, ein Raumvorstellungstest, Figurendenktest und Zahlenumkehrtest durchgeführt. Die bisher angeführten Prüfungsteile lehnten sich weitgehend an einzelne Untertests von Intelligenztests an. Die weiteren Testreihen wie mechanischer Test, Kraftfahrzeugtest, elektrotechnischer Kenntnistest, Funktest und zuletzt eine Reaktionsprüfung dienten eher der Feststellung von militärspezifischen Fähigkeiten. Fast alle Teilnehmer strengten sich wie bei einer Klassenarbeit an, um bei den 10 Tests ein gutes Ergebnis zu erzielen. Sie bewiesen damit auch, dass sie hier die individuelle Fähigkeit, Anforderungen von Seiten der anwesenden zivilen Bundeswehrangestellten zu befolgen, problem- und kritiklos nachkamen. Ich selbst nahm diese „Testerei“ nicht so ernst, so dass ich auch von einem aufsichtsführenden BW-Angestellten zu einer besseren Mitarbeit ermahnt wurde. Meine mangelnde Motivation kam dann auch durch meinen für einen angehenden Abiturienten schlechten Notenschnitt von 3,5 zum Ausdruck.
3.3 Begründung meines KDV-Antrags
Am 9. Januar 1970 teilte mir das Kreiswehrersatzamt Offenburg den Eingang meines Antrags vom 10. Dezember 1969 mit und informierte mich darüber, dass ich vom zuständigen Prüfungsausschuss für Kriegsdienstverweigerer beim Kreiswehrersatzamt Freiburg eine weitere Nachricht erhalten würde. Einige Wochen später erhielt ich vom Prüfungsausschuss das folgende Schreiben:
Betr.: Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer
Vorg.: Ihr Antrag vom 10.12.1969
Sehr geehrter Herr Metzinger,
Ihr Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer ist zuständigkeitshalber dem Prüfungsausschuss für Kriegsdienstverweigerer zugeleitet worden.
Zur Vorbereitung der Entscheidung ist es erforderlich, den Antrag näher zu begründen und in verschiedenen Punkten zu ergänzen. Da nach § 26 Abs. 4 des Wehrpflichtgesetzes bei der Entscheidung die gesamte Persönlichkeit des Antragstellers und sein sittliches Verhalten zu berücksichtigen sind, liegt es ihn Ihrem Interesse, den Antrag durch solche Angaben zu ergänzen, die geeignet sind, den Ausschuss ein möglichst umfassendes Bild über Ihre Person zu vermitteln.
Folgende Anregungen bitte ich zu berücksichtigen:
1) Lückenloser Lebenslauf mit Angaben von Alter und Geschlecht etwaiger Geschwister, der Schulbildung und des sonstigen bisherigen Werdeganges mit genauer Bezeichnung der besuchten Schulen, anderer Lehr- und Ausbildungsstätten und etwaiger Arbeitgeber,
2) religiöse, weltanschauliche und sonstige geistige Einstellung,
3) besondere Interessen,
4) Zugehörigkeit zu Organisationen, insbesondere solchen, die für die Kriegsdienstverweigerung eintreten,
5) nähere Darlegung der Gewissensgründe, die zur Kriegsdienstverweigerung veranlassen,
6) Benennung von zwei Zeugen (mit genauen Anschriften), die über Ihre Persönlichkeit, Ihr bisheriges sittliches Verhalten, Ihre religiöse und weltanschauliche Einstellung und Ihre Haltung zu den Fragen des Wehrdienstes Auskunft geben können.
In den darauf folgenden Tagen beschäftigte ich mich intensiv mit folgenden Fragen:
Was sagt mir mein Gewissen? Welche grundlegenden Werte vertrete ich? Nach welchen Prinzipien richtet sich mein Verhalten aus?
Was geschieht überhaupt im Krieg? Welches Wissen habe ich über den Krieg?
Wie müsste ich in einem Verteidigungskrieg handeln? Wie stehe ich zu einem Verteidigungskrieg?
Was bedeutet es, einen Menschen zu töten?
Kann ich als Soldat in einem Krieg meinem Gewissen folgen? Habe ich im Krieg noch andere Handlungsalternativen, um meinem Gewissen entsprechend zu handeln?
Wodurch werde ich im Krieg gezwungen zu töten?
Warum will ich keinen Wehrdienst leisten?
Zudem setzte ich mit den Aufgaben der Bundeswehr, der Notwendigkeit der Wehrpflicht und den Inhalten sowie der Praxis der Bundeswehraus