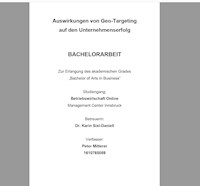Entwicklung und Evaluation eines Kosten-Nutzen-Modells von kaufmännischen Betriebspraktika aus Unternehmenssicht E-Book
Peter Mitterer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Masterarbeit untersucht die jeweiligen Kosten- und Nutzenaspekte von Betriebs-praktika aus Unternehmenssicht. Aufgrund der hohen Praxisrelevanz wird der For-schungsablauf an die Gestaltungsforschung bzw. den Ansatz der Design-Based-Research angelehnt. Die theoretische Darstellung erfolgt dabei anhand der Literatur. Im Zuge des-sen wird ein theoriebasiertes Modell aufgestellt, das als erster Prototyp des Kosten-Nut-zen-Modells dient. Anschließend wird dieser Prototyp mithilfe von Informationsgesprä-chen mit personalverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen, die vermehrt auf Praktikaanstellungen setzen, formativ evaluiert. Die Entwicklung des zweiten Prototypen und die summative Darstellung zeigen, dass einige Kosten- und Nut-zenfaktoren sowohl in der Theorie als auch in der Praxis von hoher Relevanz sind. So dominieren die direkten Kosten, wie beispielsweise das Entgelt für die Lernenden sowie Kosten für die Betreuung, Einschulung und Rekrutierung. Dem gegenüber stehen Nut-zenkriterien wie die Vermarktung, Sicherung des Arbeitskräftepotenzials, Reduktion von Rekrutierungs-, Ausfall- und Fehlbesetzungskosten und der Nutzen aus den eingebrach-ten Fähigkeiten der Praktikantinnen und Praktikanten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Entwicklung und Evaluation eines Kosten-Nutzen-Modells von kaufmännischen Betriebspraktika aus Unternehmenssicht
begin234Impressumbegin
ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES KOSTEN-NUTZEN-MODELLS VON KAUFMÄNNISCHEN BETRIEBSPRAKTIKA AUS UNTERNEHMENSSICHT
Peter Mitterer, BA
Matrikelnummer: 51816247
Institut für Organisation und Lernen
MASTER ARBEIT
eingereicht im Rahmen des Studiums
Wirtschaftspädagogik
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf Innsbruck, am 20. September 2021
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.
Die vorliegende Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Magister-/Master-/Diplomarbeit/Dissertation eingereicht.
20. September
_____________________________
Datum
________________________________ _
Unterschrift
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite I
Kurzfassung
Diese Masterarbeit untersucht die jeweiligen Kosten- und Nutzenaspekte von Betriebs- praktika aus Unternehmenssicht. Aufgrund der hohen Praxisrelevanz wird der For- schungsablauf an die Gestaltungsforschung bzw. den Ansatz der Design-Based- Research angelehnt. Die theoretische Darstellung erfolgt dabei anhand der Literatur. Im Zuge des- sen wird ein theoriebasiertes Modell aufgestellt, das als erster Prototyp des Kosten- Nut- zen-Modells dient. Anschließend wird dieser Prototyp mithilfe von Informationsgesprä- chen mit personalverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen, die vermehrt auf Praktikaanstellungen setzen, formativ evaluiert. Die Entwicklung des zweiten Prototypen und die summative Darstellung zeigen, dass einige Kosten- und Nut- zenfaktoren sowohl in der Theorie als auch in der Praxis von hoher Relevanz sind. So dominieren die direkten Kosten, wie beispielsweise das Entgelt für die Lernenden sowie Kosten für die Betreuung, Einschulung und Rekrutierung. Dem gegenüber stehen Nut- zenkriterien wie die Vermarktung, Sicherung des Arbeitskräftepotenzials, Reduktion von Rekrutierungs-, Ausfall- und Fehlbesetzungskosten und der Nutzen aus den eingebrach- ten Fähigkeiten der Praktikantinnen und Praktikanten.
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite II
Abstract
This Master's thesis investigates the cost and benefit aspects of internships from the com- pany's point of view. The research process is based on the approach of design-based - research. Therefore, a theory-based model is set up, which is then used as a first proto type for the cost-benefit model. Subsequently, this prototype will be formatively evaluated on the basis of informational interviews with employees responsible for human resources in companies that increasingly focus on internships. The development of the second proto- type and the summative presentation show that some cost and benefit factors are highly relevant, both in theory and in practice. On the one hand, direct costs such as compensa- tion and costs for supervision, enrolment and recruitment dominate. On the other hand, there are benefit aspects such as marketing, securing the labour potential, reduction of recruitment, absenteeism and miscasting costs and the benefit from the skills brought in by the interns.
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite III
Inhaltsve rzeichnis
Abbildungsverzeichnis....................................................................................... VI
Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................... VI
1. Einleitung................................................................................................. 1
2. Theoretische Grundlagen.......................................................................... 6
2.1. Praktikum................................................................................................. 6
2.1.1. Begriffsdefinition ..................................................................................... 6
2.1.2. Abgrenzung und Rahmenbedingungen...................................................... 7
2.1.3. Aktuelle Relevanz .................................................................................. 14
2.2. Bildungsökonomie und -controlling........................................................ 17
2.3. Kosten-Nutzen-Analysen........................................................................ 21
2.4. Kosten und Nutzen in der Aus- und Weiterbildung................................. 25
2.5. Kosten und Nutzen eines Praktikums...................................................... 27
2.5.1. Kosten und Nutzen für Individuen .......................................................... 29
2.5.2. Kosten und Nutzen für die Schule........................................................... 31
2.5.3. Kosten und Nutzen für Unternehmen...................................................... 33
3. Grundlagen des Forschungsdesigns ........................................................ 38
3.1. Allgemeine Grundlagen.......................................................................... 38
3.2. Design-Based-Research .......................................................................... 40
4. Forschungsablauf.................................................................................... 43
4.1. Problemdefinition und theoretische Darstellung...................................... 43
4.2. Theoriebasierte Entwicklung Prototyp I .................................................. 44
4.3. Formative Modellevaluation................................................................... 47
4.4. Evaluative Entwicklung Prototyp II ........................................................ 54
4.4.1. Textbasierte Entwicklung Prototyp II...................................................... 54
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite IV
4.4.2. Graphische Entwicklung Prototyp II ....................................................... 63
4.5. Summative Darstellung und Diskussion Prototyp II ................................ 66
5. Kritische Reflexion der Forschungsmethodik.......................................... 74
6. Ausblick auf zukünftige Forschungen..................................................... 77
7. Zusammenfassung .................................................................................. 80
Literaturverzeichnis ........................................................................................... 85
Anhang .............................................................................................................. 94
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Phasen der Design-Based-Research, eigene Darstellung in Anlehnung an
Reinking & Bradley, 2008, S. 67 ff. ............................................................................ 41
Abbildung 2: literaturgestützte Darstellung der Kostenaspekte Prototyp I, eigene
Darstellung ................................................................................................................. 45
Abbildung 3: literaturgestützte Darstellung der Nutzenaspekte Prototyp I, eigene
Darstellung ................................................................................................................. 46
Abbildung 4: Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, eigene Darstellung in
Anlehnung an Mayring, 1994, S. 165.......................................................................... 52
Abbildung 5: Graphische Entwicklung der Kostenaspekte Prototyp II, eigene
Darstellung ................................................................................................................. 64
Abbildung 6: Graphische Entwicklung der Nutzenaspekte Prototyp II, eigene
Darstellung
................................................................................................................. 65
Abbildung 7: Summative Darstellung der Kostenaspekte, eigene Darstellung ............. 67
Abbildung 8: Summative Darstellung der Nutzenaspekte, eigene Darstellung ............. 68
Abkürzungsverzeichnis
Anm. d. Verf. Anmerkung der Verfasserin bzw. des Verfassers
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
DBR Design-Based- Research
OECD
Organisation of Economic Co-operation and Development Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Peter
Mitterer, BA 51816247 Seite VI
1. Einleitung
„Erzähle es mir – und ich werde es vergessen. Zeige es mir – und ich werde mich erinnern. Lass es mich tun – und ich werde es behalten.
(Konfuzius, chinesischer Philosoph von 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.) .
Bereits Konfuzius war sich der Bedeutung des „Tuns“ bewusst. Praktische Anwendungen tragen dazu bei, theoretische Inhalte besser im Gedächtnis zu verankern und so Erfah- rungshorizonte aus Bildung und Arbeitswelt miteinander zu verknüpfen (Ostendorf, 2007, S. 164). Auch Spranger (1923) beschreibt bereits vor Jahrzehnten die enorme Be- deutung der beruflichen Tätigkeit, um sich allgemein weiterzubilden: „ Der Weg zu der höheren Allgemeinbildung führt über den Beruf und nur über den Beruf.“ (Spranger, 1923, S. 10)
Der „Beruf“ kann je nach Unternehmensbereich oder Berufsgruppe stark variieren, da Praktikantinnen und Praktikanten in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden kön- nen. Traditionelle Lern- bzw. Lehransätze und eine stark ausgeprägte Handelstradition innerhalb Europas führten bereits frühzeitig dazu, Praktikaanstellungen zu forcieren, und die praktische Anwendung der theoretisch gelernten Inhalte weiter voranzutreiben. Be- rufliche Bildung in Form eines Praktikums wird nach wie vor in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. So sind Praktika im Tourismus, im Handwerk aber auch in kauf- männischen Tätigkeiten stets eine geeignete Möglichkeit, Bildung und Arbeitswelt mit- einander zu verknüpfen. (Maertz et al., 2014, S. 123 ff.)
Ein Praktikum soll dazu beitragen, den Horizont eines Individuums zu erweitern, indem Bildung und Beruf miteinander kombiniert werden. Berufliche Bildung einer Praktikantin bzw. eines Praktikanten kann als zeitlich begrenzte legitimierte Teilhabe an der betrieb- lichen Praxisgemeinschaft bezeichnet werden (Ostendorf, 2007, S. 168). Diese zeitliche Befristung bzw. das Ausmaß der Beschäftigungsdauer, das Alter der Praktikantinnen und Praktikanten sowie bisherige berufliche Erfahrungen zeigen jedoch auch Unterschiede in der Einordnung von Praktika auf, wodurch die Art des Praktikums weiter zu differenzie- ren ist (Maertz et al., 2014, S. 125) .
Peter
Mitterer, BA 51816247 Seite 1
Diese Differenzierung ist sowohl für die Einordnung des jeweiligen Praktikums als auch für die Interessen der einzelnen Stakeholder entscheidend. Berufliche Bildung in Form von Praktikaanstellungen soll nämlich nicht nur den Horizont des Individuums erweitern, sondern auch die unternehmerischen Interessen erfüllen. Ein Praktikum weist daher ei- nerseits eine pädagogische Funktion in Form der Bildung auf und andererseits eine öko- nomische Funktion, die darauf abzielt, unternehmerische und personalpolitische Vorha- ben bestmöglich zu erfüllen (Ostendorf, 2007, S. 164 f.) .
Im Rahmen der konnektivitätsorientierten Praktikumsdidaktik nach Ostendorf et al. (2018) tragen sowohl die Praktikantin bzw. der Praktikant, der Praktikumsbetrieb als auch die Schule dazu bei, den Lernraum Praktikum optimal gestalten zu können und somit die pädagogischen und ökonomischen Zielsetzungen zu erreichen. Die Schule als Stakehol- der der Praktikumsgestaltung spielt vor allem bei erfahrungsergänzenden Praktika eine entscheidende Rolle, da die enge Verzahnung zwischen Ausbildungsstätte und Prakti- kumsbetrieb stets gewährleistet werden soll, um theoretisch erlernte Inhalte in der Praxis anwenden zu können und die „Erfahrungs- bzw. Praxisferne“ der Schulausbildung zu mi- nimieren (Ostendorf, 2007, S. 165) .
Die Konnektivität der drei Hauptstakeholder in der Praktikumsvorbereitung, - durchfüh- rung und -nachbetreuung ist jedoch nicht nur bei erfahrungsergänzenden Praktika e nt- scheidend. Auch andere Praktikaarten, wie berufsvorbereitende und Berufseinstiegsprak- tika (Ostendorf, 2007, S. 165), streben danach, sowohl den Interessen der Individuen, der Schule, als auch der Betriebe nachzukommen. Doch welche konkreten Vorhaben streben die jeweiligen Stakeholder an?
Da die Einsatzgebiete von Praktika stark variieren, kann auch deren ökonomische Funk- tion unterschiedlich ausgestaltet sein. Die Vorhaben und der daraus resultierende Nutzen unterscheiden sich daher maßgeblich. Praktika werden aufgrund bisheriger positiver Er- fahrungswerte vorwiegend in Tourismus-, Handwerks- und anderen kaufmännischen Be- trieben eingesetzt (Maertz et al., 2014, S. 123 ff.)
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 2
Organisationale und technologische Veränderungen führen zudem dazu, dass die „Ware“ Arbeitskraft flexibel eingesetzt werden muss und sich dadurch auch die Einsatzmöglich- keiten vor allem in kaufmännischen Tätigkeitsfeldern stark verändern (Faßhauer & Fürs- tenau, 2012, S. 165). So werden Praktikantinnen und Praktikanten nicht nur in klassischen Tätigkeitsbereichen wie der Buchhaltung, im Marketing oder Personalmanagement ein- gesetzt. Die starke Kundinnen- und Kunden- bzw. Dienstleistungsorientierung führt wei- ters dazu, dass kaufmännische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Praktikan- tinnen und Praktikanten für diverse Beratungen oder beispielsweise für die Abwicklung und Betreuung bei Finanzdienstleistungen eingesetzt werden (Faßhauer & Fürstenau, 2012, S. 165; Hazelwood, 2004, S. 82; Maertz et al., 2014, S. 124-125) .
Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Praktika in personal- und arbeitsmarktpoliti- schen Kontexten ist daher auch von Veränderungen, beispielsweise die Organisations- strukturen betreffend, abhängig und schwer durchführbar. Dennoch ist es notwendig, das Potenzial und den Nutzen von Praktikaanstellungen, sei es zum Beispiel die engagierte Arbeitsleistung von möglichen zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Errei- chung der ökonomischen Ziele von Unternehmen aufzudecken. Die vielfältigen Einsatz- möglichkeiten eines kaufmännischen Praktikums erschweren eine einheitliche Beurtei- lung zusätzlich, aus diesem Grund beschränkt sich diese Forschung auf die Anstellung von Praktikantinnen und Praktikanten im Bankensektor, welcher vermehrt auf kaufmän- nische Praktika zurückgreift (Hazelwood, 2004, S. 82) .
Da ein Praktikum aber nicht nur zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen kann, sondern diesen auch entgegenwirken kann und somit Kosten, beispielsweise aufgrund von arbeitsrechtlichen Risiken oder in der Einschulung, Betreuung und Überwachung , verursachen kann, sind einerseits die Potenziale bzw. der Nutzen von Praktikaanstellun- gen, und andererseits mögliche Kosten aufzudecken. (Maertz et al., 2014, S. 127- 128)
Um sowohl die Kosten als auch den Nutzen von kaufmännischen Praktikaanstellungen im Bankensektor deutlich zu machen, wird mithilfe dieser Forschungsarbeit folgende Forschungsfrage beantwortet:
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 3
Welche Kosten und Nutzen entstehen aus Unternehmenssicht bei der Anstellung von kaufmännischen Praktikantinnen und Praktikanten ?
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird anhand einer Gegenüberstellung mögli- cher Kosten- und Nutzenaspekte von Praktikaanstellungen ermöglicht. Diese Gegenüber- stellung wird mithilfe eines Kosten-Nutzen-Modells durchgeführt, indem sowohl Kosten - und Nutzenaspekte, die in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbetreuung einer Praktikaanstellung entstehen, miteinbezogen werden. Die Entwicklung dieses Modells erfolgt theoriebasiert. Imweiteren Forschungsverlauf wird eine formative Evaluation des Modells, die auf die Logiken der Gestaltungsforschung bzw. Design-Based- Research (DBR) zurückgreift, dazu beitragen, die bisher erhobenen theoretischen Erkenntnisse auf deren aktuelle Relevanz und Übertragbarkeit zu überprüfen, um so mögliche Adaptierun- gen des Modells vornehmen zu können (Reinking & Bradley, 2007, S. 67 ff.) .
Das wissenschaftlich gestaltete und adaptierte Modell soll anschließend für kaufmänni- sche Praktikaanstellungen angewandt werden können und so relevante Aufschlüsse über mögliche Kosten- und Nutzenkriterien geben, welche theoriebasiert bisher nicht bzw. an- ders erläutert und dargestellt wurden. Der wissenschaftliche Ertrag bzw. Mehrwert, den die nachfolgende Forschungsarbeit liefert, ergibt sich daraus, dass ein einheitliches Mo- dell zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Betriebspraktika, im speziellen in kaufmän- nischen Bereichen des Bankensektors, entwickelt wird und im empirischen Kontext eva- luiert und überprüft wird. Unternehmen, welche vor der Entscheidung stehen, Praktikan- tinnen und Praktikanten anzustellen und mit deren Unternehmensprozessen vertraut zu machen, können auf dieses empirisch entwickelte und evaluierte Kosten-Nutzen- Modell zurückgreifen und sich vorab ein eindeutiges Bild über mögliche Kosten- und Nutzenfak- toren, die eine Praktikaanstellung mit sich bringt, verschaffen.
Um sowohl die Beantwortung der Forschungsfrage als auch die Übertragbarkeit der Er- gebnisse gewährleisten zu können, ist die nachfolgende Forschungsarbeit systematisch und nach den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens aufgebaut. Nach der einführenden Darstellung der Forschungsproblematik sowie der Erläuterung der Forschungsfrage er- folgt eine detaillierte Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen. Hierbei wird auf den
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 4
bisherigen Forschungsstand in Hinblick auf die Praktikumsforschung, die Abgrenzung eines Praktikums zu anderen Beschäftigungsverhältnissen, die aktuelle Relevanz von Praktikaanstellungen und mögliche Kosten- und Nutzenkriterien, die bei einer Prakti- kaanstellung entstehen, eingegangen.
Im Anschluss an die Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen werden die Grundlagen des Forschungsdesigns kurz erläutert. Der konkrete Forschungsablauf orientiert sich am zyklischen Forschungs- und Entwicklungsprozess der Design-Based-Research und wird danach detailliert beschrieben. Dabei wird ein theoriebasiertes Kosten-Nutzen- Modell entwickelt, welches anhand von qualitativer Forschung formativ evaluiert wird. Daraus gewonnene, neue Erkenntnisse fließen wiederum in die Modellentwicklung ein und das bisherige Kosten-Nutzen-Modell wird adaptiert. Das adaptierte Modell wird anschlie- ßend beschrieben und ansprechend dargestellt.
ImRahmen der Ergebnisdarstellung wird der gesamte Forschungsprozess und somit auch die Entwicklung und Evaluation des Modells in Anlehnung an den Design-Based- Rese- arch-Ansatz summativ dargestellt und diskutiert. Eine kritische Reflexion der For- schungsmethodik und Modellausarbeitung wird nachfolgend ebenfalls näher ausgeführt. Weiters wird die Ausarbeitung von zukünftigen Forschungslücken vertieft, indem bei- spielsweise darauf eingegangen wird, dass sowohl andere Unternehmensbranchen wie der Tourismus oder das Handwerk, als auch andere Praktikaarten und Beschäftigungsver- hältnisse interessante Erkenntnisse zu den bisher dargestellten Ergebnissen liefern. Ab- geschlossen wird die Forschungsarbeit mit einer ausführlichen Zusammenfassung und einem detaillierten Überblick über die vorliegende Forschung.
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 5
2. Theoretische Grundlagen
Zur Beantwortung der Forschungsfrage und zur Modellentwicklung ist es zunächst not- wendig, theoretische Grundlagen und Konzepte, die im Kontext mit der Praktikumsfor- schung sowie der Entwicklung und Darstellung von Kosten-Nutzen-Modellen von Be- deutung sind, zu erläutern.
Einführend
wird beschrieben, was ein Praktikum ist, welche Arten bzw. Dimensionen von Praktika es gibt und welche Stakeholder Interesse an einer Praktikaanstellung haben. Weiters wird eine Abgrenzung von Praktika zu anderen Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt und zu beachtende rechtliche Hintergründe angesprochen. Die derzeitige Relevanz von Praktika wird durch Statistiken und Vergleiche in der Anstellung von Prak- tikantinnen und Praktikanten aufgezeigt.
Der nächste Punkt beschäftigt sich mit der Darstellung der Vorteilhaftigkeit von Praktika in Form von Kosten-Nutzen-Modellen. Aufgrund der Bedeutung der Personal- und Bil- dungsökonomie werden diese näher beschrieben. Außerdem wird auf Möglichkeiten der Modelldarstellung sowie auf die Unterschiede hinsichtlich der Stakeholderinteressen ein- gegangen. Es werden mögliche Kosten- und Nutzenfaktoren näher ausgeführt .
2.1. P raktikum
2.1.1. Begriffsdefinition
Um ein entsprechendes Kosten-Nutzen-Modell von Betriebspraktika entwickeln zu kön- nen, ist vorab eine Definition des Begriffs „Praktikum“ notwendig. Im Alltagsgebrauch bezieht sich ein Betriebspraktikum in erster Linie auf die konkrete betriebliche Praxis- phase an einem Arbeitsplatz. Betrachtet man jedoch das ganzheitliche Konstrukt, so um- fasst es wesentlich mehr als die tatsächliche Arbeitsleistung. Mithilfe des Praktikums soll ein Lernraum geschaffen werden, der sowohl die Vorbereitung, die Betreuung während- dessen, als auch die Nachbereitung umfasst und die Interessen der beteiligten Stakehol- der, Praktikantinnen und Praktikanten, Ausbildungsstätten und Praktikumsbetriebe, be- achtet (Ostendorf et al., 2018, S. 17) .
Peter
Mitterer, BA 51816247 Seite 6
Ostendorf et al. (2007, S. 168) beschreiben das Praktikum als „zeitlich begrenzte, legiti- mierte Teilhabe an einer betrieblichen Praxisgemeinschaft“. Ein Praktikum soll neben der Teilhabe an der Unternehmensgemeinschaft und dem ersten Kennenlernen der unterneh- merischen Prozesse zudem eine erste berufsrelevante Arbeitserfahrung liefern. Diese Ar- beitserfahrung soll strukturiert ablaufen und den Praktikantinnen und Praktikanten einen Mehrwert zu deren bisheriger, meist theoretischen Ausbildung liefern. (Ostendorf, 2007, S. 168; Taylor, 1988, S. 393)
Ganzheitlich
betrachtet soll ein Praktikum vor allem dazu dienen, dass motivierte, poten- zielle zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am betrieblichen Handelsgeschehen teilnehmen können. Hierbei ist ein umfassender Ansatz, der sowohl die Vorbereitung, Durchführung und Begleitung, als auch die Nachbetreuung miteinbezieht, heranzuziehen. Auch die Interessen der angeführten Stakeholder sind stets zu beachten, um den Lerner- folg und die damit verbundene Reduktion der „Erfahrungs- bzw. Praxisferne“ (Ostendorf, 2007, S. 164 f.) der rein theoretischen Ausbildung sicherzustellen und eine erste „Teil- habe an der Praxisgemeinschaft“ (Ostendorf et al., 2007, S. 168) eines Betriebes zu er- möglichen.
2.1.2. Abgrenzung und Rahmenbedingungen
Da ein Praktikum aufgrund von diversen Einflüssen stark variiert, ist eine Unterscheidung zwischen Praktikumsarten vorzunehmen, denn ein Praktikum ist nicht gleich Praktikum. Maertz et al. (2014) heben die Relevanz der Abgrenzung der Praktikaarten vor allem für die Stakeholder heraus. Hierbei soll zwischen dem Alter der Praktikantinnen und Prakti- kanten, deren bisherigen beruflichen Erfahrungen und nach der Art bzw. Höhe der Be- zahlung differenziert werden.
Ostendorf et al. (2007) hingegen unterscheiden zwischen erfahrungsergänzenden und be- rufsvorbereitenden Praktika sowie Berufseinstiegspraktika. Erfahrungsergänzende Prak- tika dienen der Ergänzung des theoretischen Fachwissens mit praktischem Anwendungs- wissen. Gelernte theoretische Inhalte, beispielsweise im Rahmen der Schulausbildung , werden somit in der Praxis angewandt, vertieft und erweitert. Die erzeugte „Praxis- bzw.
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 7
Erfahrungsferne“ der theoretischen Ausbildung soll mithilfe der praktischen Arbeitser- fahrungen reduziert werden (Ostendorf, 2007, S. 164 ff.). Erfahrungsergänzende Praktika werden oft parallel zur Schulausbildung bzw. während eines Studiums als Pflichtprakti- kum durchgeführt, um so verpflichtend erste berufliche Erfahrungen zu sammeln (Rebien & Spitznagel, 2007, S. 4) .
Berufsvorbereitende Praktika oder auch Schnupperpraktika sollen dagegen einen ersten kurzen Einblick in die Berufswelt und konkret in einzelnen Berufsgruppen und Unterneh- men ermöglichen. Diese Art des Praktikums dient daher primär der Berufsfindung bzw. einer ersten „Probebeschäftigung“ (Rebien & Spitznagel, 2007, S. 4), sowie einer ersten Kontaktanbahnung für einen möglichen zukünftigen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz (Ostendorf et al., 2007, S. 165 ff.) .
Als dritte Art werden Berufseinstiegspraktika beschrieben, welche den Übergang zwi- schen Ausbildung und Fixbeschäftigung bestmöglich gestalten sollen. Hierbei werden im Speziellen Hochschulabsolventinnen und -absolventen angesprochen, die mithilfe von Praktika für eine berufliche Tätigkeit gewonnen werden und im Rahmen des Praktikums bereits mit den unternehmerischen Prozessen vertraut werden. Der Trend, dass Berufs- einstiegspraktika eine entscheidende Rolle in personalpolitischen Überlegungen spielen, wird durch den Sammelbegriff „Generation Praktikum“ (Nienhaus, 2006; Stolz, 2005) , der vor allem die Berufseinstiegspraktika von Hochschulabsolventinnen und - absolven- ten betrifft, verdeutlicht. Diese Art des Praktikums dient außerdem als dauerhaftes As- sessment, dauerhafte Beobachtung bzw. Erprobung und soll dazu führen, dass die Prak- tikantinnen und Praktikanten anpassungsfähig, flexibel und mobil agieren. Zudem steht der ganzheitliche berufliche Erfolg über deren eigener Fähigkeit, am Arbeitsmarkt zu be- stehen, wodurch diese Praktikantinnen und Praktikanten zu einer Art Prototyp von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden. Berufseinstiegspraktika sind daher eine Mög- lichkeit der informellen Einarbeitungsphase. (Ostendorf et al., 2007, S. 165 ff. )
Dem gegenüber wird die Sinnhaftigkeit von immer wiederkehrenden „Praktikaschleifen“ aufgrund von mangelhafter Perspektive bzw. Verantwortung und geringer Bezahlung
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 8
aber auch kritisch betrachtet. Praktikantinnen und Praktikanten werden von einem Prak- tikum zum nächsten „geschoben“, dienen als Ersatz für eine Fixanstellung und können trotz eines großen Erfahrungsrepertoires nicht vollends überzeugen, da sie kaum verant- wortungsvolle Aufgaben ausfüllen und die zahlreichen Praktika auch als „vergebene An- läufe“ für eine Fixanstellung angesehen werden können (Rebien & Spitznagel, 2007, S. 1) .
Eine Sonderform sind sogenannte Anerkennungspraktika, die nach Abschluss der Berufs- ausbildung zu absolvieren sind, um anschließend die volle Anerkennung des Berufsab- schlusses zu erlangen. Praxissemester, welche an Fachhochschulen für die praxisorien- tierte Ausbildung herangezogen werden und curricular verankert sind, aber auch Praktika in Form von Eignungs- und Trainingsmaßnahmen zur Eingliederung von bisher arbeits- losen Personen, sind ebenfalls dem Konstrukt des Praktikums zuzuordnen. (Rebien & Spitznagel, 2007, S. 5)
Praktikaarten sind laut Maertz et al. (2014) anhand von Dimensionen weiter zu differen- zieren. So ist beispielsweise zwischen bezahlten und nicht bezahlten Praktika zu unter- scheiden. Pflichtpraktika, die einem konkreten Ausbildungszweck dienen, werden in der Höhe der jeweiligen Lehrlingsentschädigung des Ausbildungsjahres, welches dem schu- lischen Ausbildungsstand entspricht, entlohnt. Sonstige Praktika, die nicht dem direkten Ausbildungszweck dienen und Praktikantinnen und Praktikanten somit direkt in die be- trieblichen Organisationsabläufe integriert werden, gelten als normales Arbeitsverhältnis und werden daher auch entsprechend den kollektivvertraglichen Entgeltvorschriften ent- lohnt (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2017, S. 9 f.) .
Weiters ist zwischen dem Stundenausmaß zu unterscheiden: Praktika können das volle Stundenausmaß betreffen oder in Teilzeit, beispielsweise im Rahmen einer dualen Aus- bildung während der Schullaufbahn, abgehalten werden. Ein Praktikum kann auch nach der Höhe des Bildungsgrades differenziert werden. Während einige Praktikantinnen und Praktikanten deren Praktikum als reines Berufsschulpraktikum absolvieren, legen Schü- lerinnen und Schüler in berufsbildenden höheren Schulen ein Pflichtpraktikum während der Schullaufbahn ab. Andere Praktika wiederum werden im Rahmen einer akad emischen
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 9
Ausbildung durchgeführt, wo zwischen curricularer Verankerung und freiwilliger Kursanrechnung unterschieden wird. Praktika variieren weiters anhand der Organisation und Planung, welche einerseits von der Schule und andererseits von der Praktikantin bzw. vom Praktikanten selbst und dem jeweiligen Praktikumsgeber durchgeführt werden kann. Ein weiteres Kriterium sind die Arbeitsformate, die an bestimmte Projekte oder Arbeits - bzw. Tätigkeitsbereiche gekoppelt sein können. Ebenfalls sehr wesentlich sind die An- sprechpartnerinnen und -partner innerhalb des Unternehmens aber auch an der Ausbil- dungsstätte, sofern diese in die Gestaltung des Praktikums miteingebunden werden. Ma- ertz et al. (2014) beschreiben außerdem, dass einige Praktikumsgeber eine Möglichkeit für ein zukünftiges Beschäftigungsverhältnis anbieten, während andere Praktikantinnen und Praktikanten keine Möglichkeit für zukünftige Beschäftigungen erhalten und der Ausbildungsauftrag des Praktikumgebers lediglich auf das begrenzte Zeitausmaß be- schränkt ist. (Maertz et al., 2014, S. 125)
Ostendorf et al. (2007) ergänzen die Differenzierung nach einer inländischen bzw. aus- ländischen Praktikumsbeschäftigung. Auch die Austauschmöglichkeit mit „neer peers “ (Ostendorf et al., 2007, S. 169), welche ähnliche Erfahrungen und Einstellungen wie die Praktikantinnen und Praktikanten mitbringen, oder der Erfahrungsaustausch innerhalb von „communities of practice“ (Ostendorf et al., 2007, S. 169) zum Abbau von Distanzen durch Kommunikation und Transparenz spielen bei der Einordnung eines Praktikums und der damit verbundenen didaktischen Begleitung eine entscheidende Rolle .
Aufgrund der Diversität in den Beschäftigungsmöglichkeiten ist weiters zwischen einem Praktikum und anderen verwandten Beschäftigungsphänomenen zu unterscheiden. G e- sellschaftliche, sozio-kulturelle, demographische und ökonomische Veränderungen füh- ren dazu, dass die Anzahl an sogenannten atypischen Beschäftigungen, zu denen auch ein Praktikum zählt, stetig zunimmt. Eine atypische Beschäftigung liegt vor, sofern ein Be- schäftigungsverhältnis von der Definition eines Normalarbeitsverhältnisses abweicht. Um ein Normalarbeitsverhältnis handelt es sich, wenn in Vollzeit und unbefristet gear- beitet wird und soziale Sicherungssysteme wie die Sozialversicherung und die eindeutige Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis beachtet werden. Bei Abweichungen
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 10
dieser Kriterien spricht man vom atypischen Beschäftigungsverhältnis. (Bellmann et al., 2013, S. 3 ff. )
Beispiele für solche Beschäftigungsverhältnisse sind Teilzeitarbeitsverhältnisse, bei de- nen die Arbeitszeit die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigungen unterschreitet, geringfügige Beschäftigungen, welche auf ein maximales monatliches Ge- ringfügigkeitseinkommen beschränkt sind und als Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt wer- den, sowie Zeit- bzw. Leiharbeit, bei welcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Zeit- arbeitsfirmen angestellt sind und entlohnt werden und deren Arbeitskraft für eine be- stimmte Zeit an ausleihende Unternehmen überlassen wird. (Bellmann et al., 2013, S. 3)
Weiters zählen befristete Tätigkeiten bzw. Beschäftigungsverhältnisse ebenfalls zu den atypischen Dienstverhältnissen. Hierbei ist der Arbeitsvertrag für eine bestimmte Dauer befristet. Eine zeitliche Befristung kann unterschiedliche Ursachen haben. So kann einer- seits die gesetzliche Frist eines Probemonats umgangen werden, indem man M itarbeite- rinnen und Mitarbeiter zu Beginn einer Beschäftigungsdauer für mehrere Monate befris- tet anstellt und die erste „Screening-on-the-job-Phase“ (Schmelzer et al., 2015, S. 248 ) somit verlängert und das Personal besser kennengelernt werden kann. Saisonale Schwan- kungen und ein kurzfristiger Personalbedarf führen andererseits dazu, dass befristete A r- beitsverhältnisse verstärkt eingesetzt werden. Auch die erhöhte Motivation der befristeten Angestellten, um deren Beschäftigungsverhältnis möglicherweise in ein unbefristetes Verhältnis umzuwandeln, kann in vielen Fällen dazu führen, vorab auf befristete Beschäf- tigungen zu setzen (Gürtzgen et al., 2019, S. 3). Im Rahmen der Kennenlernphase mithilfe von befristeten Dienstverhältnissen sind Trainee-Programme eine häufig angewandte Methode, um geeignete Nachwuchskräfte frühzeitig zu entdecken, entsprechend kennen- zulernen, in das Unternehmensgeschehen einzubinden und dadurch eine Basis für eine weiterführende Beschäftigung zu schaffen (Nesemann, 2012, S. 2 ff.). Dies stärkt zudem die personalpolitische Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und führt dazu, im „war for talents“ bestehen zu können (Michaels et al., 2001) .
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 11
Um saisonalen Schwankungen entgegen wirken zu können, ist eine Ferialarbeiterin bzw. ein Ferialarbeiter auch eine Möglichkeit der befristeten Arbeitsleistung. Bei dieser Be- schäftigungsform ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nach Lang (1980) in der Regel kurzfristig an das Unternehmen gebunden und dient somit der Überbrückung von Ar- beitsengpässen. Der Tätigkeitsbereich ist meistens wenig anspruchsvoll, wodurch binnen kürzester Zeit Routinearbeiten von beurlaubten oder erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen werden können. Ferialarbeiterinnen und -arbeiter zählen je- doch während deren Beschäftigungsdauer zur Belegschaft. (Lang, 1980, S. 69)
Ein Lehrling, in manchen Fällen auch Volontärin bzw. Volontär genannt, ist mittelfristig an das Unternehmen gebunden und steht dem Betrieb daher mindestens zwischen einem und drei Jahren für Arbeitsleistungen zur Verfügung. Auch diese Nachwuchskraft zählt zur Stammbelegschaft und wird seitens des Betriebes qualifiziert ausgebildet. Ein unbe- fristetes Dienstverhältnis ist nach Absolvierung der Ausbildung in vielen Fällen durchaus denkbar. (Lang, 1980, S. 69)
Nicht zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen zählen in der Regel kaufmännisch An- gestellte, welche langfristig an das Unternehmen gebunden sind und meist komplexere und herausforderndere Tätigkeiten erfüllen. Diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übernehmen ihnen übertragene fachliche Tätigkeiten und gegebenenfalls Führungsaufga- ben, welche sie im Rahmen der vorab absolvierten Ausbildung erlernt haben. Fortbildun- gen sollen zusätzlich dazu beitragen, dass sich auch diese langfristig gebundene Beleg- schaft stets weiterentwickelt. (Lang, 1980, S. 69)
Ein Praktikum hingegen ist ein befristetes Dienstverhältnis, während dessen Dauer Prak- tikantinnen und Praktikanten je nach der Art des Praktikums entweder als Schülerin bzw. Schüler, Studentin bzw. Student oder Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer eingeordnet werden und abhängig von dieser Einordnung der Belegschaft zuzuordnen sind (Lang, 1980, S. 69). Das Praktikum dient dem Unternehmen neben der Überbrückung bei Ar- beitsengpässen vor allem als Möglichkeit des „Screenings on-the-job“ (Schmelzer et al., 2015) und soll im Rahmen dieses „Dauer-Assessments“ (Ostendorf, 2007, S. 172) dazu
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 12
führen, geeignete „Prototypen“ an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erzeugen und zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsgeschehen zu erproben.
Rechtlich betrachtet kann ein Praktikum als Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis au sge- staltet sein. Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn eine Praktikantin bzw. ein Praktikant der betrieblichen Organisation zugeordnet ist, vorgegebene Arbeitszeiten und -orte ein- zuhalten hat, laufende Kontrolle und Weisungen durch die Arbeitgeberin bzw. den Ar- beitgeber erhält und somit vor allem persönlich abhängig gegenüber dem Praktikumsbe- trieb ist. Ein Ausbildungsverhältnis hingegen liegt dann vor, wenn die persönliche Ab- hängigkeit der Praktikantin bzw. des Praktikanten nicht zu jeder Zeit gewährleistet ist . (Wirtschaftskammer Österreich, 2021, S. 4 ff.)
Diese Einordnung hat einerseits Einfluss auf das Entgelt, welches sich entweder am Kol- lektivvertrag oder an der geltenden Lehrlingsentschädigung orientiert. Andererseits be- einflusst die Einordnung auch die sozialversicherungsrechtliche Situation. Während Praktikaanstellungen nach Ausbildungsverhältnis nach dem Allgemeinen Sozialversiche- rungsgesetz (ASVG) anhand derer Ausbildung lediglich unfallversichert sind, sind ar- beitsverhältnisrechtliche Praktikantinnen und Praktikanten wie andere Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer zu behandeln und je nach Einkommenshöhe beim jeweiligen Krankenversicherungsträger voll zu versichern. (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2017, S. 9 ff.; Wirtschaftskammer Österreich, 2021, S. 6 ff.)
Richtet sich die Entlohnung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nach dem Kollektiv- vertrag, so ist der jeweilige Vertrag und dessen Geltungsbereich näher zu betrachten. Kol- lektivverträge, wie beispielsweise der Rahmenkollektivvertrag für kaufmännisch Ange- stellte im Handwerk, im Gewerbe, in der Information oder im Consulting, schließen Prak- tikantinnen und Praktikanten vom Geltungsbereich aus. Andere Verträge, wie zum Be i- spiel im Hotel- und Gastgewerbe, sehen eine Entlohnung in der Höhe der Lehrlingsent- schädigung im vergleichbaren Lehrjahr vor. Wiederum andere Regelungen von Verträ- gen sehen keine explizite Unterscheidung zwischen Praktikantinnen und Praktikanten bzw. sonstigen Angestellten vor, hierbei richtet sich die Entgeltzahlung nach der Einstu- fung in die Beschäftigungsgruppe. (Wirtschaftskammer Österreich, 2021, S. 9 ff.)
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 13
2.1.3. Aktuelle Relevanz
Um die aktuelle Relevanz von Praktikaanstellungen aufzuzeigen, ist zuvor eine Betrach- tung des Arbeitsmarktes und der damit verbundenen Bedeutung und Häufigkeit in der Anwendung von Praktika notwendig. Die Herausforderungen der Coronakrise führen zu erheblichen Strukturveränderungen und erschweren eine aussagekräftige Beurteilung der Arbeitsmarktlage (Mönnig et al., 2020, S. 1 ff.), wodurch im Rahmen dieser Forschungs- arbeit vorhergehende Beschäftigungsstatistiken herangezogen werden.
Die österreichische Arbeitsmarktstatistik aus dem Jahre 2019 nach Klapfer & Moser (2020) besagt, dass in etwa ein Drittel der unselbständig erwerbstätigen Personen atypisch beschäftigt ist. Neben der Teilzeitarbeit, welche den größten Anteil an den atypis chen Beschäftigungsverhältnissen ausmacht, spielen hierbei neben der Leiharbeit und freien Dienstverträgen auch die geringfügige Beschäftigung und Befristungen ohne Lehrver- hältnis eine entscheidende Rolle. Das Praktikum ist ebenfalls diesen atypischen Besc häf- tigungsverhältnissen zuzuordnen. Lässt man Teilzeitbeschäftigungen außen vor, so ist im Jahresschnitt mindestens eine von zehn unselbständigen Personen atypisch beschäftigt. Der Anteil an atypischen Beschäftigungen exklusive der Teilzeitarbeit ist seit 2015 ebenso angestiegen wie die generellen Beschäftigungszahlen, wodurch der Anteil zwi- schen 10 und 15 Prozent über Jahre hinweg konstant ist (Klapfer & Moser, 2020, S. 34 ff.). Auch in Deutschland liegen die Beschäftigungszahlen von Praktikantinnen und Prak- tikanten nach Rebien & Spitznagel (2007) ebenfalls über Jahre auf konstant hohem und leicht steigendem Niveau, obgleich die direkte Zuordnung aufgrund der Diversität von atypischen Beschäftigungen erschwert wird. Der generelle Anstieg der Beschäftigungs- zahlen in Österreich ist vor allem auf die wachsende Gesamtbevölkerung, welche zwi- schen 1989 und 2019 um beinahe 17 Prozent gestiegen ist, zurückzuführen. Das tatsäch- liche Arbeitskräftepotenzial liegt bei knapp 52 Prozent, während von diesem Arbeitskräf- tepotenzial im Jahr 2019 wiederum circa vier Fünftel tatsächlich erwerbstätig waren ( Ar- beitsmarktservice Österreich, 2020, S. 14 ff.). Innerhalb der Europäischen Union liegt Österreich, die Erwerbsquote betreffend, an achter Stelle (Klapfer &Moser, 2020, S. 51) .
Peter
Mitterer, BA 51816247 Seite 14
Um diese Position weiter zu verbessern, spielt die Neubesetzung und Erschaffung von Arbeitspositionen eine große Rolle. Im Jahr 2019 wurden im Vergleich zum Vorjahr zwar knapp weniger offene Stellen am Arbeitsmarkt gemeldet, dies ist jedoch vorwiegend auf weniger ausgeschriebene Lehrstellen zurückzuführen. Von den mehr als 500.000 offenen Stellen war zudem in etwa jede fünfte Stelle eine Teilzeitstelle. In der Finanz- und Ver- sicherungsdienstleistung sowie in anderen kaufmännischen Tätigkeitsfelder belief sich der Anteil der Teilzeit- und atypischen Beschäftigungsstellen auf circa 10 Prozent. ( Ar- beitsmarktservice Österreich, 2020, S. 38 f.)
Die aktuelle Relevanz und das generelle Interesse an einem Praktikum ist auch seitens der Praktikantinnen und Praktikanten gestiegen, um die eigene „Marktfähigkeit“ für Jobs mithilfe von Praktikaerfahrungen und ersten beruflichen Einblicken während der eigent- lichen Ausbildung zu erhöhen (Frenette, 2013, S. 365 f.). Zaussinger et al., (2015) be- schäftigen sich mit Praktikaanstellungen im Rahmen eines Studiums: Beinahe 60 Prozent der Studierenden absolvieren im Rahmen der Ausbildung mindestens ein Praktikum, wo- bei zwischen Pflichtpraktika und einem freiwilligen Praktikum zu unterscheiden ist. Der Anteil der Studierenden mit kaufmännischem oder wirtschaftswissenschaftliche m Schwerpunkt mit Praktikaerfahrung differenziert sich außerdem zwischen einer Ausbil- dung an einer Universität oder Fachhochschule. Während Fachhochschulen meist ver- pflichtende Praktika im kaufmännischen Bereich vorschreiben, sind Praktika für Studie- rende an einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Universität nur für knapp 40 Prozent interessant, um deren theoretisch erlernte Inhalte in der Praxis anzuwenden. (Zaussinger et al., 2015, S. 168 ff.)
Die JobTrends Studie nach Troesser et al. (2017) hingegen deckt die Bedeutung von Prak- tikantinnen und Praktikanten aus Unternehmenssicht auf. So stellen die rund 300 befrag- ten Unternehmen dieser Studie mehrere Praktikantinnen und Praktikanten pro Jahr ein. Bei der Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern zählen neben sprachlichen Kennt- nissen und Auslandserfahrungen vor allem auch berufliche Erfahrungen und insbeson- dere bisherige Praktikaanstellungen. In kaufmännischen Berufen wie der Finanz- und Be- ratungsdienstleistung sind bisherige Praktikaerfahrungen für beinahe drei Viertel der be-
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 15
fragten Unternehmen eine wichtige Zusatzqualifikation. Vier von fünf Studienteilnehme- rinnen und -teilnehmer überzeugen Praxiserfahrungen in Form von Praktika mehr als ein sehr guter Studienabschluss in der Regelstudienzeit. Vor allem Praktikantinnen und Prak- tikanten und Berufseinsteigerinnen und -einsteiger mit einer kaufmännischen oder wirt- schaftswissenschaftlichen Ausbildung werden von über 80 Prozent der teilnehmenden Unternehmen im Rekrutingprozess gesucht und bevorzugt. Knapp 40 Prozent der Ler- nenden erhalten im Anschluss an deren Praktikum ein Angebot über eine Fixanstellung im Unternehmen, wodurch deren Tätigkeit im Unternehmen durchaus geschätzt wird. (Troesser et al., 2017)
Das beschriebene enorme Arbeitskräftepotenzial, die damit verbundene hohe Erwerbs- quote und der Anteil an atypisch beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern , aber auch der konstant hohe und leicht steigende Beitrag der Praktikantinnen und Prakti- kanten an der Gesamtarbeitsleistung verdeutlichen die stets große Bedeutung dieser Be- schäftigungsform. Das Interesse der Individuen, die eigene Marktfähigkeit mithilfe eines Praktikums zu verbessern, sowie das Interesse seitens der Unternehmen, Praktikantinnen und Praktikanten anzustellen, demonstrieren die hohe aktuelle Relevanz von Praktikaan- stellungen, speziell in kaufmännischen Täti gkeitsbereichen.
Zudem zeigt auch die aktuelle Corona-Krise trotz der Strukturveränderungen des Arbeits- marktes (Mönnig et al., 2020, S. 1 ff.), dass Praktikaanstellungen einen wesentlichen Bei- trag bei der Auswahl von potenziellen zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mern leisten. Durch die geringe Anzahl an Praktikaplätzen aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns konnten sowohl die Lernenden als auch die Unter- nehmen diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. (Süddeutsche Zeitung, 2021)
Die tatsächliche Relevanz und der damit verbundene Erfolg eines Praktikums erfordern jedoch eine ökonomische Betrachtung bzw. Beurteilung der Ausgestaltungen von Bil- dungseinrichtungen und den damit verbundenen Bildungsprozessen.
Peter Mitterer, BA 51816247 Seite 16
2.2. Bildungsökonomie und - controlling