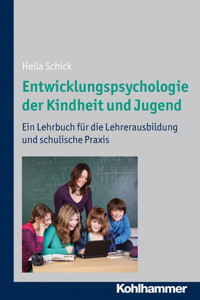
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pädagogen nehmen heute einen erzieherischen Auftrag wahr, der weit über die Vermittlung von Wissen hinausgeht: Sie sollen Lernstand und Leistungsdefizite ebenso erkennen können wie individuelle Lernprozesse und motivationale Ressourcen. Die Entwicklungspsychologie liefert hierfür wichtige Erkenntnisse. In dem Buch wird entwicklungspsychologisches Basiswissen vermittelt, das auch eine vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Teilgebieten ermöglicht. Neben zentralen entwicklungspsychologischen Konzepten wird die Entfaltung von körperlichen, intellektuellen, motivationalen, emotionalen und sozialen Funktionen und Fertigkeiten sowie der Persönlichkeit beschrieben und ihre Bedeutung für das pädagogische Handeln herausgestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pädagogen nehmen heute einen erzieherischen Auftrag wahr, der weit über die Vermittlung von Wissen hinausgeht: Sie sollen Lernstand und Leistungsdefizite ebenso erkennen können wie individuelle Lernprozesse und motivationale Ressourcen. Die Entwicklungspsychologie liefert hierfür wichtige Erkenntnisse. In dem Buch wird entwicklungspsychologisches Basiswissen vermittelt, das auch eine vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Teilgebieten ermöglicht. Neben zentralen entwicklungspsychologischen Konzepten wird die Entfaltung von körperlichen, intellektuellen, motivationalen, emotionalen und sozialen Funktionen und Fertigkeiten sowie der Persönlichkeit beschrieben und ihre Bedeutung für das pädagogische Handeln herausgestellt.
Dr. Hella Schick lehrt am Department Psychologie der Universität zu Köln Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie.
Hella Schick
Entwicklungspsychologie der Kindheit und Jugend
Ein Lehrbuch für die Lehrer- ausbildung und schulische Praxis
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2012 Alle Rechte vorbehalten © 2012 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Umschlagabbildung: © contrastwerkstatt – Fotolia.com Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-020879-7
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028146-2
mobi:
978-3-17-028147-9
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
1 Einführung
1.1 Grundlagen der Entwicklungspsychologie
1.1.1 Definition und Gegenstand
1.1.2 Anspruch entwicklungspsychologischer Forschung
1.1.3 Forschungsmethoden der Entwicklungspsychologie
1.2 Allgemeine Entwicklungspsychologie
1.2.1 Modellvorstellungen über den Entwicklungsverlauf
1.2.2 Erklärungskonzepte: Anlage und Umwelt
1.2.3 Entwicklungsmodelle der Lebensspanne
1.3 Entwicklung und Erziehung
1.3.1 Definition und Gegenstand von schulischer Erziehung
1.3.2 Normative Pädagogik vs. empirische Psychologie
1.3.3 Entwicklungspsychologische Bedingungen von Erziehung
1.4 Entwicklungspsychologie in Erziehung und Unterricht
1.4.1 Schulisch relevante Entwicklungsbereiche
1.4.2 Veränderung von Funktion und Bild des Lehrpersonals
1.4.3 Entwicklungsgeschehen und unterrichtliche Praxis
1.5 Zusammenfassung
2 Körperliche Entwicklung
2.1 Meilensteine pränataler Entwicklung
2.1.1 Entwicklungsgeschehen in der Pränatalzeit
2.1.2 Prä- und perinatale Schädigungen
2.1.3 Bedeutung pränataler Entwicklung für schulisches Lernen
2.2 Meilensteine vorschulischer Entwicklung
2.2.1 Hirnorganische Entwicklung
2.2.2 Motorische Entwicklung
2.2.3 Entwicklungsstand zur Einschulung
2.3 Entwicklung im Schulalter
2.3.1 Bewegungsstatus von Kindern und Jugendlichen
2.3.2 Pubertät
2.3.3 Folgerungen für Lehren und Lernen
2.4 Zusammenfassung
3 Entwicklung kognitiver Funktionen
3.1 Was sind „kognitive Funktionen“?
3.2 Entwicklung der Wahrnehmung
3.2.1 Was ist „Wahrnehmung“?
3.2.2 Entwicklung visueller Wahrnehmung
3.2.3 Entwicklung auditiver Wahrnehmung
3.2.4 Entwicklung intermodaler Wahrnehmung
3.2.5 Wahrnehmung und der Erwerb von Kulturtechniken
3.3 Aufmerksamkeit und Handlungssteuerung
3.3.1 Aufmerksamkeitssystem
3.3.2 Handlungssteuerung
3.3.3 Entwicklung der Aufmerksamkeit
3.3.4 Störungen der Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerung
3.3.5 Aufmerksamkeitsleistungen im Unterricht
3.4 Entwicklung des Denkens
3.4.1 Komponenten des Denkens
3.4.2 Entwicklung des Gedächtnisses
3.4.3 Höhere Funktionen des Denkens
3.4.4 Piaget und die Folgen: Entfaltung der Denkfähigkeit
3.4.5 Entwicklung des Denkens durch Unterricht
3.5 Entwicklung der Sprachfähigkeit
3.5.1 Hirnorganische Voraussetzungen des Spracherwerbs
3.5.2 Komponenten der Sprache
3.5.3 Entwicklung des Sprechens
3.5.4 Störungen der Sprachentwicklung
3.5.5 Mehrsprachigkeit
3.5.6 Sprache und der Erwerb von Kulturtechniken
3.6 Intelligenz
3.6.1 Intelligenzkonzeptionen
3.6.2 „Messung“ von Intelligenz
3.6.3 „Entwicklung“ von Intelligenz
3.6.4 Intelligenz und Schulleistungen
3.6.5 Intellektuelle Hochbegabung
3.7 Entfaltung schulischer Fähigkeiten
3.7.1 Erwerb elementarer Kulturtechniken
3.7.2 Lernen und Wissensaufbau
3.7.3 Entwicklung des Leistungshandelns
3.8 Zusammenfassung
4 Emotionale und Soziale Entwicklung
4.1 Grundlagen sozio-emotionaler Entwicklung
4.2 Emotionale Entwicklung
4.2.1 Emotionen und Emotionalität
4.2.2 Entwicklung emotionaler Kompetenz
4.2.3 Förderung emotionaler Kompetenz
4.2.4 Emotionales Erleben in der Schule
4.3 Entwicklung des Sozialverhaltens
4.3.1 Grundlagen prosozialen Verhaltens
4.3.2 Kooperation und Wettbewerb
4.3.3 Gerechtigkeitssinn und Moralität
4.3.4 Entwicklung sozialer Kompetenz
4.3.2 Entwicklungsstörungen des Sozialverhaltens
4.3.6 Aggressives Verhalten in der Schule
4.4 Soziale Beziehungen im Kindes- und Jugendalter
4.4.1 Funktion und Bedeutung
4.4.2 Entwicklung von Freundschaftsbeziehungen
4.4.3 Entwicklungsstörungen in Peerbeziehungen
4.5 Zusammenfassung
5 Entfaltung der Persönlichkeit
5.1 Selbstkonzept und Identität
5.2 Entwicklung des Selbstkonzepts im Grundschulalter
5.2.1 Entwicklung des allgemeinen Selbstkonzepts
5.2.2 Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts
5.2.3 Schule und Fähigkeitsselbstkonzept
5.3 Identitätsentwicklung im Jugendalter
5.3.1 Entwicklung personaler Identität
5.3.2 Entwicklung nationaler und ethnischer Identität
5.3.3 Identitätsentwicklung und Schule
5.4 Zusammenfassung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Geleitwort
Die Entwicklungspsychologie stellt mittlerweile einen umfangreichen und lehrreichen Fundus an Theorien und Befunden auch für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte bereit, wenn es um Fragen geht wie diese: Wie kann ich das Erleben und Handeln von Schülerinnen und Schülern auf dem Hintergrund ihrer Entwicklung verstehen und einordnen? Wie kann ich alterstypischen Entwicklungsproblemen, die Auswirkungen auf das schulische Lernen haben, angemessen begegnen? Wie kann ich einen erfolgreichen Unterricht gestalten, der auf das Entwicklungsniveau in den verschiedenen Jahrgangsstufen abgestimmt ist?
Für die Beantwortung solcher Fragen ein geeignetes Lehrbuch zu fi nden, war bislang nicht recht möglich. Denn die meisten entwicklungspsychologischen Lehrbücher stellen vornehmlich die Systematik des Faches, aber nur randständig den Bezug zu schulrelevanten Themen her.
Mit dem vorliegenden Buch wird endlich diese Brücke geschlagen. Dem Leser werden die schulrelevanten Bezüge und Anwendungsmöglichkeiten des entwicklungspsychologischen Wissens anschaulich vor Augen geführt, Kapitel für Kapitel. Dabei führt das Buch in vier zentrale Stränge der Entwicklung ein: die körperliche Entwicklung, die Entwicklung der kognitiven Funktionen (Wahrnehmen, Handlungssteuerung, Denken, Sprechen, Intelligenz und die Entfaltung schulischer Fähigkeiten), die emotionale und soziale Entwicklung sowie die Entfaltung der Persönlichkeit (Identität und Selbstkonzept) als Integration der psychischen Komponenten. Darauf aufbauend wird der Stand der Forschung zu den zugehörigen schulrelevanten Aspekten schlüssig und prägnant zusammengefasst wie z. B. zu ADHS-Kinder im Unterricht, Schrift- und Zweitspracherwerb, Hochbegabung, Lernstörungen insbesondere beim Erwerb von Lesen, Schreiben und „Rechnen“, Peerbeziehungen und deren Störungen, Bullying. Einschlägige Literaturhinweise zum vertiefenden Lesen runden das Bild ab.
Indem das Buch der Systematik des Faches in den vier Entwicklungssträngen folgt und die schulrelevanten Themen dazu in Beziehung setzt, ergibt sich ein zweifacher Nutzen für den Leser: Er erfährt einen systematischen Überblick über zentrale Befunde der entwicklungspsychologischen Forschung, und er erfährt eine Verortung der schulrelevanten Themen und Probleme. Daher kann ich dem am schulischen Lehren und Lernen interessierten Leser dieses Lehrbuch nachhaltig und mit Überzeugung empfehlen. Ich wünsche dem Leser ein erkenntnisreiches Lesen und dem Buch seinen ihm gebührenden Platz in der Reihe an entwicklungspsychologischen Lehrbüchern.
Münster, im Februar 2011
Manfred Holodynski
Vorwort
Lehrerinnen und Lehrer nehmen heutzutage in der Schule einen erzieherischen Auftrag wahr, der weit über die reine Vermittlung von Kulturtechniken und Wissensbeständen hinausgeht. So wird in den von der Kultusministerkonferenz festgeschriebenen Standards zur Lehrerbildung der Ausbildung diagnostischer Kompetenzen ein hoher Stellenwert eingeräumt und es werden konkrete Anforderungen formuliert, denen die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer genügen soll: Sie sollen nicht nur Lernstand und Leistungsdefi zite erkennen, sondern auch individuelle Lernprozesse analysieren, intellektuelle Begabungen erkennen sowie motivationale Ressourcen identifi zieren und aktivieren können.
Die Entwicklungspsychologie stellt Lehrkräften für diese Aufgaben wichtige Erkenntnisse zur Verfügung: Wissen über typische Verläufe in speziellen Entwicklungsbereichen und ihre Störungen hilft, die individuelle Lernentwicklung zu beurteilen. Wissen über altersabhängige Entwicklungsvorgänge hilft einzuschätzen, was wann erwartet und erreicht werden kann. Wissen über Anforderungen im Entwicklungsverlauf und über den Einfl uss von besonderen Lebensumständen hilft abzuschätzen, wann Interventionen notwendig sind und wer anzusprechen ist.
Das vorliegende Buch will Studierenden des Lehramtes im Primar- und Sekundarbereich ein entwicklungspsychologisches Basiswissen vermitteln, das es ihnen ermöglicht, sich mit speziell interessierenden Teilgebieten vertieft auseinanderzusetzen. Die Ausführungen beziehen sich entsprechend vorwiegend auf die Entwicklung im frühen, mittleren und höheren Schulalter. In einem einführenden ersten Kapitel werden zunächst die zentralen entwicklungspsychologischen Konzepte und Forschungsmethoden vorgestellt, um die Grundlage für ein Verständnis der Besonderheiten des Aufwachsens im Gesamtzusammenhang der Entwicklung zu schaffen und in ihrer Bedeutung für das pädagogische Handeln zu begreifen. In vier inhaltlichen Kapiteln werden dann die Entfaltung von körperlichen, intellektuellen, emotionalen und sozialen Funktionen und Fertigkeiten sowie zentrale Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung beschrieben. Nach der Vorstellung der neurowissenschaftlichen Grundlagen und der zentralen entwicklungspsychologischen Aspekte erfolgt jeweils eine Diskussion der Befunde hinsichtlich ihrer pädagogisch-psychologischen Implikationen im Schulalltag: Es wird aufgezeigt, wo diese (auch im Hinblick auf Fehlentwicklungen) die Möglichkeiten der schulischen Erziehung tangieren, und es werden Hinweise für den praktischen Umgang mit diesen Besonderheiten im Schulalltag aus den vorgestellten Theorien und Befunden abgeleitet. Literaturhinweise am Ende jedes Abschnitts erleichtern die vertiefende Beschäftigung mit den besprochenen Themen und/oder speziellen Aspekten.
Dieses Buch verdankt seine Entstehung und die spezifi sche Aufbereitung der Inhalte nicht zuletzt den Fragen und Diskussionen, die sich im Rahmen meiner Lehrveranstaltungen für Studierende des Lehramtes ergeben haben. Dem Lektorat des Kohlhammer-Verlages und insbesondere Ulrike Merkel möchte ich herzlich danken für die Geduld und engagierte Unterstützung bei der Fertigstellung des Buchprojektes. Mein besonderer Dank gilt Mirko Knicker für seine kritische Durchsicht und Kommentierung des Manuskripts aus der Perspektive eines Lehramtsanwärters, Prof. Hilde Haider für ihre hilfreichen Anmerkungen aus der Sicht einer Kognitionspsychologin und Prof. Manfred Holodynski für die freundliche Erstellung des Geleitwortes.
Bonn, im September 2011
Hella Schick
1 Einführung
1.1 Grundlagen der Entwicklungspsychologie
1.1.1 Definition und Gegenstand
Der Begriff „Entwicklung“ geht sowohl auf das lateinische explicare als auch das französische évoluer zurück und meint etwas, das sich allmählich herausbildet (vgl. Kluge, 2002). In dieser Umschreibung sind die Aspekte Richtung, Veränderung und Zeitbezug enthalten. Der Begriff „Entwicklung“ kann damit zunächst ganz allgemein bestimmt werden als eine zielgerichtete Veränderung, die auf der Zeitachse beobachtet wird. In der Entwicklungspsychologie werden als Zeitvariable die Abschnitte des Lebenslaufes gesetzt.
Eine Veränderung wird im Verständnis der traditionellen Entwicklungspsychologie jedoch nur dann als Entwicklungsgeschehen aufgefasst, wenn neben der Zielgerichtetheit (auch: Unidirektionalität) auf einen qualitativ immer höherwertigen Endzustand hin drei weitere Kriterien erfüllt sind: Erstens muss es sich um eine Veränderung handeln, die trotz unterschiedlicher Entwicklungsbedingungen in allen Kulturen so oder so ähnlich wiederzufinden ist (Universalitätskriterium). Zweitens muss es sich um eine Veränderung qualitativstruktureller und nicht nur quantitativer Art handeln. Und drittens muss die Veränderung nachhaltig sein, d. h. sie muss eine dauerhafte Wirkung auf nachfolgendes Geschehen haben und wird nicht mehr verloren gehen (Irreversibilitätskriterium).
Tatsächlich ist die menschliche Entwicklung jedoch deutlich vielgestaltiger, als es mit dieser engen Definition fassbar ist: Unterschiedliche Merkmale verändern sich auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten (Multidimensionalität), es gibt keine universell gültigen Zielzustände (Multidirektionalität) und Entwicklungsveränderungen haben in der Regel nicht singuläre, sondern multiple Ursachen (Multikausalität, vgl. Rothgang, 2009). In der modernen Entwicklungspsychologie wurde deshalb die oben beschriebene Entwicklungsdefinition erweitert: Als „Entwicklung“ werden heute sämtliche Veränderungen im Rahmen der Individualentwicklung (Ontogenese) verstanden, die relativ überdauernd sind, einen inneren Zusammenhang aufweisen und mit dem Lebensalter in Zusammenhang stehen (vgl. z. B. Trautner, 2006; Montada, 2008a; Berk, 2005; Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2008).
Die Wurzeln der Entwicklungspsychologie reichen bis in die Antike zurück. Schon in der vorwissenschaftlichen Zeit wurden Beschreibungen der Entwicklung und des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen publiziert. Erste Schriften finden sich bereits bei Platon (z. B. „Gesetze“) und Aristoteles (z. B. „Nikomachische Ethik“). Im Mittelalter war in der europäischen Welt die Vorstellung verbreitet, Kinder seien bereits kleine Erwachsene und als solche zu behandeln (vgl. Lück, 2009). Erst bei den Philosophen der Aufklärung (z. B. Locke, 1690/2006, 1693/2007; Rousseau, 1762/1998) finden sich wieder Schriften, die sich mit der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter beschäftigen und eine Anpassung des pädagogischen Handelns an die Entwicklungsbesonderheiten dieser Altersphase fordern. Die Anfänge einer wissenschaftlichstandardisierten Annäherung an die Besonderheiten kindlicher Entwicklung finden sich z. B. bei Tetens (1777; Forderung nach Verwissenschaftlichung der Entwicklungspsychologie), Tiedemann (1787; Systematisierung von Verhaltensbeobachtung), Quetelet (1835/1914; Einführung statistischer Methoden) und Preyer (1882/2007; Systematisierung der biografischen Methode; vgl. Trautner, 2003, S. 15ff.). Die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Veröffentlichungen Darwins (1860/2008, 1871/2010) angeregte Verknüpfung von Entwicklungsdenken und Biologie brachte viele Aufzeichnungen von Beobachtungen kindlichen Aufwachsens hervor, aber auch tierpsychologische und völkerpsychologische Studien (vgl. Weinert & Weinert, 2006). Auch die mit Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzende systematisch-empirische Erforschung allgemeiner Veränderungen des Aufwachsens beschränkte sich weiter größtenteils auf das Kindes- und Jugendalter, da die Vorstellung, Entwicklung sei mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter abgeschlossen, weit verbreitet war (Petermann & Schneider, 2008). Eine Erweiterung der Forschungsperspektive auf die gesamte Lebensspanne ist verstärkt seit Ende der 1960er Jahre zu beobachten (siehe unten Abschnitt 2.2.2). Einen Grund sehen Siegler, DeLoache und Eisenberg (2008) in der veränderten Lebenserwartung sowie der robusteren Gesundheit und damit einhergehenden größeren Aktivität älterer Menschen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts stehen zudem verstärkt differentielle Betrachtungen sowohl spezieller Entwicklungsbereiche als auch interindividueller Unterschiede von Entwicklungsverläufen im Mittelpunkt der Forschung. Zunehmend wird in diesem Zusammenhang auch den Störungen normaler Entwicklung, Veränderungen auf Grundlage spezieller Voraussetzungen oder Defizite sowie den Besonderheiten der Entwicklung spezieller Gruppen (z. B. Hochbegabte, Migranten, Hochbetagte) Aufmerksamkeit geschenkt (Montada, 2008a).
Dollase (1985, S. 5) sieht Entwicklung und Veränderung als „fraglos wichtige(n) Aspekt jedes psychologischen Phänomens“. Die Entwicklungspsychologie stellt sich heute als ein vielfältig differenziertes Teilgebiet der Psychologie dar, das auf alle Grundlagenfächer der Psychologie (Allgemeine Psychologie, Biologische Psychologie, Differentielle Psychologie, Sozialpsychologie) rekurriert und mit verschiedenen anderen Wissenschaftsdisziplinen vernetzt ist (z. B. Medizin, Biologie, Soziologie, Kulturanthropologie, Ethologie). Sie definiert sich dabei durch ihren besonderen Fokus, nämlich die Betrachtung der Veränderungen und Stabilitäten der Phänomene menschlichen Erlebens und Verhaltens im Lebenslauf (vgl. Trautner, 2006; Montada, 2008a).
Literaturhinweis
Trautner, H. M. (2003). Allgemeine Entwicklungspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
1.1.2 Anspruch entwicklungspsychologischer Forschung
Die Entwicklungspsychologie befasst sich also mit der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von zielgerichteten, geordneten und nachhaltigen Veränderungen im Lebenslauf. Gegenstand dieser Betrachtung sind alle im Zusammenhang mit der Ausreifung körperlicher Funktionen, Entfaltung der Persönlichkeit und Erlangung von Handlungskompetenzen stehende Phänomene. Dazu zählen Überzeugungen, Interessen, Motive und Selbstkonzepte ebenso wie die körperliche Reifung, die Entfaltung kognitiver Funktionen, die Kontrolle emotionaler Reaktionen und die Prozesse der Aneignung von motorischen, sozialen und intellektuellen Fertigkeiten.
Ziel der Forschungsbemühungen ist es einerseits, Wissen über „typische“ Entwicklungsverläufe bereitzustellen und die Entwicklungsbedingungen zu identifizieren, unter denen einen Entwicklung „normal“ verlaufen kann. Andererseits sollen auch die Entwicklungsbedingungen identifiziert werden, die Entwicklungsprozesse behindern oder die Entwicklungsprozesse optimieren helfen. Solche Erkenntnisse unterstützen die Beratung von Eltern genauso wie die Begründung sozialpolitischer Entscheidungen, bilden aber auch die Grundlage für das Verständnis des Wesens des Menschen allgemein (Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2008).
Moderne entwicklungspsychologische Forschung dient also zwei Zielen: der Bereitstellung von Basiswissen über das Entwicklungsgeschehen (Grundlagenforschung) und der Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung von Entwicklungsprozessen (Anwendungsforschung) bzw. Vermeidung von Entwicklungsbeeinträchtigungen (Präventionsforschung). Sie berücksichtigt dabei die Perspektive der Veränderung über die gesamte Lebensspanne und den Einfluss biologischer Prozesse genauso wie den Einfluss der Bedingungen des Aufwachsens (ökologische Perspektive). Neben der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage interessiert also auch die Frage nach Möglichkeiten der Beeinflussung menschlichen Erlebens und Verhaltens. Denn aus Alterskurven und Normtabellen über die Entfaltung körperlicher und psychischer Funktionen kann z. B. abgeleitet werden, wie Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersstufen Lehrstoff angemessen vermittelt werden kann (Berk, 2005). Aus diesem Anspruch heraus etablierte sich die „Angewandte Entwicklungspsychologie“ als neue Teildisziplin der Psychologie. Diese versteht sich als eigenständiges Anwendungs- und Forschungsfeld, das unter starker Betonung der Lebensspannenperspektive, der Entwicklung in natürlichen Kontexten sowie der Einbeziehung nahezu aller menschlichen Lebensbereiche unter individueller wie familiärer Perspektive Entwicklungsprozesse beschreibt und zu optimieren sucht. Als zentrale Aufgaben gelten Entwicklungsdiagnostik, entwicklungsorientierte Intervention sowie die Ermittlung präventions- und bewältigungsorientierter Maßnahmen (Petermann & Schneider, 2008).
Literaturhinweis
Trautner, H. M. (2003). Allgemeine Entwicklungspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
1.1.3 Forschungsmethoden der Entwicklungspsychologie
Die Basis entwicklungspsychologischer Forschung ist wie in den anderen Fächern der Psychologie auch die Einhaltung bestimmter Forschungsstandards. Grundlegend sind die Realisierung von Objektivität (Unabhängigkeit des Messergebnisses vom Untersucher: Gelangt ein anderer Untersucher unter den gleichen Umständen zum selben Messergebnis?), Reliabilität (Zuverlässigkeit des Messergebnisses: Wird bei wiederholter Messung unter gleichen Umständen das gleiche Messergebnis erzielt?) und Validität (Gültigkeit des Messergebnisses: Sind die erhobenen Kennzahlen inhaltlich geeignet, die Forschungsfrage zu beantworten?). Ein Forschungsvorgehen, das diesen Standards genügen will, zeichnet sich durch die Einhaltung folgender Eckpunkte aus:
Das Untersuchungsinstrument wird theoriegeleitet sorgfältig ausgewählt bzw. konstruiert und erprobt.
Das Untersuchungsvorgehen ist maximal standardisiert, d. h. die Untersuchung wird auf immer dieselbe Weise und möglichst unter immer denselben Bedingungen durchgeführt.
Das Untersuchungsvorgehen und die speziellen Bedingungen der Durchführung werden genau dokumentiert in späteren Veröffentlichungen transparent gemacht.
Es wird darauf geachtet, dass die Stichprobe ein adäquates Abbild der Grundgesamtheit darstellt, d. h. sie ist im Hinblick auf die gewählte Auswertungsmethode groß genug und berücksichtigt relevante Untergruppen (Subpopulationen) in einem angemessenen Verhältnis.
Eine ggf. notwendige Zuweisung zu unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen wird nach dem Zufallsprinzip („randomisiert“) vorgenommen.
Darüber hinaus kommt der Einhaltung ethischer Standards gerade bei Untersuchungen im Kindes- und Jugendalter eine große Bedeutung zu:
Die Untersuchungspartnerinnen und Untersuchungspartner nehmen ausschließlich freiwillig teil und willigen nach erfolgter Aufklärung ein (sog. informierte Einwilligung).
Die Anonymität wird sichergestellt.
Das Untersuchungsvorgehen führt zu keiner Schädigung.
Das Vorgehen wird nach der Untersuchung transparent gemacht.
Die Ergebnisse werden den Untersuchungspartnerinnen und Untersuchungspartnern auf verständlichem Niveau zur Kenntnis gebracht und erklärt.
Die gebräuchlichsten Datenerhebungsmethoden der Entwicklungspsychologie sind standardisierte Testverfahren, die Beobachtung von Verhalten und die mündliche wie schriftliche Befragung.
Standardisierte Testverfahren kommen z. B. im Rahmen einer Entwicklungsdiagnostik zum Einsatz. Es handelt sich hier um Verfahren, die für die verschiedensten Entwicklungsbereiche Normwerte von Vergleichsgruppen bereitstellen und so eine Einschätzung der Individualleistung hinsichtlich einer Abweichung vom zu erwartenden Leistungsstand ermöglichen. Kurzverfahren (sog. „Screenings“) ermöglichen eine erste Grobeinschätzung im Sinne auffällig vs. unauffällig. Allgemeine Entwicklungstests bieten einen Einblick in ein breites Spektrum der Fertigkeiten eines Kindes. Für die Untersuchung spezieller Entwicklungsbereiche stehen Sprachtests, Intelligenztests, Tests motorischer Verhaltensweisen und Wahrnehmungsfähigkeiten sowie projektive Verfahren (Zeichentests) zur Verfügung. Schultests dienen der Erfassung der Schulfähigkeit (Einschulungsdiagnostik), des Fähigkeitsstandes hinsichtlich verschiedener Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) und des Sozialverhaltens.
Die Verhaltensbeobachtung ist einerseits Teil jeder entwicklungsdiagnostischen Untersuchung und bildet andererseits eine Klasse eigenständiger Datenerhebungsverfahren im Rahmen entwicklungspsychologischer Forschung. Verhaltensbeobachtung als Forschungsmethode kann in naturalistischer Umgebung (z. B. in einer Kindergartengruppe; vgl. Kasten 1 Beispiel a) oder einem eigens dafür hergerichteten Raum (Labor) erfolgen. Ein solches Labor kann von den Probandinnen und Probanden als künstlich geschaffene Untersuchungsumgebung begriffen (z. B. offene Beobachtung bei der Konfrontation mit einer Aufgabe in einem Untersuchungsraum der Universität; vgl. Kasten 1 Beispiel b) oder aber als natürliche Situation aufgefasst werden (z. B. bei Säuglingen Herstellung einer Wartezimmersituation und verdeckte Beobachtung via Einwegspiegel; vgl. Kasten 1 Beispiel c).
Die Beobachtung kann sich auf die Aufzeichnung spontanen Verhaltens beschränken (naturalistische Beobachtung), oder aber die Personen mit vorarrangierten Aufgaben oder Begebenheiten konfrontieren (strukturierte Beobachtung).
Kasten 1.1: Beispiele für Beobachtungssettings
a)Offene Beobachtung in naturalistischer Umgebung Blatchford (2003) untersuchte die Effekte der Klassengröße auf Unterrichtsklima und Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern. 235 Kinder in 39 Klassen (durchschnittlich 33 vs. durchschnittlich 19 Schüler/innen) wurden während verschiedener vordefinierter natürlicher Unterrichtssituationen in 5-Minuten-Einheiten beobachtet. Das Verhalten wurde alle 10 Sekunden hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Aspekte von den Beobachterinnen und Beobachtern im Klassenraum durch Einordnung in ein theoriegeleitet erstelltes Kategoriensystem dokumentiert („Strichliste“). Als Beobachter fungierten erfahrene Lehrkräfte, die sich für die Beobachtung zusätzlich im Hintergrund des Klassenraumes aufhielten. Insgesamt wurden 97 140 Beobachtungseinheiten zu je 10 Sekunden in die Auswertung einbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass in kleineren Klassen zwar häufigere und persönlichere Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern stattfinden, jedoch zeigten die Kinder in großen Klassen ein günstigeres Sozialverhalten. Auch hinsichtlich der Aufmerksamkeitsleistungen schnitten die größeren Klassen besser ab: Die Schüler/innen waren zwar häufiger unaufmerksam, arbeiteten aber insbesondere bei Gruppenaufgaben umso intensiver mit.
b)Offene Beobachtung im Untersuchungslabor
Piaget (z. B. Piaget & Inhelder, 2009; vgl. Kap. 3.4.4) untersuchte die Charakteristika der Denkfähigkeit von Kindern u. a. dadurch, dass er ihnen zwei niedrige, breite Gläser vorsetzte und ein schmales, hohes Glas. In den beiden niedrigen, breiten Gläsern befand sich jeweils exakt gleich viel Flüssigkeit, was Piaget zunächst von den Kindern feststellen ließ. Die Flüssigkeit aus einem der beiden Gläser wurde danach vor den Augen des Kindes in das hohe, schmale Glas gegossen. Die Kinder wurden dann befragt, was sie denken würden: Dass nun nach dem Umfüllen in dem einen der beiden flüssigkeitsgefüllten Gläser weniger bzw. mehr Flüssigkeit enthalten sei als in dem anderen oder ob in beiden gleich viel Flüssigkeit enthalten sei. Typischerweise antworteten Kinder bis zum Alter von etwa neun Jahren, dass in dem schmalen, hohen Glas mehr Flüssigkeit enthalten sei als in dem breiten, flachen. Ältere Kinder antworten hingegen korrekt, nämlich dass auch nach dem Umfüllen in beiden Gläsern gleich viel Flüssigkeit enthalten sei („Volumeninvarianz“).
c)Verdeckte Beobachtung im Labor via Einwegspiegel
Um Aufschluss über die Qualität der Beziehung von Müttern und Kleinkindern zu erhalten („Bindung“, vgl. Kap. 4.1), untersuchten Ainsworth und Mitarbeiter/innen (z. B. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978), wie Kleinkinder reagieren, wenn sie kurzzeitig allein gelassen werden („strange situation test“). Die Kinder wurden in einen Laborraum gebracht, der mit allem ausgestattet war, was ein Wartezimmer z. B. bei einem Arztbesuch ausmacht. Das Kind betrat mit der Mutter den Raum, in dem sich bereits eine andere erwachsene Frau mit einer Zeitschrift die Zeit vertrieb. Die Mutter führte das Kind an das bereitgestellte Spielzeug heran und verließ den Raum, als das Kind sich ins Spiel vertieft hatte. Das Verhalten des Kindes wurde über einen Einwegspiegel aus einem benachbarten Raum heraus beobachtet und dokumentiert. Die Kinder reagierten unterschiedlich: Die meisten Kinder fingen an zu weinen, nachdem die Mutter den Raum verlassen hatte, einige ließen sich jedoch recht gut von der fremden Erwachsenen trösten, spielten nach kurzer Zeit weiter und reagierten freudig auf die Rückkehr der Mutter („sichere Bindung“). Andere ließen sich durch die fremde Erwachsene nicht beruhigen, sie fanden bis zur Rückkehr der Mutter nicht mehr ins Spiel hinein, klammerten sich bei ihrer Rückkehr sowohl an sie, brachten aber gleichzeitig auch Wut über ihr Weggehen zum Ausdruck („unsicher-ambivalente Bindung“). Eine dritte Gruppe spielte trotz Abwesenheit der Mutter scheinbar unbeeindruckt weiter und reagierte auch kaum auf ihre Wiederkehr. Allerdings zeigten Messungen physiologischer Parameter wie der Herzschlagrate, dass bei diesen Kindern das höchste Stresserleben vorlag („unsicher-vermeidende Bindung“).
Personen mit vorarrangierten Aufgaben oder Begebenheiten zu konfrontieren und ihre Reaktionen zu beobachten entspricht dem sog. experimentellen Vorgehen in der Psychologie, wenn bestimmte zusätzliche Randbedingungen erfüllt sind:
Die vorgegebenen Aufgaben bzw. Begebenheiten werden auf Basis einer Hypothese generiert, das sog.
hypothesengeleitete Vorgehen
.
Die Vorgabe der Aufgaben erfolgt auf die immer gleiche Weise (Standardisierung).
Die Vorgabe der Aufgaben erfolgt an eine
zufällig
ermittelte Gruppe von Personen und ihre ebenso zufällige Aufteilung auf die Untersuchungsbedingungen (Randomisierung).
Die Vorgabe der Aufgaben erfolgt unter
systematischer Variation
der vorgegebenen Aufgaben bzw. Begebenheiten (experimentelle Kontrolle der unabhängigen Variablen).
Die Vorgabe der Aufgaben erfolgt unter
Ausschaltung von störenden Umgebungsreizen
(Störvariablen).
Die Vorgabe der Aufgaben erfolgt unter
systematischer Beobachtung
der Effekte (der Veränderungen in den abhängigen Variablen).
Nur ein solches Vorgehen lässt den Schluss zu, dass das beobachtete Verhalten ursächlich durch die gestalteten Bedingungen hervorgerufen wird. Dieser Zusammenhang ist umso sicherer anzunehmen, je höher der Standardisierungsgrad der Beobachtungssituation ist (interne Validität).
Ein zunehmender Standardisierungsgrad bringt es jedoch mit sich, dass sich die Beobachtungssituation zunehmend der natürlichen Umgebung entfremdet: Das zu beobachtende Verhalten wird aus dem in natürlichen Situationen gezeigten komplexen Gesamtverhalten herausgelöst. So wird fraglich, ob in einer realen Situation unter den gegebenen Bedingungen das Verhalten in derselben Weise wie in der Untersuchungssituation hervorgerufen wird (externe Validität). Zudem liefert dieses Vorgehen keine Einsichten in das subjektive Erleben der Individuen.
Diese Möglichkeit eröffnet die Befragungsmethode. Eine Befragung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Auch bei der Befragung kann ein unterschiedlicher Standardisierungsgrad realisiert werden. So können im Rahmen eines Interviews als mündlicher Befragungsmethode die Fragen so eng gestellt werden, dass sie nur knappe Antworten im Sinne der Fragestellung evozieren. Sie können aber auch so weit gefasst sein, dass sie zu längeren Ausführungen zu unterschiedlichen Aspekten des Frageinhaltes anregen. Im Rahmen einer schriftlichen Befragung können standardisierte Messinstrumente zur Selbstbeurteilung (z. B. Persönlichkeitsfragebögen) vorgelegt werden, knappe Antworten im Rahmen von Satzergänzungstests erbeten oder aber so weite Fragen zur Beantwortung vorgelegt werden, dass sie eine ausführliche Stellungnahme zu dem Frageinhalt ermöglichen (z. B. in Form eines Aufsatzes). Eine mündliche Befragung bietet den Vorteil, Nachfragen stellen zu können, jedoch bedingt sie in der Regel einen Einzelkontakt. Der Vorteil einer schriftlichen Befragung liegt in ihrer Ökonomie, da sie als Gruppenerhebungsverfahren eingesetzt werden kann.
Während Beobachtungsverfahren gerade auch unter Realisierung eines experimentellen Designs schon bei Säuglingen oder gar pränatal eingesetzt werden können, eignen sich Befragungsmethoden erst, wenn eine zureichende sprachliche Kompetenz und ggf. auch Reflexionsfähigkeit erreicht ist. Sie können dann auch in Verbindung mit experimentellen Designs als zusätzliche Informationsquelle genutzt werden. Entwicklungspsychologisch besonders interessant ist zudem die Analyse von spontan (nichtreaktiv) über die Zeit entstandenen Dokumenten wie Tagebüchern oder Bildern und Zeichnungen.
Datenauswertungsstrategien dienen dem Zweck, Prognosen zukünftigen Verhaltens auf der Basis belastbarer statistischer Daten zu ermöglichen. In der Entwicklungspsychologie werden insbesondere drei Datenauswertungsstrategien verfolgt: die Auszählung von Häufigkeiten, die unterschiedshypothetische Betrachtung und die korrelationsstatistische Betrachtung.
Die Auszählung von Häufigkeiten kommt vorwiegend bei der Analyse qualitativer Daten zum Einsatz. Dazu zählen die oben beschriebenen naturalistischen Beobachtungsdaten, Daten, die durch Interviews, offene schriftliche Befragungsmethoden und die Analyse von nichtreaktiv entstandenen Dokumenten gewonnen wurden. Sie steht häufig in Verbindung mit einer inhaltsanalytischen Auswertung (Rustemeyer, 1992; Groeben & Rustemeyer, 2001), bei der das Datenmaterial in kleine Einheiten zerlegt wird, zuvor theoriegeleitet erstellten Kategorien zugeordnet und ausgezählt werden. Anschließend wird die Häufigkeit des Auftretens eines Verhaltens/einer Aussage in den unterschiedlichen Kategorien durch ein statistisches Verfahren miteinander verglichen.
Der unterschiedshypothetische und der korrelationsstatistische Ansatz werden vorwiegend bei der Analyse quantitativer Daten eingesetzt.
Bei einer korrelationsstatistischen Betrachtung wird danach gefragt, ob in einer Gruppe ein Zusammenhang zwischen zwei oder mehr der untersuchten Variablen besteht: Geht die Erhöhung der Ausprägung in einer Variablen mit einer Erhöhung (positiver Zusammenhang) oder Erniedrigung (negativer Zusammenhang) in einer anderen Variable einher? Es werden hier also „Je-desto-Beziehungen“ untersucht, die auch auf die Variable der Gruppenzugehörigkeit erweiterbar sind. Damit kann jede unterschiedshypothetische Fragestellung in eine zusammenhangshypothetische Fragestellung überführt werden (vgl. Bortz, 2005).
Ziel beider Auswertungsvorgehensweisen ist es, einen möglichst hohen Anteil der Streuung der Messwerte (Varianz) in den beobachteten Merkmalen erklären zu können, denn daraus ergibt sich die zu erwartende Prognosesicherheit. Statistische Auswertungsmethoden berücksichtigen dabei die stichprobenbedingte unterschiedliche Variabilität der Merkmale. Im unterschiedshypothetischen Ansatz wird diese jedoch auf die Mittelwerte und ihre Streuungen reduziert (z. B. uni- und multivariate Varianzanalyse), weil die Vielzahl der Messwerte künstlich zu Gruppen von Messwerten zusammengefasst und in der Folge nur noch mit den Mittelwerten weiter verfahren wird. Dies suggeriert eine größere Unterschiedlichkeit der Gruppen, als sie tatsächlich mit den Daten belegt ist. Der korrelationsstatistische Ansatz (z. B. bivariate Korrelation, multiple Regression) bezieht hingegen die ganze Bandbreite der erhobenen Werte ein (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003). Zudem erlauben es Weiterentwicklungen dieses Ansatzes, multiple Beziehungsgeflechte auch unter Berücksichtigung von Einflüssen aus Messfehlern, parallel erhobenen Variablen und Klassenzugehörigkeiten zu modellieren (Strukturgleichungsmodelle, hierarchisch lineare Modelle). Diese können die in naturalistischen Kontexten vorgefundenen komplexen Bedingungszusammenhänge angemessener nachbilden, als dies mit einem unterschiedshypothetischen bzw. bivariaten Auswertungsverfahren möglich ist. Da diese Verfahren jedoch sehr große Stichproben mit mehreren Hundert Probandinnen und Probanden erfordern, müssen sehr ökonomische Datenerhebungsstrategien eingesetzt werden. Der oben beschriebene gegenläufige Mechanismus von interner und externer Validität (hohe Standardisierung führt zu Messgenauigkeit, aber bedingt eine Reduzierung der Komplexität des Kontextes und schränkt damit die Generalisierbarkeit auf natürliche Situationen ein), setzt sich so auch hinsichtlich der Datenauswertung fort (vgl. Bortz, 2005).
Durch laborexperimentelles Vorgehen kann die Ursache-Wirkungsrichtung einer untersuchten Beziehung genau bestimmt werden und die Reduzierung von Störreizen führt dazu, dass ein großer Anteil der Varianz in der interessierenden Variablen durch die untersuchten Merkmale aufgeklärt werden kann. Jedoch erfordert diese Methode eine Reduzierung auf bivariate Zusammenhänge und der hohe Untersuchungsaufwand lässt häufig nur die Untersuchung kleiner Stichproben und damit eine unterschiedshypothetische Auswertung zu. Befragungsverfahren zeichnen sich hingegen durch eine hohe Ökonomie aus, und es können mit relativ wenig Aufwand große Stichproben für komplexe Analysen gewonnen werden. Jedoch bleibt die Verursachungsrichtung in einer korrelationsstatischen Analyse per definitionem unbestimmt und durch die mangelnde Kontrollmöglichkeit von Störreizen ist der Anteil an aufgeklärter Varianz in der Regel klein (vgl. Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003).
Ein Kompromiss kann eine Datenerhebung durch ein sog. feldexperimentelles Vorgehen sein. Die feldexperimentelle Methode ist eine Bezeichnung für eine Klasse von Erhebungsverfahren, die in einer natürlichen Umgebung durchgeführt werden (dem sog. Feld), z. B. einer Schulkasse, gleichzeitig aber auch die Merkmale eines experimentellen Vorgehens erfüllt, d. h. dass z. B. Schulklassen zufällig auf unterschiedliche Untersuchungsbedingungen verteilt und Störreize weitgehend ausgeschaltet werden. Ein solches Vorgehen lässt mit gewissen Einschränkungen ebenfalls sowohl eine Aussage über die Richtung der Abhängigkeiten zu als auch die ökonomische Erhebung größerer Stichproben – und damit die Modellierung der interessierenden Zusammenhänge in komplexen Bedingungsgefügen (vgl. Lamnek, 2005).
Eine Besonderheit entwicklungspsychologischer Forschung besteht in dem hohen Anteil von Untersuchungen im Feld (z. B. Beobachtungsstudien in Kindergärten und Schulen) sowie dem relativ häufigen Einsatz qualitativer Verfahren. Qualitative Verfahren zeichnen sich durch eine große Offenheit gegenüber den möglichen Antworten der Untersuchungspartnerinnen und Untersuchungspartner aus. So werden Fragen in einem Interview maximal offen gestellt, die ganz individuelle – aber damit eben auch auf den ersten Blick nicht miteinander vergleichbare – Antworten evozieren. Oder aber es wird ganz darauf verzichtet, die Untersuchungspartnerinnen und Untersuchungspartner in irgendeiner Weise in ihrem Verhalten zu lenken, z. B. bei einer Beobachtung im Feld. Auch Untersuchungen, die allein auf nichtreaktiv entstandenen Dokumenten basieren (z. B. Kinderzeichnungen oder Tagebücher) zählen zur Klasse der qualitativen Verfahren. Die Stichproben sind in der Regel klein, u. U. bestehen sie auch nur aus einer Person (Einzelfallbetrachtung). Die Aussagefähigkeit solcher Verfahren ist natürlich stark eingeschränkt, allerdings gewähren sie einen intensiven Einblick in das subjektive Erleben der Individuen. Sie werden deshalb insbesondere als Ergänzung zu der oben beschriebenen quantitativen Methodik zunehmend geschätzt. Ein Überblick über die Möglichkeiten qualitativer entwicklungspsychologischer Forschung findet sich bei Mey (2005).
Das originäre Anliegen entwicklungspsychologischer Forschung ist es, Daten über Veränderungen im Lebenslauf zu gewinnen. Städtler (1998) stellt jedoch fest, dass die meisten empirischen Untersuchungen, die unter entwicklungspsychologischer Perspektive unternommen werden, nicht im eigentlichen Sinne entwicklungspsychologisch sind: Denn sie unternehmen vielfach lediglich einen Vergleich von Ausprägungen in spezifischen Persönlichkeitsbereichen in unterschiedlichen Altersgruppen (Querschnittmethode). Problematisch ist daran, dass aus den punktuell erhobenen, gemittelten Daten auf die Entwicklungslinien von Individuen geschlossen wird. Dieser „zentrale systematische Fehler“ („central systematic error“, Valsiner, 2000, S. 77; siehe auch Valsiner, 2006) wird – wenn die Gruppen altersmäßig weit genug auseinanderliegen – durch den sog. Kohorteneffekt verstärkt: Individuen wachsen eben nicht in immer denselben Bedingungen eines gegebenen kulturellen Kontextes auf, sondern epochale Besonderheiten (z. B. Krieg, Wirtschaftskrisen genauso wie geänderte Lehrpläne) nehmen einen großen Einfluss auf die jeweiligen Entfaltungsmöglichkeiten.
Ein solches querschnittliches Untersuchungsdesign geht damit streng genommen eher einer allgemeinpsychologisch oder differenzialpsychologisch angelegten Fragestellung nach als einer entwicklungspsychologischen. Die originär entwicklungspsychologische Perspektive wird tatsächlich nur erfasst, wenn dieselben Personen über einen längeren Zeitraum in den interessierenden Merkmalen beobachtet werden. Dieses als Längsschnittmethode bezeichnete Forschungsvorgehen ist insbesondere für die Angewandte Entwicklungspsychologie von großer Bedeutung, weil Prognosen über einen langen Entwicklungszeitraum gestellt werden sollen. Längsschnittuntersuchungen benötigen allerdings einen sehr hohen Aufwand bei der Durchführung. Zudem sind sie ihrerseits durch methodenbedingte Probleme belastet: So reduziert sich aufgrund der langen Durchführungsdauer ein relativ hoher Prozentsatz an Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach und nach aus („Drop-out“), was immer dann problematisch ist, wenn sich eine Systematik abzeichnet hinsichtlich der Merkmale der Personen, die ausscheiden bzw. dabeibleiben, da dadurch die Stichprobe ihre Repräsentativität für die Gesamtpopulation verliert. Ein weiteres Problem sind Verzerrungen im Antwortverhalten, die sich einstellen, wenn die Probandinnen und Probanden durch entweder immer denselben oder gerade wechselnde Untersuchungsleiterinnen und Untersuchungsleiter befragt werden (Testleitereffekte). Ein ähnliches Problem sind Verzerrungen im Antwortverhalten durch Ermüdungs- oder Trainingseffekte aufgrund der Konfrontation mit dem notwendigerweise immer gleichen Untersuchungsmaterial (Testungseffekte).
Auch für den Vergleich von Quer- vs. Längsschnittmethode ist also der gegenläufige Effekt zu konstatieren, dass eine hohe Ökonomie zur Einschränkung der Aussagekraft einer Untersuchung führt, aussagekräftige Untersuchungen aber wegen des hohen Aufwandes nur mit kleinen Stichproben durchgeführt werden können, was wiederum die Generalisierbarkeit der Aussagen einschränkt. Einen Mittelweg bietet ein Forschungsvorgehen, dass eine Querschnittuntersuchung an mehrere Alterskohorten über einen längeren Zeitraum und eine Längsschnittuntersuchung an denselben Personen über einen kürzeren Zeitraum kombiniert (Kohorten-Sequenz-Plan). Abbildung 1.1 zeigt ein Beispiel eines Kohorten-Sequenz-Planes, wie er von Lehr und Thomae in der Bonner gerontologischen Längsschnittstudie verwendet wurde (Lehr & Thomae, 1987). Die Jahreszahlen entsprechen den Erhebungszeitpunkten, die Zahlen in den Blöcken entsprechen den Probanden/innenzahlen je Kohorte.
Abb. 1.1: Beispiel eines Kohorten-Sequenz-Planes
Literaturhinweis
Mey, G. (Hrsg.). (2005). Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie. Köln: Kölner Studien Verlag.
1.2 Allgemeine Entwicklungspsychologie
1.2.1 Modellvorstellungen über den Entwicklungsverlauf
In der traditionellen Entwicklungspsychologie werden neben der Explikation von Gegenstand, Begriff und Methoden des Faches Beschreibungen typischer menschlicher Entwicklung vorgestellt, die Aussagen über allgemeine Entwicklungsgesetze beinhalten. Diese Beschreibungen werden von den Forscherinnen und Forschern, die sie vornehmen, in Form von Theorien zusammengefasst. Eine Theorie ist eine geordnete und in sich geschlossene Sammlung von Aussagen, welche die Phänomene beschreiben, erklären und vorhersagen wollen, die im Zusammenhang mit dem Aufwachsen stehen. Eine Theorie enthält zumeist auch eine Modellvorstellung über den typischen Entwicklungsverlauf. Modellvorstellungen formalisieren in Ergänzung zur Theorie die Vorstellungen von Kontinuität und Diskontinuität des Entwicklungsverlaufs auf einer metatheoretischen Ebene und verbinden sie mit Erklärungskonzepten über das Zustandekommen von Entwicklungsimpulsen. Modellvorstellungen kommunizieren somit eine Zusammenfassung der Grundannahmen einer Theorie auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau in Form einer grafischen Darstellung. Die in den Theorien der traditionellen Entwicklungspsychologie enthaltenen Modellvorstellungen können bezüglich der in ihnen enthaltenen Grundannahmen zu Theorieklassen (Metatheorien) zusammengefasst werden. Dies sind Wachstumsmodelle, Stufentheorien, Phasentheorien, Modelle wellenförmiger Aufgipfelung und Modelle des Fließgleichgewichts.
Wachstumsmodelle sehen das Entwicklungsgeschehen in Analogie und enger Beziehung zu körperlichem Wachstum und beschreiben diese als kontinuierlich fortschreitende, aufbauende Entwicklung (siehe unten Abb. 1.2 a). Reifung ist das zentrale Erklärungskonzept solcher Theorien.
Stufentheorien begreifen Entwicklung als ein diskontinuierlich, sich abschnittsweise ereignendes Geschehen, das aus einer Abfolge von einmaligen und qualitativ besonderen Abschnitten (Stufen) besteht (siehe unten Abb. 1.2 b). Der Übergang von Abschnitt zu Abschnitt erfolgt abrupt und immer in Richtung auf ein jeweils höheres Entwicklungsziel hin (unidirektional). Stufentheorien postulieren zudem, dass durch den Übergang auf eine neue Stufe alle Entwicklungsbereiche gleichzeitig erfasst werden (synchroner Entwicklungsfortschritt). Stufentheorien betonen ebenfalls den Einfluss von Reifung auf das Entwicklungsgeschehen, ein Einfluss von Übung und Umwelt wird als sehr begrenzt gesehen.
Phasentheorien verstehen in Abgrenzung zu Stufentheorien Entwicklung als einen Prozess des Hinaufschaukelns, der asynchron verläuft: Es stehen jeweils bestimmte Bereiche im Mittelpunkt der Entwicklung; eine Phase wird als ein in gleicher oder ähnlicher Form (periodisch) wiederkehrender Zustand begriffen, der jedoch ein immer höheres Niveau aufweist (siehe unten Abb. 1.2 c). Auch in diesen Theorien wird der Anteil des (endogenen) Reifungsgeschehens stark betont.
In Abgrenzung zu Stufentheorien sehen die Modelle wellenförmiger Aufgipfelung die verschiedenen Entwicklungsbereiche nicht in einem Höher und Niedriger, sondern in einem Nebeneinander angeordnet. Bei einem wellenförmigen Verlauf werden einzelne Entwicklungsbereiche über einen längeren Zeitraum aktuell. Sie weisen dabei Überschneidungen mit den Wellen anderer Bereiche auf, der Übergang zwischen der Aktualisierung von Entwicklungsbereichen ist gleitend (siehe unten Abb. 1.2 d). Modelle wellenförmiger Aufgipfelung weisen eine gewisse Nähe zu Phasenmodellen auf, der wesentliche Unterschied besteht in der Absage an die Betonung der endogenen Determiniertheit, der Berücksichtigung von exogenen Faktoren (bestimmen die Höhe des Gipfels) und der Vorstellung, dass die Entwicklungswellen in den einzelnen Bereichen auch nach ihrem Abklingen in der Gesamtpersönlichkeit wirksam bleiben.
Modellen des Fließgleichgewichts bzw. Regelkreismodellen (siehe unten Abb. 1.2 e) liegt die Annahme zugrunde, dass Entwicklung zu jeder Zeit sowohl Aufbau als auch Abbau einschließt. Der momentane Entwicklungsstand ist stets das augenblickliche Verhältnis der beiden Prozesse zueinander, das durch Ist-Sollwertfühler und -geber in einem labilen Gleichgewicht gehalten wird („Äquilibrium“).
Abb. 1.2: Piktogramme der Modellvorstellungen von Entwicklung
Traditionelle Entwicklungstheorien und Entwicklungsmodelle verdeutlichen die zentralen Denkansätze des Faches. Eine Zuordnung von konkreten Vertretern und ihren Theorien zu diesen Modellvorstellungen fällt jedoch schwer, da sie häufig Aspekte gleich mehrerer Modelle enthalten. So formalisiert zum Beispiel Jean Piaget in seiner Theorie der kognitiven Entwicklung (vgl. Kap. 3.4.4) die Entwicklung des Denkens in einem Stufenmodell, welches das endogene Reifungsgeschehen beim Übergang von Stufe zu Stufe betont. Als Motor von Entwicklung sieht er aber gleichzeitig das Prinzip der Äquilibration, das Bestreben des „Im-Gleichgewicht-Haltens“ von Individuum und Umwelt. Und obwohl Piaget im Sinne eines Stufenmodells vorwiegend (passives) Reifungsgeschehen als ursächlich für das Zustandekommen von Entwicklungsimpulsen (eines Stufenüberganges) sieht, beschreibt er dennoch das Individuum als aktiven Gestalter seiner Entwicklung, da es in spontanen Aktivitäten auf die Umwelt zugeht und sie darin erkennt (vgl. Flammer, 2009).
Bei der Rezeption von traditionellen Entwicklungstheorien ist zudem zu berücksichtigen, dass sie unter dem Einfluss kultureller Wertvorstellungen und epochaler Besonderheiten entstanden sind. Auch wenn diese Theorien wichtige Beschreibungen menschlichen Erlebens und Verhaltens im Kontext des Aufwachsens verfügbar machen, werden sie deshalb heute zumeist kritisch gesehen. Denn sie stehen auf dem Boden ganz bestimmter Annahmen, die zur Zeit ihrer Entstehung handlungsleitend waren, heute jedoch als überholt angesehen werden (z. B. die starke Betonung des Reifungsgeschehens, Entwicklung als Abfolge von Stufen, die Beschränkung von Entwicklung auf das Kindes- und Jugendalter, Betonung von Kontinuität und geordnetem Wandel; vgl. Fuhrer, 2005). Die Reduzierung von Entwicklungstheorien auf die in ihnen enthaltenen Aspekte einer Modellvorstellung des Entwicklungsverlaufs erleichtert es jedoch, sie im Hinblick auf ihre zentralen Bestandteile zu kritisieren und auf ihre Brauchbarkeit hin zu bewerten. Insbesondere gilt dies auch für die in ihnen enthaltenen Erklärungskonzepte für das Zustandekommen von Entwicklungsimpulsen.
Literaturhinweis
Trautner, H. M. (2003). Allgemeine Entwicklungspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
1.2.2 Erklärungskonzepte: Anlage und Umwelt
Um die im Laufe der Entwicklung eintretenden und in den allgemeinen Entwicklungstheorien in ihren typischen Verläufen beschriebenen intraindividuellen Veränderungen zu erklären, können prinzipiell zwei Konzepte herangezogen werden. Das ist einerseits das Konzept der natürlichen Veranlagung, d. h. genetisch bedingter Prozesse, bei denen im Sinne eines biologischen Reifungsgeschehens Entwicklungsimpulse inhärent gegeben sind. Dieser Erklärungsansatz ist in allen oben beschriebenen Modellvorstellungen prominent. Andererseits ist offensichtlich, dass auch der Entwicklungsumwelt, d. h. alle Gegebenheiten der physischen und sozialen Umwelt, ein Erklärungswert zukommt. Die nach wie vor kontrovers diskutierte Frage, welches relative Gewicht (endogenen) Anlage- vs. (exogenen) Umweltfaktoren bei der Erklärung des Entwicklungsgeschehens zukommt, begleitet die Psychologie seit ihrer Entstehung als eigenständige Wissenschaft (vgl. z. B. Flammer, 2009; Montada, 2008a; Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004) und gibt auch heute noch immer wieder Anlass zu teils heftig geführten Diskussionen.
Als Methode der Wahl zur Bestimmung des relativen Anteils von Anlage und Umwelteinfluss dient der Vergleich von Merkmalen bei Verwandten unterschiedlichen Verwandtschaftsgrades unter Variation des Ausmaßes geteilter Umwelt des Aufwachsens: Während Eltern, Kinder, Geschwisterkinder und zweieiige Zwillinge eine genetische Ähnlichkeit von 50 % aufweisen, teilen eineiige Zwillinge normalerweise 100 % ihres genetischen Materials, durch Adoption entstandene Verwandte hingegen teilen 0 % ihres genetischen Materials. Der Anteil geteilter Umwelt variiert mit der Nähe des Alters der Kinder und dem Ort des Aufwachsens: Während bei gemeinsam aufgewachsenen eineiigen Zwillingen eine nahezu hundertprozentige gleiche Entwicklungsumwelt angenommen wird, wird dies bei getrennt aufgewachsenen Geschwistern zu 0 % angenommen. Typischerweise wird ein bestimmtes Merkmal (z. B. Intelligenz) in einer hinreichend großen Gruppe von Geschwistern unterschiedlichen Verwandtschaftsgrades und unterschiedlicher Bedingungen der Nähe des Aufwachsens untersucht. Kommt der genetischen Anlage die größere Bedeutung zu, wird über alle Bedingungen der Unterschiedlichkeit von Entwicklungsumwelten hinweg die Merkmalsausprägung zwischen den Geschwistergruppen umso ähnlicher sein, je höher der Verwandtschaftsgrad ist. Kommt den Umweltfaktoren die größere Bedeutung zu, wird unabhängig vom Verwandtschaftsgrad die Merkmalsausprägung zwischen den Geschwistergruppen umso ähnlicher sein, je größer der Anteil geteilter Entwicklungsumwelt ist. Allerdings ist anzumerken, dass häufig nicht klar bestimmbar ist, wie ähnlich oder unähnlich die Entwicklungsumwelten tatsächlich waren. So haben u. U. selbst gemeinsam aufgewachsene eineiige Zwillinge einen je eigenen Freundeskreis und unterscheiden sich damit in einem wesentlichen Entwicklungseinfluss. Andererseits sind die Entwicklungsumwelten von in Adoptivfamilien aufgewachsenen Geschwistern häufig ähnlicher als angenommen, z. B. hinsichtlich des sozioökonomischen und kulturellen Hintergrundes.
Tab. 1.1: Systematik geteilter Umwelt und Gene
Mit diesem formalisierten Modell ökologischer Ebenen von Entwicklungsbedingungen ist ein methodologisches und ein sozialpolitisches Anliegen verbunden: Bronfenbrenner fordert zum einen, dass entwicklungspsychologische Forschung den natürlichen Kontext einbezieht. Dies bedeutet, dass die Untersuchungen in natürlichen Kontexten bzw. als natürlich erlebten Kontexten stattfinden müssen, um ökologisch valide zu sein. Zudem reicht es nicht, das singuläre Individuum zu betrachten, sondern es müssen größere Interaktionseinheiten (mindestens Dyaden) untersucht werden. Die von Bronfenbrenner vorgenommene Formalisierung der Umweltkontexte macht zum anderen deutlich, dass auch fernere Entwicklungskontexte, in denen das Kind nicht direkt handelt, entwicklungspsychologisch bedeutsam sind. Sozialpolitische Maßnahmen sind damit immer auch entwicklungspsychologische (vgl. Flammer, 2009).
Abb. 1.3: Ebenen in der ökologischen Systemtheorie (nach Flammer, 2009, S. 249)
Die im Rahmen der Anlage-Umwelt-Debatte seit so vielen Jahrzehnten intensiv diskutierte Frage ist, welchem Erklärungskonzept (Anlage oder Umwelt) für welche Personmerkmale der größere Erklärungswert zukommt. Letztlich ist dies die Frage danach, ob im Hinblick auf das Entwicklungsgeschehen der Schwerpunkt eher auf der Stabilität (Betonung der Rolle der Erbanlagen) oder Plastizität von Personmerkmalen (Betonung des Umwelteinflusses) gelegt wird. Die oben explizierte Bestimmung von Entwicklung als in der Zeit beobachteten zielgerichteten Veränderungen legt zunächst eine Betonung genetischer Faktoren nahe. Verschiedene Theorien sehen demgegenüber in den Umweltbedingungen den entscheidenden Einflussfaktor. Eine solche, in der Vergangenheit häufig in einem strengen Entweder-oder formulierte Position, wird jedoch heute nicht mehr vertreten. Es ist allgemein akzeptiert, dass der Ausgang eines jeden Entwicklungsgeschehens durch das gemeinsame Wirken von Anlage und Umwelt bestimmt wird, und zwar im Sinne eines Wechselwirkungsgeschehens. Dabei können durchaus einige Funktionen identifiziert werden, die sich stärker anlagedeterminiert, und andere, die sich stärker umweltdeterminiert entfalten. Der genetische Einfluss ist dabei umso stabiler, je näher das Merkmal an physische Funktionen gebunden ist. Der Umwelteinfluss ist umso bedeutender, je näher das Merkmal an psychische Funktionen gebunden ist. So kommen z. B. Poortinga, Kop und van de Vijver (1990) auf der Grundlage kultureller Unterschiede in einer Forschungsübersicht zu dem Schluss, dass im Bereich der Wahrnehmung (Sehen, Hören) die größte Anlagedeterminiertheit, im Bereich des sozialen Verhaltens die größte Umweltdetermination anzunehmen ist. Weiter ist der Einfluss genetischer Bedingungen umso größer, je jünger das betrachtete Entwicklungsstadium ist, bzw. wird die Erklärungskraft von Umweltmerkmalen für ein bestimmtes Verhalten mit zunehmendem Alter immer größer (pränatale Entwicklung vs. Entwicklung im Jugendalter). Nichtsdestoweniger ist ein Einfluss von Umweltmerkmalen bereits im Mutterleib nachgewiesen, und dies bezieht sich nicht nur auf materielle bzw. biochemische Einflüsse wie z. B. eine Viruserkrankung der Mutter (z. B. Röteln) oder durch den Kontakt mit fruchtschädigenden (teratogenen) Substanzen über die Plazenta (z. B. Alkohol, Medikamente), sondern auch auf psychologische, wie beispielsweise die Stimme und die Stimmung der Mutter (z. B. Lecanuet, Granier-Deferre & Busnel, 1995; DeCaspar & Spence, 1986).
Literaturhinweis
Bronfenbrenner, U. (1981). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente. Stuttgart: Klett-Cotta.
1.2.3 Entwicklungsmodelle der Lebensspanne
In der modernen Entwicklungspsychologie wird Entwicklung als ein lebenslanger Prozess begriffen, in dem Persönlichkeit und die engere und weitere soziale und materielle Umwelt miteinander interagieren. Moderne Entwicklungstheorien zeichnen sich neben der Einbeziehung der Lebensspanne auch durch die Abmilderung der Extrempositionen traditioneller Entwicklungstheorien aus: Entwicklung wird nicht als ein Entweder-oder von Kontinuität und Diskontinuität, von Plastizität oder Stabilität begriffen, sondern als ein Sowohl-als-auch. Moderne Entwicklungstheorien berücksichtigen zudem neben universellen auch individuelle Merkmale als Auslöser von Entwicklung und sehen diese nicht immer nur in Zugewinnen und Fortschreiten, sondern auch in Verlusten und Rückschritt gegeben (vgl. Berk, 2005).
Auch wenn bereits vor Beginn des 20. Jahrhunderts einzelne Autorinnen und Autoren der traditionellen Entwicklungspsychologie die heute als „modern“ geltende Ansicht äußerten, Entwicklung erstrecke sich über die gesamte Lebensspanne (z. B. Bühler, 1933), wurde der Terminus „life-span development“ bzw. „Entwicklung der Lebensspanne“ erst in den 1970er Jahren durch die Publikationen der West Virginia Conference on Life-Span Developmental Psychology begründet (z. B. Goulet & Baltes, 1970). Nach Brandtstätter (2007) sind Lebensspannentheorien durch vier Annahmen charakterisiert: Entwicklung ist a) ein lebenslanger Prozess, der b) mehrdimensional in verschiedenen Bereichen verläuft, der c) eine hohe Plastizität aufweist und d) eingebettet ist in unterschiedliche Entwicklungskontexte. Die Altersvariable wird nicht länger in Form eines starr altersabhängigen Stufenkonzept berücksichtigt, sondern der Lebenslauf wird in zeitlich individuell bestimmbare Abschnitte eingeteilt, in denen Veränderungen auf drei Ebenen stattfinden: physisch, kognitiv und sozial. Darüber hinaus werden altersabhängige, epochal bedingte und nichtnormative Einflüsse unterschieden (vgl. Baltes, Reese & Lipsett, 1980; Baltes, Lindenberger & Staudinger, 2006; Weinert & Weinert, 2006). Abbildung 1.4 fasst die Annahmen und ihr Zusamenspiel in Anlehnung an Baltes (1990) zusammen.
Abb. 1.4: Systematik der Annahmen von Lebensspannentheorien
Der nachfolgende Abschnitt stellt beispielhaft prominente Konzeptionen moderner allgemeiner Entwicklungstheorien vor, die auch heute noch große Beachtung erfahren: Die Theorie der psychosozialen Krisen (Erikson, 1980, 1988), die Theorie der Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1972) und die Theorie der kritischen Lebensereignisse (Filipp, 1999a).
Erik Homburger Erikson (*1902 Frankfurt, †1994 USA) beschreibt in Anlehnung an das psychoanalytische Entwicklungsmodell von Sigmund Freud Entwicklung als eine Abfolge psychosozialer Krisen (Erikson, 1980, 1988). Er erweiterte dies jedoch um die Lebensspannenperspektive, in dem er dem Jugendalter eine eigene Entwicklungsqualität zuweist und das Erwachsenenalter in drei Abschnitte mit einer je eigenen Thematik unterteilt. Erikson stellt die Prämissen voran, dass Entwicklung stufenförmig, gerichtet und universell verläuft. Jede Stufe weist nach Erikson eine je besondere psychosoziale Thematik auf, die im Rahmen der Herausbildung der Persönlichkeit bearbeitet wird. Die Aktualität eines Themas steigert sich nach Erikson nach und nach jeweils so weit, bis sie im Sinne eines krisenhaften Geschehens eine Lösung unabdingbar verlangt. Mit der Lösung der Krise wird die nächste Stufe der Entwicklung erreicht und eine neue Thematik aktuell. Wird die Krise nicht bewältigt, stagniert die Entwicklung. Die Lösung der Krise kann also dem Individuum in positivem oder negativem Sinne gelingen. Erikson geht dabei davon aus, dass die Art der Bewältigung das Leben hindurch fortwirkt. Erikson fasst im Gegensatz zu Freud das Ich nicht als defensive Instanz auf, sondern als in jeder Stufe aktiv und spontan die Erfahrung suchend. Erikson gilt deshalb als Vertreter der sog. Ich-Psychologie (Conzen, 2010).
In Kasten 1.2 sind die psychosozialen Krisen und ihre Lösungsmöglichkeiten beschrieben, unter Auslassung der von Erikson postulierten psychosexuellen und psychodynamischen Aspekte.
Kasten 1.2: Psychosoziale Krisen nach Erikson (1988, in Anlehnung an Conzen, 2010)
Urvertrauen gegen Ur-Misstrauen (1. Lebensjahr) Im Säuglingsalter sollte sich nach Erikson ein Vertrauen in die Welt entwickeln, dass man immer versorgt sein werde und sich alle Dinge letztlich zum Guten wenden. Dieses Bewusstsein entsteht nach Erikson im Rahmen der Erfahrungen mit der primären Bezugsperson (typischerweise der Mutter). Der Säugling erlebt jedoch nicht nur, dass die Mutter da ist und sich um ihn kümmert, sondern er muss es auch ertragen, ohne sie auszukommen. Aus dieser Spannung konstituiert sich die erste psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst die psychische Grundstärke, nach dem „Prinzip Hoffnung“ zu leben, im negativen Falle resultiert eine konstitutionelle Handlungstendenz, die man als „Prinzip Rückzug“ zusammenfassen kann.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Ich sehe optimistisch in die Zukunft.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Wenn ich mich auf ein Ereignis freue, meine ich immer, irgendwas werde schiefgehen und alles verderben.“
Autonomie vs. Scham und Zweifel (2./3. Lebensjahr) Im Kleinkindalter steht die Erlangung der Kontrolle über die Muskelfunktionen im Mittelpunkt der Entwicklung. Dadurch erlangt das Kind einen immer größeren Aktionsradius und kann von seiner Umwelt zunehmend Besitz ergreifen. In diesem Bemühen muss es von den Elternpersonen durch ein angemessenes Maß an Gewährenlassen und Kontrolle unterstützt werden. Denn das Kind erlebt auch täglich Rückschläge in diesem Bemühen, deren Konsequenzen es überfordern, entweder weil es noch nicht so viel kann wie für das, was es erlangen möchte, nötig wäre, oder aber weil es die Situationen, in die es sich bringt, nicht beherrscht. Aus dieser Spannung konstituiert sich die zweite psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst die psychische Grundstärke eines festen Willens, im negativen Falle resultiert eine konstitutionelle Handlungstendenz, sich zwanghaft Regeln und Geboten unterzuordnen.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Wenn Menschen mich zu etwas überreden wollen, das ich nicht will, wehre ich mich.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Ich habe Sorge, dass man etwas Schlechtes über mich herausfinden könnte.“
Initiative vs. Schuldgefühl (4./5. Lebensjahr) Im Vorschulalter steht weiter die zunehmende Verbesserung der motorischen Fertigkeiten im Vordergrund der Entwicklung. Das Kind agiert vorwiegend im Rahmen der Kernfamilie, kann hier jetzt bereits Aufgaben übernehmen, beispielsweise bei der Betreuung eines jüngeren Geschwisters. Allerdings hat das Kind jetzt so viel Kraft erlangt, dass es mit seinen Aktionen anderen auch Schaden zufügen kann, zumeist unbedacht beim Toben im Spiel. Aus dieser Spannung konstituiert sich die dritte psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst die psychische Grundstärke „Entschlusskraft“, im negativen Falle resultiert „Hemmung“, d. h. Handlungsimpulsen aus Angst vor Strafe nur zögerlich nachzugehen.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Ich bin zuversichtlich, dass ich meine Pläne zu einem guten Gelingen bringen werde.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Ich scheue mich, Dinge auf eine neue Weise auszuprobieren.“
Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät) Im Schulalter ist das Kind typischerweise nicht mehr nur im Spiel aktiv, sondern auch begierig auf ernsthafte Lerngegenstände. Sein Aktionsradius erstreckt sich dabei nun über die Familie hinaus auch auf die Nachbarschaft und die Schule. Es macht jedoch nicht nur die Erfahrung, dass es ihm gelingt, die Zusammenhänge zu verstehen, sondern auch, dass es ihm schwer fällt, es u. U. daran scheitert und ihm eigene Schwächen offenbar werden. Aus dieser Spannung konstituiert sich die vierte psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst die psychische Grundstärke „Kompetenz“, die sich in Regsamkeit und Fleiß ausdrückt. Im negativen Falle etabliert sich ein Gefühl der Minderwertigkeit, das zu „Trägheit“ führt und dauerhaft die Überwindung dieser Schwächen erschwert.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Ich habe viel Freude an der Arbeit.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Ich vermeide es, schwierige Dinge anzugehen, weil ich denke, ich werde es sowieso nicht schaffen.“
Identität vs. Rollendiffusion (ca. 13. bis etwa 20. Lebensjahr) Im Jugendalter ist das Entwicklungsgeschehen geprägt von dem Bemühen, die eigene Identität zu finden. Wer bin ich? Was kann ich? Woher komme ich? Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Das sind die zentralen Fragen, die Jugendliche auch mit ihrem Handeln zu ergründen versuchen. Die Ursprungsfamilie nimmt in diesem Geschehen einen immer weniger wichtigen Platz ein, zentral werden jetzt die Beziehungen zu Gleichaltrigen und die Auseinandersetzung mit fremden Gruppen. Aus der Spannung zwischen Akzeptanz und Ablehnung dessen, was man in diesem Prozess über sich herausfindet, erwächst die fünfte psychosoziale Krise. Im Fall der positiven Lösung resultiert daraus eine handlungskompetente Persönlichkeit, die sich als kohärent in allen verschiedenen Erlebnis- und Handlungsbereichen erlebt. Dies geht einher mit der psychischen Grundstärke „Treue“, die sich in einer Verpflichtung, einem Einstehen für die als wichtig erachteten Werte und Handlungsmustern äußert. Im negativen Falle verharrt die Person in der „Identitätskonfusion“ oder auch „Rollendiffusion“, sie agiert in den verschiedenen Handlungsbezügen mit einem Gefühl des Geworfenseins, ohne ihr Handeln als innerlich zusammenhängend zu erleben. Erikson beschreibt als Konsequenz die Ausbildung der Kernpathologie „Rollen-Zurückweisung“, sich für die Entwicklung notwendigen und nützlichen Rollen und Werten zu verschließen oder ihnen aktiv Widerstand entgegen zu setzen. Zurückweisung kann nach Erikson als mangelndes Selbstvertrauen oder aber „penetranter Trotz“ in Erscheinung treten.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Ich bin stolz darauf, genau die Person zu sein, die ich bin.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Ich frage mich, wer ich eigentlich bin.“
Intimität und Solidarität vs. Isolierung (ca. 20. bis etwa 45. Lebensjahr) Im frühen Erwachsenenalter steht nach Erikson vor allem die Suche nach einer festen Partnerschaft im Mittelpunkt des Entwicklungsgeschehens. Die Person zieht sich dazu immer wieder aus der Gruppe heraus in Zweierbeziehungen zurück. Durch die enge Bindung an eine andere Person entsteht zwangsläufig eine Isolierung, die umso stärker wird, je exklusiver die Beziehung gestaltet ist. Exklusivität ist zudem kein Garant, dass sich auch eine enge Vertrautheit in der Beziehung einstellt, die Person kann sich dennoch isoliert (weil unverstanden) fühlen. Aus dieser Spannung konstituiert sich die sechste psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst Intimität, eine reife gegenseitige Bezogenheit, die sich in der psychischen Grundstärke „Liebe“ ausdrückt: der Fähigkeit, Bedürfnisse und Wünsche des anderen Menschen zu achten und für ihre Erfüllung zu sorgen. Im negativen Falle verfestigt sich Isolierung, eine Unfähigkeit, sich in tiefere Beziehungen einzulassen, die aus der Angst heraus, dauerhaft allein zu bleiben, mit einer ständigen Forderung nach Exklusivität einhergeht.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Es gibt jemanden, der meine Sorgen und Ängste mit mir teilt.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Ich fühle mich, als wäre ich allein auf der Welt“.
Generativität vs. Stagnation (ca. 45. bis etwa 65. Lebensjahr) Im Erwachsenenalter stellt nach Erikson die Produktion von Gütern und Werten, Ideen und Erkenntissen und ihre Weitergabe das zentrale Entwicklungsgeschehen dar, das er als „Generativität“ bezeichnet. Die Beziehungsperspektive erweitert sich jetzt wieder, bleibt aber nicht wie vormals auf die eigene Gruppe beschränkt, sondern nimmt die Gesamtgesellschaft in den Blick. Etwas weiterzugeben bedeutet zwangsläufig auch, anderen etwas von dem eigenen Gut abzugeben, ohne dadurch einen direkten Vorteil zu erlangen. Aus dieser Spannung konstituiert sich die siebte psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst die psychische Grundstärke „Fürsorge“, im negativen Falle „Abweisung“, die letztlich zur Stagnation der eigenen Entwicklung führt mit depressiven oder narzisstischen Tendenzen.
Nach Ochse und Plug (1986) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Ich helfe Menschen gern dabei, sich zu verbessern.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Junge Menschen vergessen schnell, was man für sie getan hat.“
(Ich-)Integrität vs. Verzweiflung (ca. 65. bis Tod) Das zentrale Thema des Alters sieht Erikson in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenszyklus gegeben. Tod bedeutet Loslassen, und das kann nur gelingen, wenn die Widerfahrnisse des Lebens akzeptiert werden, wenn erkannt wird, dass die Dinge sich letztlich sinnvoll ineinandergefügt haben. Die Beziehungsperspektive erweitert sich nun auf die gesamte Menschheit und bettet die eigene Geschichte in die größeren Abläufe der Welt- und Gesellschaftsgeschichte ein. Aus der Spannung von Bewertung und aktuell erlebter Lebenszufriedenheit konstituiert sich die achte psychosoziale Krise. Aus der positiven Lösung erwächst ein Gefühl des Einsseins mit sich Selbst, seiner Geschichte und der Menschheit, die sich in der psychischen Grundstärke „Weisheit“ äußert. Im negativen Falle resultiert Verzweiflung, dass das Leben sich bereits dem Ende neigt und die Dinge noch nicht so bereitet sind, wie man sie gern hätte. Sie äußert sich u. U. in „Hochmut“, die sich im körperlichen Verfall immer deutlicher aufdrängenden Anzeichen des nahenden Endes zu negieren.
Nach Darling-Fisher und Leidy (1988) würde eine erwachsene Person, der die Lösung dieser Krise gelungen ist, z. B. folgender Aussage zustimmen: „Meine Leistungen und meine Misserfolge sind im Wesentlichen die Konsequenz meiner Handlungen.“ Ist es ihr nicht gelungen, diese Krise positiv zu lösen, würde die Person eher folgender Aussage zustimmen: „Wenn ich mein Leben überblicke, möchte ich noch viel verlorene Zeit nachholen.“
In Anlehnung an Erikson und deshalb in einigen Punkten ähnlich beschreibt Robert J. Havighurst (*1900, USA, †1991, USA) den Lebenslauf als strukturiert durch eine typische Folge von Problemstellungen. Ein Problem ist in der Psychologie dadurch definiert, dass der Überführung eines Ausgangszustandes in einen erwünschten Zielzustand ein Hindernis im Wege steht, das nicht ohne Weiteres (z. B. weil bereits bekannt ist wie) beseitigt oder überwunden werden kann, sondern erst durch aktive Denkhandlungen eine Lösung gefunden werden muss (Hussy, 1998, S. 20). Havighurst bezeichnet solche Problemstellungen als „Entwicklungsaufgaben“, die er folgendermaßen definiert: „A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of an individual, successful achievement of which leads to happiness and to success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the society, and difficulties with later tasks” (Havighurst, 1948/1972, S. 2).
Nach Havighurst (1972) konstituieren sich Entwicklungsaufgaben aus drei möglichen Quellen: physische Reife (z. B. pubertäre Veränderungen), kultureller Druck (Erwartungen der Gesellschaft, die an das heranwachsende Individuum herangetragen werden) und individuelle Zielsetzungen oder Werte (die sich das Individuum selbst sucht). Entwicklung ergibt sich aus der Diskrepanz zwischen jetzigem Entwicklungsstand und erwünschtem, aktiv vorweggenommenem Status. Auch Havighurst (1972) weist dem Individuum eine aktive Rolle bei der Bewältigung der Aufgaben zu. Eine gelungene Lösung einer Entwicklungsaufgabe führt nach Havighurst (1972) zu Glück und Erfolg, ein gescheiterter Bewältigungsversuch zu Unzufriedenheit und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben. Kasten 1.3 stellt beispielhaft typische Entwicklungsaufgaben im Schulalter zusammen.
Kasten 1.3: Entwicklungsaufgaben im Schulalter (in Anlehnung an Havighurst, 1972)
Grundschulalter
Spielen und Arbeiten im Team (soziale Kooperation)Entwicklung von SelbstbewusstseinEntwicklung eines Verständnisses für Moral und WerteErwerb grundlegender Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen)Bereitschaft zum LeistungshandelnJugendalter
Aufbau eines Freundeskreises




























