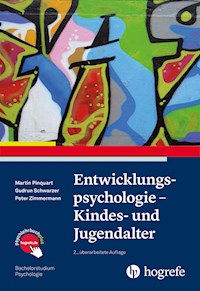
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bachelorstudium Psychologie
- Sprache: Deutsch
Der Band liefert in 14 Kapiteln einen gut verständlichen Überblick über die Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Dazu beleuchtet er die zentralen Forschungsfelder, Theorien und Befunde der Entwicklungspsychologie. Zahlreiche Kästen mit Beispielen und Zusammenfassungen, Tabellen und Abbildungen, Verständnisfragen sowie ein Glossar strukturieren den Text und erleichtern die Prüfungsvorbereitung. Nach einer Einführung in die Grundannahmen der Entwicklungspsychologie wird auf die methodischen Aspekte bei der Durchführung entwicklungspsychologischer Untersuchungen eingegangen. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Entwicklung der verschiedenen Funktionsbereiche: Ausführlich werden die basalen Entwicklungen von Wahrnehmung und Psychomotorik sowie von Denken und Informationsverarbeitung erörtert. Zudem werden die wesentlichen Aspekte der moralischen, emotionalen, motivationalen, sozialen und sprachlichen Entwicklung dargestellt. Weitere Kapitel widmen sich der Entwicklung von Persönlichkeit und Selbstkonzept sowie der Entwicklung der Geschlechtsidentität, von geschlechtstypischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Abschließend behandelt der Band ausgewählte Entwicklungsstörungen und psychische Probleme im Kindes- und Jugendalter sowie Möglichkeiten zur Förderung der Entwicklung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Pinquart
Gudrun Schwarzer
Peter Zimmermann
Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter
2., überarbeitete Auflage
Bachelorstudium Psychologie
Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter
Prof. Dr. Martin Pinquart, Prof. Dr. Gudrun Schwarzer, Prof. Dr. Peter Zimmermann
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Eva Bamberg, Prof. Dr. Hans-Werner Bierhoff, Prof. Dr. Alexander Grob, Prof. Dr. Franz Petermann
Prof. Dr. Martin Pinquart, geb. 1960. 1978–1983 Studium der Psychologie in Jena und Berlin. 1986 Promotion. 1996 Habilitation. 1986–2007 Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Jena. Seit 2007 Professor für Entwicklungspsychologie an der Philipps Universität Marburg.
Prof. Dr. Gudrun Schwarzer, geb. 1962. 1982–1988 Studium der Psychologie in Marburg. 1991 Promotion. 1999 Habilitation. 2000–2003 Leitung einer selbstständigen Nachwuchsgruppe am Friedrich-Miescher-Laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft in Tübingen. Seit 2003 Professorin für Entwicklungspsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Prof. Dr. Peter Zimmermann, geb. 1964. 1990 Diplom der Psychologie in Regensburg. 1994 Promotion. 2000 Habilitation. 2004–2009 Professor für Entwicklungspsychologie an der TU Dortmund. Seit 2009 Professor für Entwicklungspsychologie an der Bergischen Universität Wuppertal.
Informationen und Zusatzmaterialien zu diesem Buch finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © Digitalstock – K. Hammer
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
2., überarbeitete Auflage 2019
© 2011 und 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2861-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2861-2)
ISBN 978-3-8017-2861-8
http://doi.org/10.1026/02861-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Gegenstand und Aufgaben der Entwicklungspsychologie
1.1 Der Entwicklungsbegriff
1.2 Weitere Begriffe
1.3 Der Gegenstand der Entwicklungspsychologie
1.4 Einflüsse auf die Entwicklung
1.4.1 Biologische Einflüsse auf die Entwicklung
1.4.2 Ökologische (soziale, kulturelle) Einflüsse auf die Entwicklung
1.4.3 Menschen als Mitgestalter ihrer Entwicklung
1.5 Geschichte der Entwicklungspsychologie
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 2 Methoden der Entwicklungspsychologie
2.1 Datengewinnung
2.1.1 Beobachtung
2.1.2 Interview, Fragebogen und Tests
2.1.3 Psychophysiologische Methoden
2.2 Zusammenhänge und Ursachen der gewonnenen Daten
2.2.1 Korrelationsstudien
2.2.2 Experimentelle Studien
2.3 Methoden zur Untersuchung altersbezogener Veränderungen
2.3.1 Längsschnittliche Verfahren
2.3.2 Spezialfälle längsschnittlicher Verfahren
2.3.3 Querschnittliche Verfahren
2.3.4 Kombination aus Längs- und Querschnittstudien (Kohortensequenzstudien)
2.3.5 Kulturvergleichende Untersuchungen
2.3.6 Komparative Untersuchungen
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 3 Entwicklung von Wahrnehmung und Motorik
3.1 Wahrnehmung
3.1.1 Visuelle Wahrnehmung
3.1.2 Auditive Wahrnehmung
3.1.3 Wahrnehmung durch Fühlen, Schmecken und Riechen
3.2 Motorik
3.2.1 Neugeborenenreflexe
3.2.2 Aufrechte Körperhaltung und Fortbewegung
3.2.3 Greifen und Zupacken
3.2.4 Veränderungen nach dem 1. Lebensjahr
3.3 Intermodale Wahrnehmung
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 4 Entwicklung des Denkens
4.1 Piagets Theorie
4.1.1 Sensumotorisches Stadium (0 bis 2 Jahre)
4.1.2 Präoperationales Stadium (2 bis 7 Jahre)
4.1.3 Konkret-operationales Stadium (7 bis 12 Jahre)
4.1.4 Formal-operationales Stadium (ab 12 Jahre)
4.2 Domänenspezifische Theorien
4.2.1 Intuitive Physik und numerisches Wissen
4.2.2 Intuitive Psychologie (Theory of Mind)
4.2.3 Intuitive Biologie
4.3 Wygotskis Theorie
4.3.1 Rolle des soziokulturellen Kontextes
4.3.2 Zone der proximalen Entwicklung
4.3.3 Psychologische Werkzeuge
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 5 Entwicklung der Informationsverarbeitung
5.1 Entwicklung des Gedächtnisses
5.1.1 Entwicklung der Wiedererkennung
5.1.2 Entwicklung des Reproduzierens
5.2 Faktoren der Gedächtnisentwicklung
5.2.1 Verarbeitungsspanne
5.2.2 Strategien
5.2.3 Wissen
5.2.4 Metagedächtnis
5.3 Entwicklung des Problemlösens
5.3.1 Planen
5.3.2 Regelgeleitetes Denken
5.3.3 Analoges Schlussfolgern
5.3.4 Deduktives und wissenschaftliches Denken
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 6 Entwicklung der Sprache
6.1 Phonologie
6.1.1 Wahrnehmung von Phonemen
6.1.2 Die Rolle kindgerichteter Sprache für die Wahrnehmung von Wörtern und Phonemen
6.1.3 Produktion von Phonemen und Wörtern
6.2 Lexikon (Semantik)
6.2.1 Erste Wörter
6.2.2 Vokabelspurt
6.2.3 Constraints des Worterwerbs
6.2.4 Grammatikalische Aspekte beim Worterwerb
6.2.5 Rolle der Eltern beim Worterwerb
6.3 Grammatik
6.3.1 Kombination von Wörtern – erste Sätze
6.3.2 Morphologie
6.4 Pragmatik
6.5 Erklärungen für die Entwicklung von Sprache
6.5.1 Rolle der Biologie
6.5.2 Rolle von Lernen und Denken
6.5.3 Rolle soziokultureller Einflüsse
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 7 Entwicklung der Motivation und Handlungsregulation
7.1 Entwicklung der Leistungsmotivation
7.1.1 Die Entwicklung des Verständnisses über Ursachen von Erfolg und Misserfolg
7.1.2 Kann ich Erfolg haben? Entwicklung des Konzepts eigener Kompetenzen
7.1.3 Will ich Erfolg haben und warum? Entwicklung der Leistungsbereitschaft
7.1.4 Engagement bei der Zielerreichung
7.2 Entwicklung von Interessen
7.3 Entwicklung der Selbststeuerung des Verhaltens
7.4 Einflüsse auf die motivationale Entwicklung
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 8 Emotionale Entwicklung
8.1 Entwicklung diskreter Emotionen
8.2 Wissen über Emotionen: Entwicklung der Emotionserkennung und des Emotionsverständnisses
8.2.1 Das Erkennen und Benennen des Emotionsausdrucks
8.2.2 Wissen über äußere Ursachen von Emotionen
8.2.3 Wissen über Wünsche als Ursachen von Emotionen
8.2.4 Wissen über Annahmen als Ursachen von Emotionen
8.2.5 Wissen über Erinnerungen als Ursachen von Emotionen
8.2.6 Wissen über Emotionsregulation
8.2.7 Wissen über Ausdruckskontrolle von Emotionen
8.2.8 Wissen über gemischte Gefühle
8.2.9 Wissen über den Einfluss von moralischem Handeln auf Emotionen
8.2.10 Emotionswissen und soziale Kompetenz
8.2.11 Was beeinflusst das Niveau des Emotionswissens?
8.3 Entwicklung von Emotionsregulation
8.3.1 Veränderung von vorwiegend sozialer hin zu mehr selbstregulativer Emotionsregulation
8.3.2 Anstieg der Anzahl der Emotionsregulationsstrategien und Zunahme der Auswahl der Strategie passend zu Situation und Emotion
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 9 Soziale Entwicklung
9.1 Einleitung
9.2 Bindungsentwicklung
9.2.1 Normative Bindungsentwicklung
9.2.2 Differenzielle Bindungsentwicklung
9.2.3 Ursachen von Bindungsunterschieden
9.2.4 Tradierung von Bindungsmustern
9.2.5 Längsschnittliche Bindungsentwicklung: Kontinuität und Veränderung
9.2.6 Konsequenzen der Bindungsmuster für die weitere Entwicklung
9.3 Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung
9.4 Entwicklung von Gleichaltrigenbeziehungen
9.5 Entwicklung des Konzepts und der Qualität von Freundschaften
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 10 Moralische Entwicklung
10.1 Entwicklung des moralischen Urteilens
10.1.1 Die Entwicklung von der heteronomen zur autonomen Moral (Piaget)
10.1.2 Die Stufentheorie Kohlbergs
10.1.3 Weitere Stufentheorien
10.2 Entwicklung moralischer Gefühle
10.3 Die Entwicklung moralischen Verhaltens
10.4 Ausgewählte Einflüsse auf die moralische Entwicklung
10.5 Interventionen zur Förderung der moralischen Entwicklung
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 11 Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstkonzepts
11.1 Einleitung
11.2 Die Entwicklung der Persönlichkeit
11.2.1 Temperament und Persönlichkeitsentwicklung
11.2.2 Stufenmodelle der Persönlichkeitsentwicklung
11.3 Die Entwicklung des Selbstkonzepts
11.3.1 Entwicklung der Inhalte des Selbstkonzepts
11.3.2 Entwicklung des Selbstwerts
11.3.3 Entwicklung der Identität
11.4 Einflüsse auf die Entwicklung von Persönlichkeit und Selbstkonzept
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 12 Entwicklung der Geschlechtsidentität, geschlechtstypischer Einstellungen und geschlechtstypischer Verhaltensweisen
12.1 Einleitung
12.2 Die Entwicklung der Geschlechtsidentität
12.3 Entwicklung von Wissen und Einstellungen über die Geschlechter
12.4 Entwicklung von Geschlechtsunterschieden in Präferenzen und Verhaltensweisen
12.5 Zusammenhänge zwischen Geschlechtsidentität, Einstellungen und Verhalten
12.6 Einflüsse auf die Entwicklung von Geschlechtsidentität, Einstellungen und Verhalten
12.6.1 Biologische Einflussfaktoren
12.6.2 Soziale Einflüsse
12.6.3 Psychische Einflüsse
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 13 Entwicklungsstörungen und psychische Probleme im Kindes- und Jugendalter
13.1 Kontinuität oder Diskontinuität von normaler und gestörter Entwicklung
13.2 Die Verbreitung von psychischen Störungen und Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter
13.3 Risiko- und Schutzfaktoren
13.4 Kompetente, resiliente und psychosozial schlecht angepasste Kinder und Jugendliche
13.5 Altersunterschiede und Entwicklungsverläufe
13.6 Psychische Störungen und Entwicklungserfolg
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Kapitel 14 Interventionen zur Beeinflussung von Entwicklungsprozessen
14.1 Programme zur Förderung einer positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
14.1.1 Interventionen in verschiedenen Entwicklungskontexten
14.1.2 Kontextunspezifische Interventionen zur Förderung umschriebener Kompetenzen
14.2 Maßnahmen in Bezug auf Entwicklungsprobleme, -störungen und Problemverhalten
14.2.1 Interventionen bei Entwicklungsstörungen
14.2.2 Prävention von externalisierendem Problemverhalten
14.2.3 Prävention von internalisierendem Problemverhalten
14.3 Moderatoreffekte: Wer profitiert stärker von welcher Intervention?
Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Fragen
Anhang
Literatur
Glossar
Sachregister
|13|Vorwort
Wir freuen uns, die 2. Auflage unseres Lehrbuchs Entwicklungspsychologie – Kindes und Jugendalter vorzulegen. Dies gibt uns die Möglichkeit, neben allgemeinen Aktualisierungen des Forschungsstandes einige Themen aufzunehmen, die für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an Bedeutung gewonnen haben, wie etwa die Rolle des Internets für das Lösen alterstypischer Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Zudem haben wir einige Themen vertieft dargestellt, zu denen der Kenntnisstand in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, etwa die Wechselwirkung von genetischen Faktoren und Umweltfaktoren bei der psychischen Entwicklung, differenzielle Entwicklungsverläufe (z. B. im Bereich der Selbststeuerung des Verhaltens), der Zusammenhang des Erfolgs bzw. Misserfolgs beim Lösen von Entwicklungsaufgaben mit dem Auftreten psychischer Störungen und die Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Entwicklungsstörungen. Das Lehrbuch bietet kompakt und dennoch umfassend einen aktuellen Überblick über Entwicklungsprozesse und Entwicklungstheorien.
Wir möchten uns anlässlich des Erscheinens der 2. Auflage unseres Lehrbuchs herzlich beim Hogrefe Verlag für die sehr gute Betreuung unseres Buchprojekts bedanken.
Marburg, Gießen und Wuppertal, im Juli 2018
Martin Pinquart
Gudrun Schwarzer
Peter Zimmermann
|15|Kapitel 1Gegenstand und Aufgaben der Entwicklungspsychologie
Martin Pinquart
|16|Schlüsselbegriffe
Was versteht man unter psychischer Entwicklung?
Der Gegenstand der Entwicklungspsychologie
Die Rolle von Erbanlagen, Umwelt und der Eigenaktivität des Individuums bei der Entwicklung
Geschichte der Entwicklungspsychologie
1.1 Der Entwicklungsbegriff
Sich mit Entwicklungspsychologie zu beschäftigen, setzt eine Vorstellung darüber voraus, was man unter psychischer Entwicklung versteht, was die dabei zugrunde liegenden Mechanismen sind und welche Faktoren die Entwicklung beeinflussen. Hierbei gab und gibt es eine Vielfalt von theoretischen Vorstellungen, wobei zu bestimmten Zeiten und in einzelnen Teilbereichen der Entwicklungspsychologie jeweils bestimmte Auffassungen dominierten (zur Übersicht, Pinquart & Silbereisen, 2006). Die folgende Definition von Entwicklung wird von vielen Vertretern des Faches geteilt:
Definition
Unter psychischer Entwicklung des Individuums versteht man die geordnete (regelhafte), gerichtete und längerfristige Veränderung des Erlebens und Verhaltens über die gesamte Lebensspanne.
Die Definition soll im Folgenden weiter erläutert werden:
Entwicklung des Individuums: Prinzipiell ist es möglich, die Entwicklung auf verschiedenen Zeitachsen zu untersuchen. Entwicklungspsychologen beschäftigen sich in der Regel mit der Individualentwicklung (Ontogenese) oder Abschnitten davon (etwa der Kindheit oder dem Jugendalter). Darüber hinaus kann man auch die Entwicklung des Psychischen im Rahmen der Stammesentwicklung (Phylogenese) und im Rahmen der Herausbildung der Gattung Mensch bis zu ihrem heutigen Entwicklungsstand betrachten (die sogenannte Anthropogenese als Ausschnitt der Phylogenese). Dies erfolgt aber vor allem im Rahmen der vergleichenden Verhaltensforschung. Hier ist z. B. von Interesse, ob bestimmte Verhaltensweisen des Menschen Vorläufer im Tierreich und bei den unmittelbaren Vorfahren der Gattung Mensch haben und damit eine biologische Basis aufweisen. Weiterhin ist es möglich, die Entwicklung eines einzelnen psychi|17|schen Prozesses (etwa eines einzelnen Denkprozesses vom Stellen einer Frage bis zur Formulierung der zugehörigen Antwort) zu betrachten (die sogenannte Aktualgenese). Damit beschäftigt sich allerdings die Allgemeine Psychologie und nicht die Entwicklungspsychologie.
Geordnetheit/Regelhaftigkeit der Veränderung: Um Veränderungen als Entwicklung zu bezeichnen, sollten sie eine irgendwie geartete Ordnung und einen inneren Zusammenhang aufweisen und systematisch auseinander hervorgehen (Thomae, 1959). So kann ein Entwicklungsschritt die notwendige Voraussetzung für den Übergang zum nächsten Schritt sein (etwa im Stufenmodell der Denkentwicklung von Piaget, 1936; vgl. Kapitel 4). Das Kriterium der Geordnetheit von Veränderungen mag auf den ersten Blick zu deterministisch wirken, wenn man daran denkt, dass unsere Entwicklung auch von Zufällen beeinflusst wird (z. B. von kritischen Lebensereignissen wie einem Unfall oder einer schweren Krankheit). Aber auch hier hängen die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Entwicklung von der vorherigen Entwicklung ab (etwa welche Kompetenzen schon vorhanden sind, um mit dem Lebensereignis umzugehen).
Gerichtetheit der Veränderung: Entwicklungspsychologen sind sich darin einig, Schwankungen und zufällige, völlig desorganisierte Veränderungen nicht als Entwicklung zu bezeichnen. Wenn man z. B. nach durchzechter Nacht am Morgen in der Vorlesung müde ist, am nächsten Tag nach ausreichend Schlaf wieder munter und am darauf folgenden Tag wieder verschlafen ist, so handelt es sich zwar um Veränderungen des Wachheitszustandes, jedoch nicht um Entwicklung. Weniger Einheitlichkeit besteht in der Meinung, worauf die Entwicklung gerichtet ist. Während man lange Zeit Entwicklung nur als Höherentwicklung ansah (etwa als Zuwachs von Fähigkeiten), geht man heute mehrheitlich davon aus, dass Entwicklung sowohl Gewinn als auch Verlust, den Aufbau als auch den Abbau von Fähigkeiten umfasst. Hierbei treten Gewinn und Verlust oft nebeneinander auf, etwa wenn bis in das höhere Erwachsenenalter das Wissen (die sogenannte kristallisierte Intelligenz) zunehmen kann, während die Fähigkeit zum Lösen neuartiger Probleme (die flüssige Intelligenz) bereits früher wieder abzusinken beginnt. Man spricht somit auch von der Multidirektionalität der Entwicklung (Baltes, Lindenberger & Staudinger, 2006).
Längerfristigkeit der Veränderung: Mit diesem Kriterium möchte man kurzzeitige Veränderungen – wie etwa die bereits weiter oben genannten Schwankungen – aus der Definition von Entwicklung ausschließen. Allerdings kann man nicht nur jene Veränderungen als |18|Entwicklung bezeichnen, die ein Leben lang anhalten, denn viele eingetretene Veränderungen können später modifiziert oder – etwa bei einem Altersabbau – auch wieder teilweise oder vollständig rückgängig gemacht werden. Zudem sind kurzzeitige Veränderungen dann von entwicklungspsychologischem Interesse, wenn sie langfristige Veränderungen nach sich ziehen. So wächst z. B. zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr vorübergehend der Anteil der Kinder, die mit einer Verkleidung als Junge oder Mädchen auch eine Veränderung des eigenen Geschlechts verbinden. Dieses Übergangsstadium beruht aber nur darauf, dass sie vorher vertretene irrelevante Begründungen aufgeben (etwa weil Jungen keine Mädchenkleider anziehen würden) und erst danach die richtigen (biologischen) Begründungen für die Geschlechtskonstanz lernen (vgl. Kapitel 12).
Veränderungen über die Lebensspanne: Die Entwicklung des Individuums beginnt mit der Befruchtung der Eizelle und endet erst mit dem Tode. Während sich die Entwicklungspsychologie anfangs fast ausschließlich mit dem Kindes- und Jugendalter befasste, steht heute die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne im Mittelpunkt (Baltes et al., 2006). Wenn man Entwicklung als mit dem Alter assoziierte Veränderungen versteht, ist es wichtig zu betonen, dass das Alter nicht die Ursache dieser Veränderungen ist, sondern nur die zeitliche Dimension, auf der sich Entwicklung vollzieht (Wohlwill, 1970). Auslöser der Entwicklung ist stattdessen das mit dem Alter assoziierte Zusammenspiel von biologischen und sozialen Veränderungen (etwa von Reifungsprozessen des Gehirns und von Möglichkeiten zum Sammeln von Lernerfahrungen beim Übergang zur Schule; vgl. Abschnitt 1.4).
Bei anderen Aspekten der Definition von Entwicklungsprozessen gibt es in der Literatur weniger Übereinstimmung:
Quantitative und/oder qualitative Veränderungen: Während Stufentheorien die psychische Entwicklung als Durchlaufen qualitativ unterschiedlicher Stufen charakterisieren (z. B. Piagets Theorie der Denkentwicklung; vgl. Kapitel 4), haben Lerntheorien die Entwicklung als quantitative Veränderungen beschrieben (z. B. als Zuwachs von Wissen über einen bestimmten Gegenstand). Beides stellt eine Einengung des Entwicklungsbegriffes dar und qualitative sowie quantitative Veränderungen treten oft gemeinsam auf. Wenn z. B. beim Erlernen von Wortlisten beobachtet wird, dass die Zahl von erinnerten Wörtern in Kindheit und im Jugendalter ansteigt, so handelt es sich um einen quantitativen Zuwachs. Wird aber zudem beobachtet, dass die Jugendlichen im Gegensatz zu den Kindern Stra|19|tegien einsetzen, um eine höhere Leistung zu erzielen (etwa die Gruppierung der Wörter anhand von Oberbegriffen), so liegt eine qualitative Veränderung vor (Schneider, Knopf & Stefanek, 2002).
Reversible und/oder irreversible Veränderungen: Stufentheorien der Entwicklung gehen meist davon aus, dass die Entwicklung nicht umkehrbar sei; ein Zurückfallen auf etwas Vorheriges (eine Regression) sei ausgeschlossen. Ein solches Verständnis ist aber nur auf einen Teil der Entwicklungsprozesse anwendbar, etwa bei der motorischen Entwicklung oder bei sachlogisch aufeinander aufbauenden kognitiven Veränderungen (vgl. Piaget, 1936). Ansonsten werden auch reversible Veränderungen beobachtet, etwa dass Säuglinge in den ersten Monaten beginnen, auch solche Laute zu äußern, die in ihrer Muttersprache keine Bedeutung haben. Bis zum Ende des ersten Lebensjahres sind diese dann wieder weitgehend aus dem Sprachschatz verschwunden (Aslin, Jusczyk & Pisoni, 1998; vgl. Kapitel 6). Die menschliche Entwicklung ist somit in starkem Maße durch Plastizität (Formbarkeit) gekennzeichnet, auch wenn sich das Ausmaß der Plastizität über die Lebensspanne hinweg verändert.
Universelle und/oder differenzielle Veränderungen: Während sich anfangs die Entwicklungspsychologie für im Durchschnitt auftretende (universelle) Veränderungen interessierte (und hierfür Altersnormen aufstellte), beschäftigt man sich heute stärker mit differenziellen Veränderungen (interindividuellen Unterschieden in den intraindividuellen Veränderungen). Weitgehend universelle Veränderungen werden in Kindheit und Jugend dort gefunden, wo Entwicklungsprozesse stark an biologische Reifungsprozesse gebunden sind (etwa bei der motorischen Entwicklung in den ersten Lebensjahren) oder stark von altersnormierten Umwelteinflüssen abhängen (z. B. der Erwerb von Lese- und Rechenfertigkeiten nach der Einschulung). Das ist häufiger in Kindheit und Jugendalter der Fall, während im jungen und mittleren Erwachsenenalter vor allem differenzielle Entwicklungsprozesse zu beobachten sind, etwa als Ergebnis des Verfolgens persönlicher Entwicklungsziele oder von nicht an ein bestimmtes Alter gebundenen Lebensereignissen (wie Arbeitslosigkeit oder Ehescheidung).
Da die Festlegung auf jeweils einen Pol der obigen drei Gegensatzpaare den Entwicklungsbegriff unnötig einschränken würde, kann auf diese Merkmale zur Definition der Entwicklung verzichtet werden. Man sollte also je nach Thematik fragen, ob der betrachtete Entwicklungsverlauf quantitative oder qualitative, reversible oder irreversible sowie universelle oder differenzielle Veränderungen beinhaltet.
|20|1.2 Weitere Begriffe
Mit dem Entwicklungsbegriff stehen weitere Begriffe in Zusammenhang, die hier kurz dargestellt werden sollen, und zwar Reifung, Prägung/sensible Phasen, Stabilität und Kontinuität.
Reifung
Während der Entwicklungsbegriff erst einmal offen lässt, welche Faktoren zur Veränderung führen, bezeichnet man als Reifung biologisch (genetisch) bedingte Entwicklungsprozesse. Beispiele für solche reifungsbedingten Entwicklungsprozesse sind das Auftauchen und Verschwinden verschiedener Reflexe nach der Geburt, die frühe Entwicklung der Motorik und die mit fortschreitender Reifung des Gehirns erfolgende Zunahme der Lernfähigkeit. Allerdings können nur sehr wenige Aspekte der Entwicklung als Reifung charakterisiert werden.
Prägung/sensible Phasen
Der Begriff stammt aus der Verhaltensbiologie und beschreibt eine irreversible Form des Lernens. Während eines meist kurzen, genetisch festgelegten Zeitabschnitts (der sogenannten sensiblen Phase) lösen Reize aus der Umwelt so starke Veränderungen des Verhaltens aus, dass diese später nicht mehr durch neue Erfahrungen korrigiert werden können. Hierbei wurde vermutet, dass das Fehlen von für die Entwicklung notwendigen Erfahrungen in diesem Zeitfenster (eine sogenannte Deprivation) besonders ungünstig für die weitere Entwicklung ist. Sensible Phasen werden z. B. für die Entwicklung der Bindung an die Eltern und für die Sprachentwicklung postuliert. Ein experimenteller Nachweis dieser Annahmen ist aus ethischen Gründen in der Regel nicht möglich, aber einige natürliche Experimente lieferten wichtige Befunde:
Beispielstudie: Die Folgen von Aufenthalten im Waisenhaus
Eine Forschergruppe um Michael Rutter untersuchte die Entwicklung von rumänischen Kindern, die ihre ersten Lebensmonate bzw. Jahre unter sehr widrigen Umständen in Waisenhäusern zubrachten. Sie hatten dort nicht genug zum Essen, fast keinen Kontakt zu Betreuungspersonen und so gut wie kein Spielzeug. Als ein Teil dieser Kinder nach Großbritannien adoptiert wurde, ergab sich die Möglichkeit, den Einfluss der widrigen frühen Erfahrungen auf die weitere Entwicklung zu untersuchen. Die Auswirkungen des Heimaufenthalts unterschieden sich danach, wie lange sie dort waren und mit welchem Alter sie nach Großbritannien kamen. |21|Bei der Ankunft in Großbritannien waren die Kinder massiv unterernährt, hatten meist deutliche körperliche Entwicklungsverzögerungen und wiesen gehäuft Störungen in der kognitiven und sprachlichen Entwicklung, Hyperaktivität sowie Störungen im Sozialverhalten auf. Viele Kinder holten in den folgenden Jahren ihre Entwicklungsverzögerungen auf und das Ausmaß der Störungen ging zurück. Mit 6 Jahren zeigten allerdings noch etwa 20 % der Adoptierten eine Bindungsstörung: Sie suchten z. B. in Stresssituationen nicht die Rückversicherung bei den Adoptiveltern und waren ohne Weiteres bereit, mit Fremden mitzugehen. Diese Störung blieb auch in etwa zwei Drittel der Fälle bis zum 15. Lebensjahr bestehen, dem bisher letzten Messzeitpunkt (Kreppner et al., 2010). Persistierende Probleme zeigten sich vor allem bei denjenigen, die mehr als sechs Monate im Kinderheim verbracht hatten.
Ein anderes Beispiel für die Wirkung ausbleibender anfänglicher Erfahrungsmöglichkeiten ist ein Mädchen mit Namen Genie, das von seiner Geburt im Jahr 1957 bis zum Jahr 1970 fast gänzlich ohne soziale Kontakte und unter extremer Bewegungseinschränkung aufwuchs. Nach ihrer Befreiung absolvierte sie ein intensives Sprachtraining. Sie erlernte zwar in den Folgejahren die englische Sprache, blieb jedoch auf dem sprachlichen Niveau eines 3- bis 4-jährigen Kindes (Curtiss, 1977). Diese Befunde sprechen dafür, dass in für die Entwicklung besonders bedeutsamen Lebensabschnitten gemachte Lernerfahrungen nicht vollständig durch spätere Erfahrungen kompensiert werden können. Trotzdem zeigte sich auch hier ein gewisses Ausmaß an Plastizität.
Stabilität(en)
Stabilität meint erst einmal, dass Merkmale sich nicht verändert haben. Bei der Untersuchung der Veränderung bzw. Stabilität des Erlebens und Verhaltens über die Zeit muss man aber verschiedene Formen der Stabilität unterscheiden (Kagan, 1980; Mortimer, Finch & Kumka, 1982).
Niveaustabilität (oder Stabilität des Mittelwerts): Hier ist die mittlere Ausprägung eines Merkmals in einer Gruppe von Personen unverändert.
Korrelative Stabilität (oder Positionsstabilität): Hier sind die interindividuellen Unterschiede in der Ausprägung eines Merkmals unverändert.
Absolute Stabilität: Wenn zugleich Niveaustabilität und korrelative Stabilität gegeben sind, spricht man von der absoluten Stabilität eines Merkmals.
Ipsative Stabilität: Die Rangreihe von Merkmalen innerhalb eines Individuums ist stabil. So könnte man Jugendliche zu zwei Messzeit|22|punkten bitten, die Wichtigkeit von beruflichen Merkmalen für ihre Berufsentscheidung anzugeben, etwa mit neuer Technik zu arbeiten, im Beruf viel Kontakt zu anderen Menschen zu haben und viel Geld zu verdienen. Wenn die Rangreihe dieser Merkmale über zwei Messzeitpunkte unverändert bleibt, liegt ipsative Stabilität vor.
Strukturelle Stabilität (Stabilität der Faktorstruktur): Meist erfasst man Merkmale nicht mit einem einzelnen Item, sondern mit einer Zahl von Items. Mit dem statistischen Verfahren der Faktorenanalyse kann man testen, welche Items jeweils ein gemeinsames Merkmal bilden (auf einen gemeinsamen Faktor laden). Strukturelle Stabilität liegt dann vor, wenn das Zusammenhangsmuster der Items und damit auch die dahinter liegende Faktorstruktur unverändert bleiben. Ein Beispiel für eine eingeschränkte strukturelle Stabilität wird im Rahmen der Differenzierungshypothese der Intelligenz beschrieben: Die Höhe des Zusammenhangs zwischen verschiedenen Intelligenztests nimmt in Kindheit und Jugend ab. Mit anderen Worten messen die Intelligenztests zunehmend etwas Unterschiedliches.
Da manchmal die Begriffe Niveaustabilität und korrelative Stabilität uneindeutig gebraucht werden, soll das im Kasten dargestellte Beispiel bei der Unterscheidung helfen.
Beispiel: Formen der Stabilität
Zur Unterscheidung von absoluter Stabilität, Niveaustabilität und korrelativer Stabilität soll folgendes Gedankenexperiment dienen. Untersucht wurden jeweils drei Merkmale von drei Personen zu zwei Messzeitpunkten. Das erste Merkmal hat sich bei keiner der Personen verändert (vgl. Abb. 1a). Es liegt absolute Stabilität vor. Das zweite Merkmal hat bei allen drei Personen zugenommen. Die interindividuellen Unterschiede in der Ausprägung des Merkmals sind jedoch stabil geblieben. Das heißt: Person 1 schnitt zu beiden Messzeitpunkten am besten ab, gefolgt von Person 2 und Person 3 (vgl. Abb. 1b). Die mittlere Ausprägung des Merkmals hat sich verändert und es liegt folglich keine Niveaustabilität vor. Die Rangreihe blieb jedoch gleich, sodass das Merkmal korrelativ stabil ist. Das dritte Merkmal hat bei Person 1 abgenommen und bei Person 2 in gleichem Ausmaß zugenommen, während sich Person 3 hier nicht verändert hat. Der Mittelwert über alle drei Personen ist somit unverändert, sodass Niveaustabilität vorliegt. Dagegen hat sich die Rangreihe der Merkmalsausprägung verändert und es liegt folglich keine korrelative Stabilität vor (vgl. Abb. 1c).
Abbildung 1a: Das Merkmal weist absolute Stabilität (zugleich Niveaustabilität und korrelative Stabilität) auf.
Abbildung 1b: Das Merkmal weist korrelative Stabilität, jedoch keine Niveaustabilität auf.
Abbildung 1c: Das Merkmal weist Niveaustabilität, jedoch keine korrelative Stabilität auf.
Kontinuität
Kontinuität liegt dann vor, wenn aktuelle interindividuelle Unterschiede in der Ausprägung von Merkmalen mit vorherigen interindividuellen Unterschieden in Merkmalen zusammenhängen. Hierbei können zwei Formen der Kontinuität unterschieden werden (Kagan & Moss, 1962):
Homotypische/homotype (gleichartige) Kontinuität: Dieser Begriff bezieht sich auf die Kontinuität der direkt erfassten (manifesten) Merkmale, ob also z. B. die Rangreihe der Personen bei der Beantwortung ein und derselben oder zumindest gleichartiger Fragen über die Zeit unverändert bleibt. Dieser Begriff entspricht dem weiter oben eingeführten Begriff der korrelativen Stabilität eines Merkmals.
Heterotypische/heterotype (andersartige) Kontinuität: Heterotypische Kontinuität bezieht sich auf die Kontinuität eines indirekt erschlossenen (latenten) Merkmals. Hohe heterotypische Kontinuität liegt also vor, wenn die Rangreihe von Personen über die Zeit konstant bleibt, obwohl in verschiedenen Altersabschnitten jeweils etwas anderes erfragt wurde. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn interindividuelle Unterschiede im Ausdruck negativer Emotionen im Säuglingsalter mit interindividuellen Unterschieden im Ausmaß des Neurotizismus im Erwachsenenalter in Beziehung stehen (vgl. Kapitel 11). Anders ausgedrückt, sind Säuglinge, die sehr oft schreien |25|und schlecht zu beruhigen sind, später im Erwachsenenalter emotional labiler und nervöser als andere Erwachsene? Die Untersuchung der heterotypischen Kontinuität ist vor allem in Kindheit und im Jugendalter wichtig, da sich das Verhaltensrepertoire hier deutlich verändert und es meist nicht möglich ist, die gleichen theoretischen Konstrukte mit den gleichen Messinstrumenten über größere Altersabschnitte hinweg zu erfassen. Bei der Untersuchung der heterotypischen Kontinuität wird der Kontinuitätsbegriff manchmal noch in einem weiteren Sinne verwendet: als sequenzieller Aufbau eines Merkmals in aufeinanderfolgenden Schritten. Hier interessiert zum Beispiel, über welche Zwischenschritte die negative Emotionalität des Säuglings zu einem erhöhten Neurotizismus führt.
1.3 Der Gegenstand der Entwicklungspsychologie
Die Entwicklungspsychologie als Teilgebiet der Psychologie befasst sich mit der Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und der Beeinflussung der menschlichen Entwicklung.
Die Beschreibung von Entwicklungsprozessen hat die möglichst objektive, zuverlässige und valide Erfassung von Veränderungen im Erleben und Verhalten zum Ziel. In den Anfängen der Entwicklungspsychologie stand die Beschreibung von Entwicklungsprozessen im Vordergrund, etwa indem Normen darüber aufgestellt wurden, in welchem Alter welche Fähigkeiten im Mittel zu erwarten sind. Darüber hinaus gibt es auch Versuche, über die gesamte Lebensspanne hinweg zentrale Entwicklungsthemen zu beschreiben, wie etwa im Rahmen des Konzepts der Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1972) oder der psychoanalytischen Entwicklungstheorie von Erikson (1988). Hier wird z. B. die Entwicklung des Selbstvertrauens als ein zentrales Entwicklungsthema des Schulkindalters und die Identitätsentwicklung als ein zentrales Entwicklungsthema im Jugendalter beschrieben (vgl. Kapitel 11).
Zur Erklärung von Entwicklungsprozessen müssen Bedingungen für das Auftreten von Entwicklungsphänomenen identifiziert werden (vgl. Abschnitt 1.4). Aufgrund der Komplexität der hierbei beteiligten Variablen wurden bisher mehr konditionale Beziehungen identifiziert (dass eine bestimmte Bedingung die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Entwicklungsergebnisses erhöht oder reduziert) als kausale Beziehungen im Sinne von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen.
|26|Eine Vorhersage der weiteren Entwicklung ist ebenfalls meist nur als Wahrscheinlichkeitsaussage möglich, da nicht alle potenziellen Entwicklungsbedingungen und deren Wechselwirkungen bekannt und vorhersehbar sind. In der Entwicklungspsychologie gibt es im Wesentlichen zwei Arten der Vorhersage von Entwicklung, und zwar Vorhersagen der Entwicklung eines Merkmals aus früheren Entwicklungsbedingungen sowie Vorhersagen der Ausprägung eines Merkmals aus der früheren Ausprägung dieses Merkmals.
Interventionen zur Beeinflussung von Entwicklungsprozessen haben einen theoretischen und praktischen Nutzen: Der erstere betrifft neue Erkenntnisse über die Plastizität von Entwicklungsprozessen. Der praktische Nutzen bezieht sich auf die Verhinderung einer unerwünschten Entwicklung (Prävention), das Rückgängigmachen einer eingetretenen Fehlentwicklung sowie die allgemeine Förderung der Entwicklung von Kompetenzen und anderen erwünschten Verhaltensweisen (vgl. Kapitel 14).
1.4 Einflüsse auf die Entwicklung
Um Entwicklungsprozesse zu erklären oder vorherzusagen, sind Erkenntnisse über Einflussfaktoren auf die Entwicklung notwendig. In den Anfängen der Entwicklungspsychologie dominierten hierbei Versuche, Entwicklungsprozesse überwiegend oder sogar ausschließlich auf Umweltfaktoren (Behaviorismus) oder biologische Faktoren (endogenistische Entwicklungstheorien) zurückzuführen. Die heute verbreiteten Theorien und Modelle gehen dagegen von einem Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Einflussfaktoren auf die menschliche Entwicklung aus (einen Überblick über Entwicklungstheorien geben Ahnert, 2014; Flammer, 2003 und Lerner, 2002): Entwicklung wird dadurch ausgelöst, dass Menschen im Laufe ihres Lebens verschiedenen Anforderungen entsprechen müssen, die biologisch, sozial/kulturell und behavioral (durch eigenes Handeln) angeregt sind. Von der Entwicklungspsychologie werden somit biologische Faktoren (wie die Pubertät) und soziale Bedingungen (z. B. elterliche Erwartungen über altersangemessenes Verhalten) ebenso untersucht wie kulturelle und geschichtliche Kontexte (wie z. B. Folgen des demografischen Wandels auf die Entwicklung) und die Eigenaktivität des Individuums beim Setzen und Verfolgen von Entwicklungszielen.
Biologische, behaviorale und soziale/kulturelle Einflüsse wirken während der Entwicklung ständig zusammen und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Abb. 2). Dass Erbanlagen unsere Entwicklung, unser Verhalten und |27|darüber vermittelt auch die Gestaltung unserer Umwelt beeinflussen, wurde in den letzten Jahrzehnten schon vielfach gezeigt (vgl. Abschnitt 1.4.1). Inzwischen gibt es aber auch Belege, dass Erfahrungen bzw. Umwelteinflüsse die Wirkungen unserer Erbanlagen verändern können. Man spricht hier von Epigenetik. So beeinflusst das Aufwachsen in einer stressreichen Umwelt die Aktivität jener Gene, welche die spätere physiologische Reaktivität auf Stressoren steuern (wie etwa das Ausmaß freigesetzter Stresshormone in Belastungssituationen). Die individuelle Stressreaktivität hat wiederum Auswirkungen auf Veränderungen der psychischen und körperlichen Gesundheit (vgl. Conradt, 2017).
Abbildung 2: Das Zusammenspiel biologischer, behavioraler und Umweltfaktoren bei der menschlichen Entwicklung (nach Gottlieb, 2001, S. 50)
1.4.1 Biologische Einflüsse auf die Entwicklung
Menschen verfügen über 23 Paare von Chromosomen, wobei von jedem Chromosomenpaar eines von der Mutter und eines vom (biologischen) Vater vererbt wurde. Auf den Chromosomen befinden sich Gene, also funktionale Einheiten, welche die biologische Grundlage für die Ausprägung von Merkmalen bilden. Gene können in verschiedenen Variationen vorkommen. Man spricht hier von Allelen. Mit Ausnahme der beiden Geschlechtschromosomen sind in Körperzellen von jedem Gen zwei Allele vorhanden.
Wenn die menschliche Entwicklung sowohl von genetischen als auch Umweltfaktoren beeinflusst wird, sind Untersuchungsmethoden notwendig, um den Einfluss dieser Faktoren zu bestimmen. Hierbei verwendet man sogenannte quantitative verhaltensgenetische Studien, welche die Stärke des Einflusses von Genen und Umweltfaktoren schätzen (vor allem Zwillings- und Adoptionsstudien). In den letzten Jahren gewannen darüber hinaus molekulargenetische Studien an Bedeutung, welche das Vorhandensein von bestimmten Allelen direkt erfassen.
|28|Bei Zwillingsstudien nutzt man die Tatsache aus, dass eineiige Zwillinge 100 % ihrer polymorphen Gene teilen (solcher Gene, die Individualität ausmachen) und zweieiige Zwillinge nur 50 %. Verglichen wird die Korrelation von gemessenen psychischen Merkmalen zwischen den Zwillingen über eine hinreichend große Zahl von Zwillingspaaren. Da eineiige Zwillinge über die gleichen Gene verfügen, müssen zwischen ihnen beobachtete Unterschiede auf Umwelteinflüssen beruhen. Bei zweieiigen Zwillingen können diese Unterschiede sowohl von Umweltbedingungen als auch von Unterschieden in der genetischen Ausstattung herrühren. Wenn die Korrelation eines Merkmals zwischen eineiigen Zwillingen größer ist als zwischen zweieiigen, schließt man auf das Wirken genetischer Faktoren. Hierbei gibt es additive Genwirkungen (ein Merkmal wird dann doppelt so stark ausgeprägt, wenn ein Individuum zwei zugrunde liegende identische Allele in seinem Erbgut hat als wenn zwei verschiedene Allele vorhanden sind) und nicht additive Genwirkungen aufgrund der Dominanz eines der beiden Allele (hier reicht bereits ein Allel aus, damit das Merkmal vollständig ausgebildet wird). Über genetische Einflüsse hinausgehende Ähnlichkeiten werden auf das Wirken geteilter (die Ähnlichkeit der Zwillinge fördernder) Umweltfaktoren zurückgeführt, etwa auf das für beide Zwillinge identische Familienklima, und beobachtete Unterschiedlichkeit trotz gleicher Gene auf sogenannte nicht geteilte Umwelt, also wenn z. B. die Zwillinge von den Eltern unterschiedlich behandelt werden oder sie einen unterschiedlichen Freundeskreis haben.
Für die Schätzung des Einflusses genetischer Faktoren und der geteilten sowie nichtgeteilten Umwelt wurden spezielle statistische Modelle entwickelt (Plomin, DeFries, McClearn & McGuffin, 2008). Erblichkeit wird hierbei definiert als Anteil der Gesamtvarianz eines beobachteten (phänotypischen) Merkmals in einer Population, das auf Unterschiede in den Erbanlagen zurückzuführen ist. Bei Zwillingsstudien wird die Erblichkeit aus der doppelten Differenz der Korrelation eines Merkmals zwischen ein- und zweieiigen Zwillingen geschätzt. Beim Vergleich zusammen aufwachsender eineiiger und zweieiiger Zwillinge besteht jedoch das methodische Problem, dass eineiige Zwillinge von ihrer sozialen Umwelt manchmal ähnlicher als zweieiige Zwillinge behandelt werden könnten, was zur Überschätzung von genetischen Einflüssen führen würde. Auch wenn die Annahme der gleichen Umwelt eineiiger und zweieiiger Zwillinge offenbar für die meisten Merkmale gegeben ist (Bouchard & Propping, 1993), wird eine solche Fehlerquelle in Adoptionsstudien vermieden, wenn möglichst früh nach der Geburt die Zwillinge getrennt wurden und in möglichst unterschiedlichen Umwelten aufwachsen. In Adoptionsstudien wird die Erblichkeit eines Merkmals geschätzt aus der doppelten Differenz der Korrelation eines Merkmals zwischen leiblichen Ge|29|schwistern und Adoptivgeschwistern. Allerdings ist auch diese Methode fehleranfällig, da z. B. in den meisten Fällen die Kinder in vergleichsweise gute Umwelten hineinadoptiert werden (sodass die mögliche Vielfalt nicht geteilter Umweltbedingungen nicht voll ausgeschöpft wird). Folglich unterschätzen die meisten Adoptionsstudien den Einfluss der nicht geteilten Umwelt (Stoolmiller, 1999). Adoptionsstudien unterschätzen zudem genetische Effekte, da bei Adoptivgeschwistern keine (durch die spezifische Kombination von Allelen bedingte) nicht additiven Effekte der Gene auftreten können. Zwillingsstudien überschätzen dagegen auch deshalb genetische Effekte, weil zweieiige Zwillinge weit weniger als 50 % nicht additive genetische Effekte zeigen, denn je mehr Gene am Effekt beteiligt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine spezifische Kombination von Allelen bei beiden zweieiigen Zwillingen zugleich auftritt. Zwillings- und Adoptionsstudien lassen sich kombinieren, um methodenspezifische Fehlerquellen zu minimieren.
Anhand von Zwillings- und Adoptionsstudien wird z. B. die Erblichkeit der Intelligenz im Mittel auf etwa 50 % und die der Grunddimensionen der Persönlichkeit (der sogenannten „big five“) auf etwa 35 bis 50 % geschätzt (Plomin et al., 2008). Diese Erblichkeitsschätzungen sind statistische Angaben, die für die untersuchten Personengruppen zutreffen. Sie erlauben jedoch nicht, beim einzelnen Individuum anzugeben, wie stark sein Erleben und Verhalten auf genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen beruhen.
Genom-Umwelt-Kovariationen
Erbanlagen (das Genom) und Umweltfaktoren wirken nicht unabhängig voneinander. Plomin, DeFries und Loehlin (1977) unterscheiden drei Arten der Genom-Umwelt-Kovariation:
Die passive Genom-Umwelt-Kovariation beruht darauf, dass das Individuum mit jedem Elternteil 50 % der Erbanlagen teilt. Da die Eltern sich solche Umweltbedingungen (Anforderungen, Angebote und Ressourcen) schaffen, die gut zur Entfaltung ihrer eigenen Erbanlagen passen, schaffen sie auch eine Umwelt, die von der Tendenz her gut zu den Genen des Kindes passt. Somit werden Kinder – ohne selbst etwas dafür zu tun – in eine Umwelt hineingeboren, die bis zu einem gewissen Grade zu ihren Erbanlagen passfähig ist. Wenn zum Beispiel musikalisch begabte Eltern ihre Begabung an ihr Kind weitervererbt haben, so wächst dieses, ohne selbst etwas dafür tun zu müssen, in einer Umwelt mit viel Musik (z. B. verfügbaren Musikinstrumenten) auf, die gute Voraussetzungen für die Entfaltung der Begabung des Kindes bietet.
|30|Die evokative Genom-Umwelt-Kovariation bedeutet, dass die Erbanlagen bestimmte Verhaltensweisen des Kindes auslösen. Darauf reagiert die soziale Umwelt, indem sie eine zu den Erbanlagen der Kinder passende Umweltbedingung schafft. Bemerken zum Beispiel die Eltern, dass ihr Kind beim Musizieren Freude hat, so werden sie eher Musikkassetten mit Kinderliedern oder Musikinstrumente für Kinder kaufen, mit deren Hilfe das Kind seine genetische Veranlagung weiter entfalten kann.
Die aktive Genom-Umwelt-Kovariation beschreibt, dass das Individuum selbst aktiv aus dem Umweltangebot solche Umwelten auswählt bzw. sich diese schafft, die zu seinen Genen passfähig sind. Der musikalisch begabte Jugendliche wird sich zum Beispiel an einer Musikhochschule für ein Studium bewerben.
Die Formen der Genom-Umwelt-Kovariation erfordern natürlich, dass die Umwelt ein Mindestmaß an Gestaltungsspielräumen bietet und in unserem Beispiel die finanziellen Mittel für den Kauf von Musikinstrumenten oder den Hochschulbesuch vorhanden sind.
Genom-Umwelt-Interaktionen
Von den Genom-Umwelt-Kovariationen sind die Interaktionen von Genom und Umwelt zu unterscheiden. Hiermit ist gemeint, dass die Auswirkung eines Umweltfaktors auf die Entwicklung von der Ausprägung genetischer Faktoren abhängt. So geht eine evolutionspsychologische Theorie von Boyce und Ellis (2005) davon aus, dass sich die biologisch bedingte Reaktivität auf Umwelteinflüsse zwischen Individuen unterscheidet und dass aus diesem Grund positive als auch negative Umwelteinflüsse unterschiedlich starke Auswirkungen auf unsere Entwicklung haben. Die Autoren verwendeten hierbei die Metaphern „Löwenzahnkinder“ und „Orchideenkinder.“ Analog zum Löwenzahn gibt es Kinder, die sich in guten und schlechten Umwelten relativ ähnlich, und zwar weder besonders gut noch besonders schlecht, entwickeln. Orchideenkinder benötigen dagegen eine gute Umwelt, um sich sehr gut zu entwickeln, und sie nehmen bei schlechten Umweltbedingungen eine ungünstige Entwicklung. Evolutionspsychologisch erklären die Autoren, dass die beiden Reaktionsweisen jeweils in bestimmten Umwelten einen Überlebensvorteil bieten: Von guten Umwelten werden eher die „Orchideenkinder“ profitieren, mit schlechten Umwelten werden dagegen „Löwenzahnkinder“ besser zurechtkommen, da sie von widrigen Umständen weniger stark beeinflusst werden. Die Reaktivität auf Umwelteinflüsse hängt hierbei sowohl von genetischen Faktoren als auch von frühen Erfahrungen mit der Umwelt ab. Es wurden |31|einige Allele identifiziert, die eine erhöhte Reaktivität auf positive und negative Umwelteinflüsse vorhersagen, wie z. B. solche, die den Transport und die Aufnahme des Neurotransmitters Dopamin steuern. Eine Metaanalyse von Bakermans-Kranenburg und van IJzendoorn (2011) zeigte, dass sich die Qualität des Elternverhaltens fast nicht auf die Entwicklung jener Kinder auswirkte, die eine geringe genetisch bedingte Reaktivität aufwiesen, während gutes bzw. schlechtes Elternverhalten bei hochreaktiven Kindern mit einer positiveren bzw. negativeren Entwicklung einherging (vgl. Abb. 3). Die Metapher von Löwenzahn- und Orchideenkindern ließe erwarten, dass es nur zwei Gruppen mit hoher und niedriger Sensitivität gegenüber Umwelteinflüssen gibt. Da man inzwischen einige Gene identifiziert hat, welche die Sensitivität beeinflussen, gibt es mehr als diese beiden Extremgruppen und die Sensitivität für Umwelteinflüsse stellt ein Kontinuum dar (Keers et al., 2016).
Abbildung 3: Differenzielle Auswirkungen einer guten und schlechten Umwelt in Abhängigkeit vom auf Dopamin bezogenen Genotyp (nach Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2011, S. 48)
Veränderung des Einflusses der Gene und der Umwelt auf die psychische Entwicklung
Auf die Frage, ob mit zunehmendem Lebensalter die Gene oder die Umwelt wichtiger für die Vorhersage von psychischen Merkmalen werden, würden die meisten Leser wahrscheinlich eine Abnahme der Bedeutung der Erbanlagen vermuten, da sich mit zunehmendem Alter immer |32|mehr Umwelteinflüsse aufaddieren (etwa Erfahrungen, die in der Familie, der Schule und im Studium gemacht werden). Bei Temperaments- und Persönlichkeitseigenschaften – wie emotionale Stabilität – findet man tatsächlich, dass der geschätzte Einfluss der Erbanlagen von fast 70 % in den ersten Lebenswochen auf 59 % im Alter von 15 Jahren absinkt (Briley & Tucker-Drob, 2014). Hierbei ist aber zu beachten, dass die Angaben über die ersten Lebensjahre in der Regel auf Elterneinschätzungen beruhen, während später zunehmend Selbsteinschätzungen der Jugendlichen zum Einsatz kommen.
Erblichkeitsschätzungen der Intelligenz nehmen von etwa 40 % in der mittleren Kindheit auf 60 % im Erwachsenenalter zu (Plomin, DeFries, McClearn & McGuffin, 2008). Eine Erklärung für diesen auf den ersten Blick überraschenden Befund liefert die Annahme von Scarr und Weinberg (1983), dass mit zunehmendem Alter die aktive Genom-Umwelt-Kovariation an Bedeutung gewinnt, während die passive Genom-Umwelt-Kovariation unwichtiger wird. Bei jungen Kindern leisten Eltern und Erzieher oder Lehrer noch einen sehr großen Beitrag bei der Gestaltung der intellektuellen Erfahrungen der Kinder. So lernen die Kinder zum Beispiel – sieht man von geistig Behinderten oder in der Entwicklung schwer Gestörten ab – in den ersten Schuljahren unabhängig von ihrer genetischen Ausstattung in gemeinsamen Klassen. Hier sind die Anregungen und Anforderungen der Umwelt noch nicht optimal an die genetische Veranlagung des Kindes angepasst. Mit zunehmendem Alter werden die intellektuellen Erfahrungen dagegen zum großen Teil selbstgesteuert, etwa wenn in Abhängigkeit von der bisherigen Schulleistung die Wahl der künftig besuchten Schulform erfolgt.
Ein Anstieg des Einflusses der Gene auf die psychische Entwicklung kann auch dadurch bedingt sein, dass manche Gene erst in einem späteren Alter zu wirken beginnen und dass in den ersten Lebensjahren die Messung psychischer Eigenschaften oft noch fehleranfälliger ist (etwa wenn die Leistung bei kognitiven Tests bei Säuglingen stark vom Wachheitszustand beeinflusst wird).
Reicht eine durchschnittliche Umwelt?
Angesichts des relativ hohen gemessenen Einflusses genetischer Faktoren auf die Entwicklung wurde von einigen Forschern eine kritische Haltung zur Bedeutung von Umweltfaktoren formuliert. So geht die These von der ausreichend guten Umwelt (good enough environment) von Scarr (1992) davon aus, dass alle genetisch normalen Kinder, solange sie in einer normalen oder durchschnittlichen Umwelt aufwachsen, das kulturell normative Verhaltensrepertoire erwerben und eine normale, ange|33|passte Entwicklung zeigen. Bestimmte Erziehungspraktiken würden hierbei aus Sicht dieser Autorin keinen großen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben. Nur familiäre Umwelten, die weit aus dem normalen Rahmen fallen, gehen nach Scarr wahrscheinlich mit einer deutlich beeinträchtigten Entwicklung einher (etwa wenn Eltern ihre Kinder misshandeln). Die Eltern müssen also nach Auffassung von Scarr nur gut genug sein, damit sich die Gene der Kinder entfalten können. Diese Position wird allerdings heftig von Sozialisationsforschern kritisiert, da viele Studien Zusammenhänge zwischen der Qualität des Elternverhaltens und einer günstigen Entwicklung der Kinder aufzeigen (z. B. Pinquart, 2016). Für eine nicht nur durchschnittliche, sondern möglichst positive Entwicklung des Kindes ist also eine durchschnittliche Umwelt nicht gut genug. Der rationale Kern dieser Kontroverse besteht darin, dass der Einfluss der Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder durch genetische Einflüsse zwar begrenzt wird, jedoch innerhalb dieser Grenzen durch günstiges Elternverhalten die kindliche Entwicklung gefördert werden kann.
1.4.2 Ökologische (soziale, kulturelle) Einflüsse auf die Entwicklung
Das ökologische Modell Bronfenbrenners ist gut geeignet zur Systematisierung der komplexen Einflüsse von Umweltmerkmalen auf die menschliche Entwicklung. Unterschieden werden fünf sich hierarchisch überlagernde ökologische Systeme (z. B. Bronfenbrenner, 1995, vgl. Abb. 4 und Kasten).
Abbildung 4: Das ökologische Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner
|34|Fünf ökologische Systeme nach Bronfenbrenner
Mikrosystem: Mikrosysteme sind die unmittelbaren Umwelten, in denen das Individuum aufwächst, also z. B. die Familie, die Gruppe der Gleichaltrigen, die Kindertagesstätte, Schule und der Arbeitsplatz. Für die kognitive Entwicklung in den ersten Lebensjahren ist zum Beispiel wichtig, wie viel Lernstimulation das Kind im Elternhaus erhält (z. B. durch interaktives Spielzeug, Bilderbücher etc.; Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo & Coll, 2001).
Mesosystem: Hiermit sind Wechselwirkungen von Mikrosystemen gemeint. So schwächt z. B. die Zugehörigkeit Jugendlicher zu einer devianten Peergruppe den Einfluss positiven Elternverhaltens auf die Entwicklung Jugendlicher ab, während umgekehrt die Zugehörigkeit zu einer positiven, leistungsorientierten Peergruppe den negativen Einfluss eines geringen elterlichen Erziehungsengagements reduziert (Brown & Huang, 1995).
Exosystem: Das Exosystem umfasst jene Umwelten, denen das Individuum nicht angehört, die es aber indirekt beeinflussen, und zwar vermittelt über Personen, die sowohl dem Exosystem als auch einem Mikrosystem des konkreten Individuums angehören. So entwickeln sich z. B. Kinder ungünstiger, wenn die Eltern abends, nachts und an den Wochenenden arbeiten müssen. Dieser Effekt wird z. T. durch elterliche Befindensbeeinträchtigungen, ein schlechteres Elternverhalten und die Abnahme von Eltern-Kind-Interaktionen vermittelt (Li et al., 2014).
Makrosystem: Das Makrosystem bezieht sich auf die Gesamtkultur einer Gesellschaft (z. B. gesellschaftliche Ideologien, rechtliche Rahmenbedingungen, gesellschaftlicher Wohlstand) oder eine Subkultur. Es beeinflusst die Entwicklung meist indirekt, vermittelt über die zuvor genannten ökologischen Systeme. So zeigte z. B. eine Studie zu Auswirkungen der amerikanischen Farmkrise, dass es durch die verschlechterte allgemeine wirtschaftliche Situation zu finanziellen Einschränkungen in der Familie und zu Beeinträchtigungen des Befindens der Eltern kam, was wiederum zum Anstieg von Konflikten zwischen den Eltern bis hin zur Abnahme der Stabilität der Familie führte. Diese familiären Faktoren beeinträchtigten ihrerseits die Qualität des Elternverhaltens, was negative Auswirkungen auf die psychosoziale Anpassung der betroffenen Jugendlichen hatte (Conger, Rueter & Conger, 2000).
Chronosystem: Bronfenbrenner betont zudem, dass sich im Prozess der menschlichen Entwicklung und aufgrund sozialen Wandels auch die ökologischen Kontexte, denen das Individuum angehört, systematisch verändern. Die Gesamtheit der ökologischen Systeme, denen ein Individuum im Laufe seines Lebens angehört bzw. angehörte (von der Herkunftsfamilie über die Kindertagesstätte, Schule, Arbeitsplatz etc.) wird Chronosystem genannt.
Gesellschaftliche Faktoren wirken meist indirekt
|35|Welche Prozesse den Einfluss der ökologischen Systeme auf die Entwicklung vermitteln, wird im zweiten Band zur Entwicklungspsychologie im Rahmen dieser Lehrbuchreihe behandelt (vgl. Lang, Martin & Pinquart, 2012).
1.4.3 Menschen als Mitgestalter ihrer Entwicklung
Die Entwicklung enthält Spielraum, der von den Menschen in Abhängigkeit vom Entwicklungstand und den damit verbundenen Kompetenzen genutzt werden kann. Während die Entwicklung im Kindesalter noch relativ stark durch die Eltern gelenkt wird, werden Jugendliche und Erwachsene zunehmend zu aktiven Mitgestaltern ihrer Entwicklung. Erste Wünsche und Ideen, wie man sein künftiges Leben gestalten will, entstehen bereits im Grundschulalter. Im Jugendalter werden diese zunehmend differenzierter und realistischer, und im Erwachsenenalter fügen sich bereichsspezifische Pläne zu mehr oder weniger kohärenten und differenzierten Lebensplänen zusammen. Man spricht von intentionaler Selbstentwicklung, wenn Individuen Ziele setzen und verfolgen, die auf das eigene Selbst und die eigene Entwicklung bezogen sind (Brandtstädter, 2011).
Um sein Leben aktiv mitzugestalten, benötigt man Wissen über mögliche Wege zur Zielerreichung, die Überzeugung, diese Ziele erreichen zu können (sogenannte Kontrollüberzeugungen bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen) und selbstregulatorische Fähigkeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Allerdings sind die Möglichkeiten, seine eigene Entwicklung zu gestalten, begrenzt. Das beruht sowohl auf begrenzten individuellen Voraussetzungen (wenn man z. B. nicht den notwendigen Zensurendurchschnitt für den Wechsel auf ein Gymnasium erreichte) als auch Einschränkungen bei äußeren Voraussetzungen (etwa der Anzahl verfügbarer Lehrstellen). Zudem sind die Kontexte, in denen wir unsere Ziele setzen und verfolgen teilweise intransparent und nur eingeschränkt vorhersagbar, etwa wenn ein kritisches Lebensereignis (z. B. eine schwere Erkrankung) eintritt, welches die Erreichung von Entwicklungszielen beeinträchtigen oder verhindern kann. Der Begriff der Mitgestaltung der eigenen Entwicklung berücksichtigt die eingeschränkte Gestaltbarkeit besser als der Begriff der Selbstgestaltung, welcher in diesem Kontext auch manchmal gebraucht wird.
Entwicklungsziele ändern sich im Laufe der Entwicklung (und unterliegen damit selbst einem Entwicklungsprozess). So finden sich z. B. die für einen Altersbereich beschriebenen Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1972) oft in den Entwicklungszielen wieder. Bis zum jungen |36|Erwachsenenalter dominieren Veränderungsziele, die auf das Erreichen von etwas Neuem bezogen sind, während im mittleren und späten Erwachsenenalter diese Ziele weniger werden und jene Ziele an Bedeutung gewinnen, die auf den Erhalt des Status Quo und die Vermeidung von Verlusten bezogen sind (z. B. Hundertmark & Heckhausen, 1994).
Neben der mehr oder weniger intentionalen Beeinflussung der eigenen Entwicklung durch das Setzen und Verfolgen von Entwicklungszielen kann das menschliche Verhalten auch als Nebenprodukt die Entwicklung beeinflussen, etwa wenn es Reaktionen aus der Umwelt auslöst und diese wiederum die Entwicklungsbedingungen für das Individuum verändern.
1.5 Geschichte der Entwicklungspsychologie
Dass sich der Mensch von der Geburt bis zum Tod in seinem Aussehen, seinen Fähigkeiten, dem Verhalten und anderen psychischen Eigenschaften verändert, ist so offensichtlich, dass diese Erkenntnis schon in frühen Zeugnissen der Menschheitsgeschichte anzutreffen ist (vgl. Eckardt, 2010). So unterteilten bereits die Philosophen der Antike (wie Aristoteles und Platon) den Lebenslauf nach Altersstufen und diskutierten die Vorzüge und Nachteile einzelner Lebensphasen.
Ariés (1975) ging davon aus, dass dieses Wissen im Mittelalter wieder verloren gegangen war, da – abgesehen von der Zeit der biologischen Abhängigkeit des Kleinkindes – noch keine wesentlichen Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen gemacht wurden und in dieser Zeit auf Gemälden Kinder als kleine Erwachsene dargestellt sind, Kinderarbeit üblich war und in der Rechtsprechung Kinder (im Gegensatz zum römischen Recht in der Antike) wie Erwachsene behandelt wurden. Die Annahme von Ariés blieb aber nicht unwidersprochen.
Die Beschäftigung mit der menschlichen Entwicklung erreichte einen ersten Höhepunkt in Jean Jacques Rousseaus (1712–1778) Erziehungs- und Entwicklungsroman „Emile“ (1762). Rousseau beschrieb die Entwicklung Emiles vom Säuglingsalter zum jungen Erwachsenenalter als ein Durchlaufen von fünf Stufen, deren Abfolge er als naturgegeben und folglich universell annahm. Mit Dietrich Tiedemann (1748–1803) begann die systematische, auf der Beobachtung gegründete |37|längsschnittliche Erfassung des Verhaltens von Kindern. Er fertigte Tagebuchaufzeichnungen der Beobachtungen über die ersten zweieinhalb Jahre der Entwicklung seines Kindes an („Beobachtungen über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern“, 1787). Solche Aufzeichnungen waren allerdings nur begrenzt objektiv und verallgemeinerbar, da z. B. die Sicht durch die Elternrolle oder den Elternstolz verzerrt sein kann und interindividuelle Unterschiede natürlich bei der Beobachtung eines einzigen Kindes unberücksichtigt bleiben müssen.
Herausbildung als Wissenschaft
Die Anfänge der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie – im Sinne der empirischen Untersuchung der menschlichen Entwicklung und der theoretischen Einordnung der Befunde – werden meist auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts datiert. Die erste umfangreiche wissenschaftliche Aufzeichnung von Beobachtungen an Kleinkindern wurde in William T. Preyers (1841–1897) Buch „Die Seele des Kindes“ (1882) publiziert. Im Gegensatz zu früheren Publikationen von Beobachtungen der Kindesentwicklung stellte Preyer klare Regeln der Dokumentation des Verhaltens des Kindes auf (wie z. B. die unmittelbare Dokumentation des Beobachteten, die Überprüfung der eigenen Beobachtung durch die Beobachtung anderer, und die Durchführung mehrmaliger Beobachtungen pro Tag). Das Erscheinen von Preyers Buch wird von vielen Autoren als der Beginn der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie angesehen (Cairns & Cairns, 2006).
Institutionalisierung und Expansion
Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts nahm die Entwicklungspsychologie als Wissenschaftsdisziplin einen raschen Aufschwung. So wurden zwischen 1890 und 1915 weltweit 21 kinderpsychologische Zeitschriften und 26 Universitätsinstitute für Kinderforschung gegründet. Es entstanden psychologische (Psychoanalyse, Behaviorismus) und entwicklungspsychologische Theorien (z. B. die Genfer Schule der kognitiven Entwicklung), welche der Erforschung der menschlichen Entwicklung einen großen Auftrieb gaben.
Dieser Aufschwung war eng mit der Entwicklung psychologischer Untersuchungsmethoden verbunden. Erste Ansätze zur standardisierten Testung der Intelligenz wurden durch Binet und Simon (1905) entwickelt. Mit der zunehmend besseren Erfassung des Entwicklungsgeschehens wurden Altersnormen für verschiedene Funktionsbereiche (wie z. B. Motorik, begriffliches Denken, Sprache) aufgestellt. Hier sind vor |38|allem drei von Arnold Gesell und Mitarbeitern publizierte Bücher zu nennen (z. B. Gesell, 1940).
In den 1920er und 30er Jahren begannen in den USA breit angelegte Längsschnittstudien, die für den Fortschritt der Entwicklungspsychologie von großer Bedeutung waren, wie etwa die von Lewis Terman im Jahre 1920 initiierte Untersuchung von überdurchschnittlich begabten Kindern oder die unter Leitung von Harald Jones durchgeführte Oakland Growth Study sowie die Berkeley Guidance Study (von Nancy Bailey und Harald Jones). Ziel dieser Studien war die Untersuchung von Verläufen einer großen Spannweite von Aspekten des Erlebens und Verhaltens sowie die Identifikation von zugrunde liegenden Entwicklungsbedingungen. Die drei genannten Studien, welche anfangs nur die Entwicklung in der Kindheit und Jugend zum Gegenstand hatten, wurden später bis in das Erwachsenenalter bzw. hohe Alter weitergeführt und lieferten somit eine interessante und bis heute einmalige Datenbasis für die Untersuchung der psychischen Entwicklung über die Lebensspanne.
Aktuelle Trends in der Entwicklungspsychologie
In den letzten Jahrzehnten sind vor allem vier Trends zu beobachten: Erstens hat sich seit den 1970er Jahren die Auffassung von der Entwicklung als lebenslanger Prozess durchgesetzt (Baltes et al., 2006) und die Zahl von Studien über die psychische Entwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter wuchs stark an (z. B. das MacArthur Foundation Research Network on Successful Midlife Development oder die unter Leitung von Karl Ulrich Mayer und Paul B. Baltes durchgeführte Berliner Altersstudie).
Zweitens hat die Interdisziplinarität der Erforschung von Entwicklungsprozessen zugenommen (z. B. Untersuchung von Zusammenhängen zwischen der Entwicklung des Zentralnervensystems und der Verhaltensentwicklung; z. B. Kaufmann, Nuerk, Konrad & Willems, 2007). Dies führte zum Beispiel zur Verwendung des übergreifenden Begriffs „Entwicklungswissenschaft“. Aus der Interdisziplinarität heraus sind auch neue Forschungsrichtungen entstanden, wie etwa die Entwicklungspsychopathologie, die Übergänge zwischen gelungener Entwicklung und Fehlanpassung an normative Entwicklungsanforderungen (vgl. Kapitel 13) beschreibt.
Der dritte Trend betrifft die forschungsleitenden theoretischen Modelle. Nachdem lange Zeit die Suche nach möglichst allgemeinen Entwicklungsmodellen dominierte (wie der strukturgenetische Ansatz von |39|Piaget, vgl. Kapitel 4) nahmen immer mehr empirische Befunde zu, die eine Bereichsspezifizität, Kontextabhängigkeit und Aufgabenspezifität der menschlichen Entwicklung zeigten. Damit trat eine Vorstellung von Entwicklung als hochkomplexer, in viele Inhaltsbereiche gegliederter Prozess in den Vordergrund. Dies führte zur Herausbildung zahlreicher bereichsspezifischer Entwicklungstheorien („Minitheorien“) und damit zu einer gewissen Zersplitterung des Feldes. In jüngster Zeit nimmt die Suche nach einer integrierenden, einheitlichen Gesamtkonzeption der menschlichen Entwicklung wieder zu. Beispiele hierfür sind systemtheoretische Ansätze, welche Wechselwirkungen zwischen biologischen, sozialen/ökologischen und behavioralen Einflüssen auf die menschliche Entwicklung thematisieren (vgl. Lerner, 2002, 2015).
Viertens schließlich hat die Anwendung entwicklungspsychologischer Erkenntnisse an Bedeutung gewonnen. Hier sind z. B. Programme zur Entwicklungsförderung benachteiligter Kinder (etwa das Head Start Programm in den USA) und Programme zur Förderung der positiven Jugendentwicklung zu nennen (vgl. Kapitel 14).
Zusammenfassung
Gegenstand der Entwicklungspsychologie ist die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Optimierung der psychischen Entwicklung. Unter psychischer Entwicklung versteht man hierbei die geordnete, gerichtete und längerfristige Veränderung des Erlebens und Verhaltens über den gesamten Lebenslauf.
Die psychische Entwicklung wird vom Zusammenspiel von biologischen Faktoren, sozialen Faktoren und der Eigenaktivität des Individuums beeinflusst. Auch wenn die Entwicklungspsychologie als Wissenschaft erst vor etwa 135 Jahren entstand, hat sie seitdem einen rasanten Aufschwung genommen.
Weiterführende Literatur
Lerner, R. M. (Ed.). (2015). Handbook of child psychology and developmental science. Vol. 1: Relational, developmental systems theories and methods (7thed.). New York: Wiley.
Fragen
Was versteht man unter psychischer Entwicklung?
Kennzeichnen Sie die Aufgaben der Entwicklungspsychologie.
Welche Aspekte der Stabilität von Merkmalen kann man unterscheiden?
|40|Wie gut können anfängliche Entwicklungsdefizite später ausgeglichen werden?
Was ist mit der Metapher der Löwenzahn- und Orchideenkinder gemeint?
Was versteht man unter intentionaler Selbstentwicklung?
Lösungshinweise finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
|41|Kapitel 2Methoden der Entwicklungspsychologie
Gudrun Schwarzer
|42|Schlüsselbegriffe
Datengewinnung: Beobachtung, Interview, Fragebogen, Test, Psychophysiologie
Zusammenhänge und Ursachen der gewonnenen Daten: Korrelationsstudie und Experiment
Methoden zur Untersuchung altersbezogener Veränderungen: längsschnittliche und querschnittliche Verfahren, kulturvergleichende und komparative Untersuchungen
Eine wesentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie besteht darin, geeignete methodische Verfahren bereitzustellen, anhand derer Hypothesen über die Entwicklung des Menschen geprüft werden können. Nur aufgrund solcher Verfahren können sichere Aussagen über das Entwicklungsgeschehen gewonnen werden, auf deren Basis z. B. mithilfe spezifischer Maßnahmen in den Verlauf einer Entwicklung eingegriffen werden kann. Eine wesentliche Herausforderung ist dabei, je nach Alter und Fragestellung aussagekräftige Daten über ein Kind zu erheben. Gerade in jungen Altersbereichen, in denen die Kinder selbst noch nicht sprechen können oder aber komplexe Aufgabenstellungen noch nicht verstehen können, müssen Untersuchungsaufgaben und -aufbauten ausgedacht werden, die eine reliable, valide und objektive Datenerhebung erlauben. Wie in anderen Bereichen der wissenschaftlichen Psychologie auch, ist es darüber hinaus essenziell herauszufinden, wie sich die erhobenen Daten erklären lassen. Es sollen die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Daten ermittelt werden und optimalerweise die Bedingungsfaktoren und Ursachen der relevanten Daten herausgefunden werden. Für die Entwicklungspsychologie ist es hierbei von besonderer Bedeutung, methodische Vorgehensweisen und Untersuchungsdesigns zu kreieren, die es ermöglichen, die erhobenen Daten in Beziehung zu dem Lebensalter zu setzen. Auf diese Weise können dann Aussagen über nachhaltige altersbezogene Veränderungen getroffen werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Alter an sich keine unabhängige Variable im üblichen Sinne darstellt, da es z. B. in einem Experiment nicht zu manipulieren ist. Das Alter wird stattdessen als sogenannte Trägervariable aufgefasst. Hiermit ist gemeint, dass die Variable Alter einen Abschnitt auf dem Zeitkontinuum repräsentiert, in dem Prozesse stattgefunden haben, die für die erhobenen Daten verantwortlich sind.
Im vorliegenden Kapitel werden nun die verschiedenen Bereiche der entwicklungspsychologischen Methoden im Einzelnen erläutert. Zunächst werden unterschiedliche Vorgehensweisen zur Datengewinnung dargestellt. Dann werden Verfahren zur Analyse von Bedingungen und |43|Ursachen kindlichen Verhaltens erklärt und schließlich Designs dargelegt, anhand derer mit zunehmendem Alter einhergehende Veränderungen untersucht werden können.
2.1 Datengewinnung
2.1.1 Beobachtung
Wenn man zur Gewinnung von Daten nicht auf sprachliche Mittel zugreifen kann, weil die Kinder z. B. noch nicht sprechen können oder weil sprachliche Kommunikation aufgrund der Fragestellung als ungeeignet erscheint, kann man auf die Methode der Beobachtung zugreifen. Nach Deutsch und Lohaus (2007) kann diese Methode danach unterteilt werden, ob die Beobachtung in einem experimentellen Kontext stattfindet oder in einer natürlichen Situation. Gerade bei Untersuchungen mit Säuglingen finden Beobachtungen meistens in verschiedenen experimentellen Kontexten statt. Hierbei werden systematisch Stimuli präsentiert und es wird die Reaktion der Babys beobachtet, um dann Rückschlüsse z. B. auf ihre Wahrnehmungsfähigkeiten zu ziehen. Man unterscheidet beispielsweise Verfahren, die auf klassisch oder operant konditionierten Reaktionen basieren (vgl. Kavsek, 2000):





























