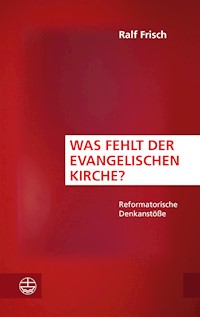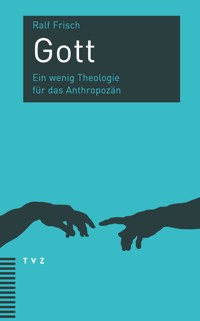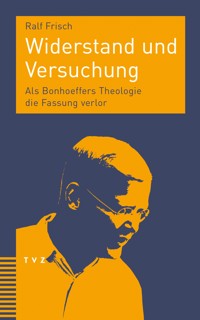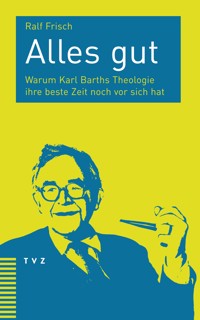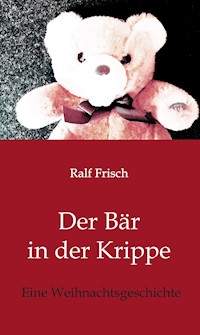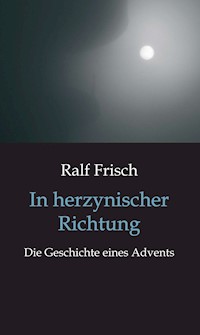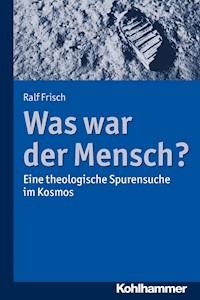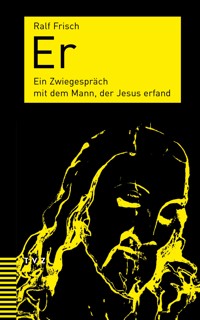
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn man den Verfasser des Markusevangeliums fragen könnte, warum er schrieb, was er schrieb? Ob er das, was er über Jesus erzählte, wirklich für die Wahrheit hielt? In diesem fulminanten Buch über Jesus von Nazaret verwickelt Ralf Frisch den unbekannten Evangelisten, der seit Urzeiten den Namen Markus trägt, in ein Zwiegespräch über Helden und Dämonen, über Fiktion und Wahrheit, über Einsamkeit, Schönheit und Zorn, über die Intensität dieses Jesus von Nazaret. Bei seinem Gedankenexperiment macht Ralf Frisch keinen Bogen um theologische Tabus: Wäre es nicht klüger gewesen, der Nachwelt den Kreuzestod zu ersparen? War die Auferstehung des Nazareners womöglich nur ein Hirngespinst? Welche Zukunft hat Jesus Christus in einer Welt, die sich nach Leben und nach Erlösung sehnt, aber zur Erfüllung ihrer Sehnsucht Gott nicht braucht? Die Antworten des Evangelisten Markus kommen unerwartet. Sie haben die Kraft, Raum und Zeit zu verformen - nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Frisch
Er
Ein Zwiegespräch mit dem Mann, der Jesus erfand
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2019–2020 unterstützt.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung
Simone Ackermann, Zürich
Unter Verwendung (Detail) des Bilds «Christ 112 Times, Last Supper» von Andy Warhol. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 2019, ProLitteris, Zürich.
Druck
Rosch-Buch GmbH, Scheßlitz
ISBN 978-3-290-18300-4 (Print)
ISBN 978-3-290-18301-1 (E-Book: PDF)
ISBN 978-3-290-18792-7 (E-Book: EPUB)
© 2020 Theologischer Verlag Zürich
www.tvz-verlag.ch
Alle Rechte vorbehalten
»You don‘t believe in the Force, do you?«
Luke Skywalker zu Han Solo
im Film »Star Wars. A New Hope«
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Glaubensfrage
Vorwort
Annäherung
Was ist Wahrheit?
Herr über die unreinen Geister
Jenseits des Allzumenschlichen
Weltfremdwerdung
Erlösende Schönheit
Passion statt Blutleere
Heiliger Zorn
Unendlicher Schmerz
»Er ist nicht hier.«
Die Wiederkehr des Fremden vom Himmel
Vorwort
Dieses Buch ist ein Zwiegespräch. Ein Zwiegespräch mit mir selbst und mit einem, der eines Tages vor mein inneres Auge trat, als ich über der Bibel sass und mich angesichts des Markusevangeliums in Fragen vertiefte, die auch nach vielen Jahren Theologie und nach vielen Jahren Kirche nicht aufhören, an mir zu zerren.
Wer war Jesus von Nazaret? Wer ist er für uns Heutige? Wer kann er für eine Zukunft sein, die sich noch weiter als wir vom Ursprung des christlichen Glaubens entfernt haben wird? Und nicht zuletzt: Ist Jesus von Nazaret wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben?
Der imaginäre Gesprächspartner, der ungerufen herbeikam, um mit mir und mit der Wirklichkeit und Wahrheit des Fremden aus Galiläa zu ringen, ist seinerseits ein Fremder. Die, die ihn schon eine Generation später nicht mehr kannten, gaben ihm den Namen Markus und benannten seine Schrift, das älteste Evangelium, nach diesem Namen.
Als mir dieser Unbekannte aus der Vergangenheit erschien, fiel es mir auf einmal leichter, der Frage nach der Wahrheit und nach dem Geheimnis Jesu auf die Spur zu kommen. Im Zwiegespräch mit dem fremden Evangelisten, den meine Phantasie in diesem Buch an die Seite seiner Schrift stellt, wurde das allzu vertraute Evangelium unversehens fremder und faszinierender denn je. So manche Richtigkeiten der neutestamentlichen Exegese, der traditionellen Dogmatik und der gegenwärtigen Theologie verblassten und gaben den Blick auf Neuland frei. Der Horizont weitete sich, als ich begann, den Text wider alle Regeln historisch-kritischer Literaturwissenschaft und Hermeneutik mit seinem Autor zu konfrontieren und meiner kreativen theologischen Einbildungskraft freien Lauf zu lassen.
Ich habe beim Schreiben nicht gezögert, dieses Neuland zu betreten – auch auf die Gefahr hin, dort in theologisch hochriskante Abenteuer zu geraten, von denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich möglicherweise kopfschüttelnd abwenden. Vielleicht geht es Ihnen mit der Lektüre aber ja auch ganz anders. Vielleicht springt ein Funke meiner Imagination auf Sie über – ein Funke, der Sie neu nach der Wahrheit Jesu, nach der Wahrheit seines Evangeliums und nach der Wahrheit Ihres Lebens fragen lässt.
Sie werden nahezu jedem Satz dieses Buchs anmerken, wie sehr mich die Frage nach der Wirklichkeit und nach der Wahrheit Jesu Christi beim Schreiben umgetrieben hat. Und wenn Sie beim Lesen entdecken, dass auch Sie mit Jesus noch nicht fertig sind, dann hat mein Buch seinen Zweck erfüllt – den Zweck, diejenigen, die es zur Hand nehmen, in die heilsame Unruhe des Ringens mit dem Mann aus Nazaret zu versetzen – in einen Zustand also, der ziemlich genau das Gegenteil von Langeweile ist.
Ich verbinde dieses Vorwort mit einem Dank. Er gilt Lisa Briner, der Leiterin des Theologischen Verlags Zürich, und ihrem wunderbaren Team, insbesondere Bigna Hauser. Ich danke ihnen allen sehr herzlich für den Mut, einmal mehr ein ungewöhnliches und riskantes Buch zu veröffentlichen – ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es Sie, liebe Leserinnen und Leser, inspiriert und vielleicht sogar ein wenig über den Boden der Tatsachen erhebt.
In der Fränkischen Schweiz
im Spätwinter 2020
Ralf Frisch
0
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen.
Markus 1,10
Annäherung
Die Erschaffung eines Himmelskörpers
Es zieht mich ins Markusevangelium. Immer wieder lese ich es. Vom Anfang bis zum Ende. Was suche ich dort? Vielleicht doch das Geheimnis des Ursprungs. Den Zündfunken des christlichen Glaubens. Den, der alles auslöste. Den Menschen Jesus von Nazaret. Den, von dem ich glaube, dass in ihm ein ganz anderes Menschsein das Licht der Welt erblickte. Ein Menschsein, das nicht und niemals der Vergangenheit angehören kann. Ein Menschsein, das die Wahrheit und das Geheimnis des Daseins und das Geheimnis und die Wahrheit Gottes offenbart.
Doch mein Wunsch, dem Menschen Jesus zu begegnen, zerschellt an einer Einsicht, die sich zwar schon seit Jahrzehnten in mir festgesetzt hat, mich aber erst nach wiederholter Lektüre des ältesten Evangeliums wirklich in ihrer ganzen Konsequenz ereilt. Denn mir wird klar, dass das Leben Jesu von Nazaret, das uns der Evangelist vor Augen malt, eine Erfindung ist. Eine Erfindung jenes Unbekannten, den der Kirchenvater Papias von Hierapolis um das Jahr 100 nach Christus für Markus, den Dolmetscher des Petrus, hielt.
Er, der sogenannte Markus, der Mann, der das erste Evangelium schrieb, war es, der das Leben Jesu erfand. Er war es, der die Erinnerungs- und Überlieferungsbruchstücke, die in den ersten christlichen Gemeinden kursierten, wie Perlen auf eine Kette aufreihte und dieser Kette den Namen »Evangelium« gab. Und zwar deshalb, weil er das, was er zu sagen hatte, für die schlechthin gute Nachricht, ja sogar für das Bestmögliche hielt, was es über Gott und die Welt zu sagen gibt. Ohne ihn, den unbekannten Evangelisten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, stünde das Leben Jesu nicht als Geschichte vor uns, und wir könnten es nicht als Geschichte erzählen. Ohne ihn, den Autor des ältesten Evangeliums, gäbe es die literarische Gattung Evangelium nicht. Paulus, der vor ihm über Christus schrieb, hatte das Leben des Mannes aus Nazaret nicht vor Augen, und er wollte es auch nicht vor Augen haben, weil er von diesem Leben letztlich nichts wissen wollte. Jedenfalls nichts, was sich vor dem Tod Jesu abspielte. Nur dessen Ende, das keines war, und die Bedeutung dieses Endes für den christlichen Glauben zählten für ihn. Dass Paulus das Leben Jesu gleichgültig war, zeigt sich nicht zuletzt an den berühmten Sätzen, die er im fünfzehnten Kapitel seines ersten Briefs an die Gemeinde in Korinth über die Auferstehung schrieb: »Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit […] Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib.«
Während für Paulus der natürliche Leib Jesu im Grab verweste, lässt Markus den irdischen Jesus, dessen Lebensgeschichte ihm ganz und gar nicht gleichgültig war, in die Worte seines Evangeliums hinein auferstehen. Weil Markus wusste, dass es auch eine Verwesung durch Vergessen gibt, setzte er sich daran, diese Lebensgeschichte zu konservieren, indem er sie erzählbar machte. Einzelne Gleichnisse und einzelne Jesusworte, zu denen sich dann andere Gleichnisse, andere Worte und andere Weisheiten anderer Menschen hinzugesellten, weil sie zur Verkündigung Jesu zu passen schienen, waren ihm in ihrer losen und ungebundenen Form zu wenig und vielleicht nicht haltbar genug. Er wollte, so stelle ich mir vor, aus den zahllosen Mosaiksteinen der urchristlichen Überlieferung ein Bild schaffen. Ein Bild eines Menschen, das zugleich ein Bild eines Gottes war. Nicht das, was man heute unter einer Biografie versteht. Ganz und gar nicht. Aber doch ein Bild. Er wollte dem Verkündigten die Gestalt eines Lebens verleihen, durch deren Gegenwart alles andere von ihm Erzählte noch gegenwärtiger und noch intensiver präsent werden sollte. Wahrscheinlich verstand er sich also in gewisser Weise als Retter Jesu. Als Retter des Retters sozusagen. Als Retter, der dafür sorgen wollte, dass die letzten »heissen« Erinnerungen an den Galiläer nicht erkalten und nicht im Dunkel der Geschichte verloren gehen.
In Markus 13,1 lässt der Evangelist einen der Jünger Jesu im Blick auf den Jerusalemer Tempel zu seinem Herrn sagen: »Meister, schau, was für Steine und was für Bauten!« Und Jesus entgegnet ihm einen Vers später: »Hier wird kein Stein auf dem andern bleiben.« Wenn in diesen Sätzen tatsächlich die Erfahrung der Zerstörung des Jerusalemer Tempels verarbeitet ist, also das Markusevangelium nicht vor dem Jahr 70 nach Christus vollendet wurde, dann schrieb der unbekannte Evangelist fast zwei Generationen nach dem Tod Jesu gegen das Vergessen an. Er, der Jesus von Nazaret zu Lebzeiten nie begegnet war, rettete das wertvolle Treibgut der Jesuserinnerung vor dem Schicksal, irgendwann nicht einmal mehr Erinnerung zu sein, sondern endgültig von der Geschichte weggeschwemmt zu werden. Er bewahrte Jesus von Nazaret davor, zur »Black Box« oder zum »White Cube« zu werden, der sich mit beliebigen Bildern und Projektionen füllen lässt. Und so wurde er nicht nur zum Retter und Konservator, sondern auch zu einer Art Kurator des seiner Überzeugung nach von Gott selbst aus der Ewigkeit an die Gestade der Zeit gespülten Lebens Jesu.
Wenn aber der älteste Evangelist nicht nur Schöpfer, sondern als Retter der Erinnerung auch Erhalter war, dann ist das Kunstwerk, das er geschaffen hat, womöglich doch vollgesogen mit verwandelter, Literatur gewordener Wirklichkeit. Ich gestehe, dass ich gern von dem Mann, den sie Markus nannten, erfahren würde, was er, der zweitausend Jahre Ältere, unter Wirklichkeit und unter Wahrheit verstand. War er sich im Klaren über den Unterschied zwischen Fakten und Fiktionen? Oder würde er mir lächelnd entgegenhalten, dass er den Unterschied gar nicht verstehe – so, wie ja auch wir Heutigen, Kinder einer immer postfaktischer und immer virtueller werdenden Welt, diesen Unterschied aus dem Blick verlieren? Denn auch wir realisieren ja oft nicht, dass unser Wirklichkeitsverständnis massgeblich auf grossen Erzählungen und Suggestionen beruht, die es fundieren, ohne dass wir die Wahrheit dieser Erzählungen und Suggestionen ihrerseits überprüfen könnten oder wollten.
Und als ich mich frage, was Wahrheit und Wirklichkeit wohl für ihn bedeutet haben, ist er auf einmal da, der fremde Evangelist. Als ich von meiner Lektüre seines Evangelium aufblicke, in das ich mich vergraben habe, um aus ihm die Wahrheit zu Tage zu fördern, die mein Leben und das Leben Jesu in ein neues Licht tauchen soll, sehe ich ihn. Ich weiss nicht, woher er kommt, und ich weiss nicht, wo er sitzt, als er seine Feder aus der Hand legt. Jetzt, da vollendet ist, was er zuvor ersonnen, gedreht, gewendet und schliesslich in eine Schrift übersetzt hat, die durch den Ozean der Jahrtausende den Weg zu uns gefunden hat. Ich sehe ihn vor mir, wie er seinen letzten Satz zu Papyrus bringt. Und ich sehe ihn vor mir, wie er buchstäblich mit dem Anfang anfängt und an diesem Anfang das griechische Wort für »Anfang« niederschreibt. Vielleicht zögerlich. Vielleicht auch voller entschlossener Bestimmtheit, die in seinem Evangelium daran sichtbar wird, dass auf dieses erste Wort Satz für Satz Letztgültiges und Letztinstanzliches folgt. Sechzehn Kapitel lang. Bis zum letzten Wort, einem eigenartigen «nämlich»: »Sie fürchteten sich nämlich.« Alles andere, was danach kommt, sich aber in den wichtigsten und ältesten Handschriften des Markusevangeliums nicht findet, haben andere, Spätere hinzugefügt. Vielleicht, weil ihnen dieses atemlose, fast literarisch moderne Ende so wenig geheuer war, dass sie sich gefragt haben, ob ein Buch, das mit solch majestätischen Worten beginnt, wirklich derart abgerissen und gewissermassen mit offenem Mund enden kann. Aber so ist es. Markus stillt unsere Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit dem ins Leben zurückgekehrten Jesus nicht. Er lässt uns allein mit dem Entsetzen der Frauen, über die zuerst angesichts des sinnleeren Todes und dann angesichts des jesusleeren Grabes eine grosse Fassungslosigkeit kam.
Ich sehe ihn also vor seinem Evangelium sitzen, den Fremden aus der Vergangenheit. Irgendwo in der mediterranen Welt, eines Abends, im verdämmernden Licht des Tages. Vielleicht legt er in diesem Augenblick, in dem er mir vor meinem inneren Auge erscheint, den Zeigefinger auf die Lippen. Vielleicht hält er inne und blickt in den Himmel, um darüber nachzudenken, ob die Worte, die er gefunden hat, tragfähig genug für das Gewicht des Himmels sind. Denkt er, dass der Mann aus Nazaret jetzt dort oben, in diesem rätselhaften Himmel ist und irgendwann aus diesem Himmel auf die Erde zurückkehren wird? Oder weiss er in diesem Moment genau wie wir, dass der Himmel, dessen Wolken er im ersten Kapitel sich zerteilen lässt, um Gottes Liebeserklärung an Jesus hörbar zu machen, nur eine Metapher für eine ganz andere Wirklichkeit ist? Und dämmert ihm angesichts der ersten, zaghaft funkelnden Sterne, dass er selbst etwas Sonnen- und Sterngleiches, einen Himmelskörper also, geschaffen hat?
Ich hätte Lust, mich ihm anzunähern, mich neben ihn zu setzen und ihm zu erzählen, was es mit Himmel und Erde aus der Sicht jener Wissenschaften auf sich hat, die vielleicht nur wenige hundert Kilometer von ihm entfernt im sechsten Jahrhundert vor Christus in Ionien zur Welt kamen. Ich hätte Lust, ihm davon zu erzählen, dass manche Himmelskörper so schwer sind, dass ihre Anziehungskraft Raum und Zeit verformt – manchmal sogar so sehr, dass nicht einmal mehr das Licht dem Sog ihrer Gravitation entrinnt. Ich hätte Lust, ihm davon zu erzählen, dass es Schwarze Löcher gibt, deren Schwerkraft so gross ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Gedanken liebäugeln, im unzugänglichen und unsichtbaren Inneren dieser Schwarzen Löcher könnte das Raum-Zeit-Kontinuum zerreissen und den Weg in ein anderes Universum und in einen anderen Himmel freigeben, den kein Mensch jemals gesehen hat. Und ich hätte Lust, ihm davon zu erzählen, dass man das unzugänglich dunkle Innere eines Schwarzen Loches eine Singularität nennt. All dies würde ich ihm aber nicht etwa deshalb erzählen, weil ich ihm seinen begrenzten Horizont vor Augen zu führen gedenke, sondern um mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, welche metaphorischen Möglichkeiten ihm mangels des naturwissenschaftlichen Wissens künftiger Epochen bei der Abfassung seines Evangeliums entgingen.
»Wie bedauerlich, Markus«, würde ich also zu ihm sagen, »dass du nicht ahnen konntest, welch wunderbare Bilder dir die Astronomie meiner Gegenwart für die Beschreibung des Himmelskörpers zur Verfügung hätte stellen können, um den dein Evangelium kreist! Denn das ist es ja doch, was du getan hast. Du hast einen Himmelskörper geschaffen. Eine Singularität von ungeheurer Intensität und von ungeheurer Anziehungskraft. Eine Wirklichkeit, deren Schwerkraft den Erfahrungsraum, den Wirklichkeitsraum und den Wahrnehmungsraum in ihrer Nähe verformt. Eine Wirklichkeit, die nicht nur die Wirklichkeit eines intensiven Menschen, sondern die Intensität Gottes zur Erscheinung bringt, aber auch deren Gegenteil offenbart: das Schwarze Loch aussichtsloser Gottverlassenheit, zu dem dieses singuläre Leben wird, als es am Ende implodiert. Du hast eine einzigartige magnetische Wirklichkeit geschaffen. Eine Wirklichkeit, deren Intensität auch in ihrem Leiden so gewaltig ist, dass ihre Anziehungskraft nicht nur in ihrer Nähe, sondern auch in der Ferne anderer Zeiten und Welten wirkt. Gravitation ist die einzige uns bekannte Kraft, die Raum und Zeit überwindet, weil sie die Textur von Raum und Zeit verändern und wie ein Stein, der ins Wasser fällt, Wellen in der Raumzeit schlagen und das Raum-Zeit-Kontinuum verformen kann!«
Das würde ich ihm sagen – ihm, dem fremden Evangelisten, den ich auf den folgenden Seiten der Einfachheit halber bei demjenigen Namen nennen will, nach dem sein Evangelium seit je benannt ist. Ich weiss nicht, ob er, Markus, es verstehen könnte. Und ich weiss auch nicht, ob er von dieser astronomischen Metaphorik so zu begeistern wäre, wie ich selbst von ihr begeistert bin. Denn ist es ihm nicht auch ohne die Kenntnis der Astrophysik meiner Zeit gelungen, uns eine intensive, singuläre Präsenz vor Augen zu führen? Ist die Intensität seiner Worte nicht ebenso gewaltig wie ihr Inhalt? Ist sein Evangelium, das von einer ungeheueren Kraft zeugt, nicht eine Kraft, die es mit den lebenszerstörerischen Kräften und dem Chaos der Welt aufnehmen kann, aus dem heraus und in das hinein Markus seinen Stern gebar? Seinen Stern Jesus, dessen Strahlkraft er deshalb ins nahezu Unermessliche steigerte?
»Wolltest du das, Markus?«, frage ich ihn. »Wolltest du eine Intensität erzeugen, die deinen Herrn den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen deiner Zeit und aller Zeiten so in die Seele einprägt, dass sie nicht mehr daran zweifeln, dass es einen gibt, der es mit allen, sogar mit dem Satan und mit dem Tod, aufnehmen kann?«
Ich stelle mir vor, dass er, der Fremde aus der Vergangenheit, mir, dem Fremden aus der Zukunft, in die Augen blickt und sagt: »Ich wollte Worte machen, die so schwer und so kostbar sind wie ein Goldstück. Worte, die auch dann nicht vergehen, wenn eines letzten Tages Himmel und Erde vergehen. Worte mit Gewicht. Worte, denen man nicht davonlaufen kann, weil sie einen immer wieder auf sich zurücklenken, zurückwerfen und zu sich heimholen. Worte, deren Schwere einen alles Leichtgewichtige, aber auch alles Schwergewichtige des eigenen Lebens vergessen lässt. Worte wie eine Gravur. Gravierende Worte. Ich wollte Worte machen, die so kostbar sind, dass man sich an sie klammert, weil man sie unter gar keinen Umständen verlieren will.«
Und an dieser Stelle würde er vielleicht mit den Schultern zucken und beteuern: »Aber meine Worte können nur deshalb gravierend und kostbar sein, weil er, unser Herr, selbst gravierend und kostbar war und ist. Nicht ich bin es also, der das Goldstück gemacht hat. Das Goldstück ist es, das mich gemacht hat. Der, den ich geschaffen habe, hat mich geschaffen. Mag sein, dass ich einen himmlischen Körper erfunden habe. Aber genauso hat dieser himmlische Körper mich erfunden. Jesus ist ebenso meine Erfindung, wie ich die Erfindung Jesu bin, der, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dagewesen sein muss, ehe Himmel und Erde geschaffen wurden. Vor mir und vor allem anderen, was ist. Nicht ich habe also den Stein ins Wasser geworfen. Er ist ohne mein Zutun vom Himmel ins Wasser gefallen. Ich bin Welle – ebenso, wie auch du Welle bist. Und ich bin Stein. Ebenso, wie auch du Stein bist. Mein Evangelium ist Welle und Stein. Wenn überhaupt, dann habe ich diesen Himmelskörper entdeckt und wie einen aus dem Weltraum gefallenen Rohling veredelt und in das Gold meines Evangeliums gefasst. Und ich habe ihn nur deshalb entdecken, veredeln und fassen können, weil ich von ihm entdeckt und erfasst worden bin – so, wie seine Jüngerinnen und Jünger ihn für sich und die Welt entdeckten. Weil er sie entdeckte, erfasste, ihnen den Schleier von ihren Augen riss und sie Gott und die Welt neu sehen lehrte. Nein, ich habe ihn nicht erfunden, diesen Himmelskörper. Mein Evangelium und ich selbst leben von einer Wirklichkeit, die ich nicht hätte erschaffen können, auch wenn ich sie irgendwie ja tatsächlich erschaffen und erschrieben habe. Aber aus diesem Erschaffenen und Erschriebenen springt immer wieder ein Funke auf mich über – ein Funke, der mein Schreiben und mein Leben entzündet, erhellt und zum Leuchten bringt.«
Als das Bild des fremden Evangelisten vor meinem inneren Auge verblasst und ich nur noch seine Worte in meinem Kopf höre, frage ich mich, ob dieses fiktive Zwiegespräch über den fremden Himmelskörper Jesus nicht doch ein reichlich verrücktes Unterfangen und letztlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Muss es nicht daran scheitern, dass wir, der fremde Evangelist und ich, uns zu fremd sind, als dass wir uns wirklich verstehen und einen erhellenden Diskurs über Intensität, Wirklichkeit und Wirkung und über die Wahrheit Jesu führen könnten?
Aber wer weiss. Vielleicht trifft ja auch das Gegenteil zu. Vielleicht sind er und ich als Jünger Jesu einander so fern und so fremd nicht. Und falls dies doch der Fall sein sollte, dann könnte unser Gespräch womöglich gerade aufgrund der Fremdheit unserer beiden Welten aufschlussreich sein. Denn was wäre langweiliger als eine Begegnung mit der Vergangenheit – sei es der des Evangelisten oder der des Mannes aus Nazaret –, die nur ein Blick in den Spiegel ist, durch den wir nicht eine andere Wirklichkeit, geschweige denn die Wirklichkeit Gottes, sondern allein uns selbst und unser eigenes Welt- und Menschenbild erkennen? Viel reizvoller ist es ja doch, mit dem Vertrauten Feste des Nichtwiedererkennens zu feiern und sich der fremden Nähe des ganz Anderen auszusetzen.
Mir jedenfalls ging es nach dem wiederholten Lesen des Markusevangeliums so, dass dessen Worte umso ferner zurückblickten, je näher ich sie ansah. Ich fand mich auf einmal einem Jesus gegenüber, dessen kraftvolle Präsenz nichts mit der schwächlichen, entmythologisierten, als Resonanzverstärker eigener Interessen instrumentalisierten und bis zur Unerträglichkeit vermenschlichten Figur zu tun hatte, der ich in der Theologie und in der Kirche meiner Gegenwart allzu oft begegne. Und mir wurde angesichts des markinischen Gottessohns auf einmal auch noch etwas anderes klar. Mir wurde klar, dass unsere Zeit und die Kirche unserer Zeit keine schwache, sondern eine starke Theologie braucht. Vor allem aber einen göttlichen Helden.
Der Jesus des Evangelisten Markus ist ein solcher Held – ein sehr starker und sehr glaubwürdiger Held. Mag sein, dass dieser Held ebenso fiktiv wie real und – zumal in der Einflusssphäre der hellenistischen Kultur – den Göttern und Halbgöttern der griechischen Mythologie nachempfunden ist. Dennoch ist und bleibt er auf eine Weise wirklich, die meiner Überzeugung Nahrung gibt, dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist – und ein Antidot gegen die Tödlichkeit der Welt, in der wir leben und in der wir uns nach einem Gott sehnen. Weil uns, obwohl wir an keinen Gott mehr glauben können, ja doch nur ein Gott retten kann – ein Gott, den wir, falls es ihn nicht geben sollte, erfinden müssten. Ein Gott, dessen Wahrheit wir zur Not in die Wirklichkeit hineinlügen müssten, um die Not der Welt zu wenden und die Tränen von den Augen der Menschen abzuwischen.
Ich glaube, Christen und Christinnen sind es der Menschheit schuldig, in einer Welt, in der nichts für Gott spricht, für Gott zu sprechen und zu leben, als ob es ihn gäbe, diesen Gott. Sie sind es der Welt schuldig, den Narrativen der Hoffnungslosigkeit, der Schwarzmalerei, der Apokalypse, des Zynismus, der Verblendung, der Selbstüberschätzung, aber auch der Selbstgeringschätzung des Menschen ein ganz anderes Narrativ der Hoffnung, eben die große Christuserzählung entgegenzusetzen.
Und vielleicht verhält es sich mit dieser Christuserzählung so, wie es sich mit jeder Fiktion verhält. Vielleicht ist die Fiktion des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wahrer als die historische Wahrheit, wahrer als alles, was wir in unserer ernüchterten und entzauberten Welt für wahr halten, und erfüllender als alles, von dem wir uns Erfüllung versprechen. Und zwar deshalb, weil die Intensität des Lebens Jesu als Intensität einer göttlichen Gegenwirklichkeit die Kraft hat, die Realität zu verformen, die wir für die letzte Wirklichkeit halten.
Worin genau diese Intensität besteht und was das Evangelium des Markus in der Gestalt, die Markus ihm gegeben hat, so wahr macht, wird sich, so hoffe ich, in den folgenden zehn Kapiteln zeigen. Ich möchte mit ihnen zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Gravitation Jesu trotz der zunehmenden Entfernung jeder zukünftigen Zeit und jeder zukünftigen Welt von diesem rätselhaften Himmelskörper nicht schwächer wird.
Mein Buch versteht sich mithin als Detektor, als Seismograf und als Verstärker der Gravitationswellen Jesu, von dem ich je länger, je mehr glaube, dass er die Antwort auf unsere letzten Fragen und die Erfüllung unseres Menschseins ist.
1
Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber stand, ihn so sterben sah, sagte er: Ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn!
Markus 15,39
Was ist Wahrheit?
Der Held und die Helden der Anderswelt
Jener Jesus, den uns der Evangelist vor Augen führt, ist kein möglicher Gegenstand historischer Wissenschaft und eigentlich auch kein Gegenstand anthropologischer Forschung. So, wie Markus diesen gottgleichen Menschen schildert, hat er niemals existiert und kann kein Mensch jemals existieren. Der, den er in Israel auftreten und wunderwirkend über die Erde und über das Wasser gehen lässt, gehört einem Wirklichkeitsraum an, der nicht von dieser Welt ist. Der Fremde vom Himmel ist und bleibt auch auf der Erde, die ihn hervorgebracht hat, ein Fremder. Oder anders gesagt: So wirklich und irdisch dieser Mann aus Nazaret sein mag, so sehr entspringt er doch auch dem Reich der Imagination und dem Wunschdenken des Glaubens an Gott als letztbestimmender Wirklichkeit.
Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass die Zeitgenossen des Markus nicht bei der ersten Begegnung mit seinem Evangelium sofort begriffen, dass die Überhöhung der Gestalt Jesu ins Überirdische und Übermenschliche vor allem dazu diente, den Glauben an ihn zu stärken? Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass die ersten Menschen, die mit dem Evangelium des Markus in Berührung kamen, nicht durchschauten, dass jeder einzelne Satz und die gesamte Komposition dieses Textes eine Verklärung des Gottessohns Jesus war – eine Verklärung, die einzig und allein die Absicht verfolgte, sich selbst zu beweisen, aber dazu natürlich nicht imstande ist, weil das Bewiesene immer schon von ihr vorausgesetzt wird? Oder hatten die Damaligen ein ganz anderes Verständnis von Wirklichkeit und ein ganz anderes Verständnis der Wahrheit von Texten als wir Heutigen, die wir freilich unsererseits allzu bereitwillig Botschaften Glauben schenken, die uns medial als Fakten vorgespiegelt werden?
Ich würde Markus gerne fragen, ob nicht auch er selbst wusste, dass das, was er schrieb, zwar gut, intensiv und kraftvoll geschrieben ist, sich aber niemals so zugetragen haben dürfte. Und ich würde ihn gerne fragen, ob eine Zeit noch an Jesus glauben kann, deren Natur- und Literaturwissenschaften zweifelsfrei demonstrieren, dass die singuläre Gestalt, die der erste Evangelist erschaffen und überhöht hat, zwar als literarische Stilisierung wirklich, jedoch im Rahmen des naturwissenschaftlich Möglichen unwirklich und unmöglich ist.