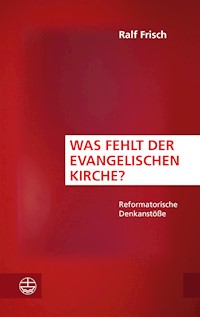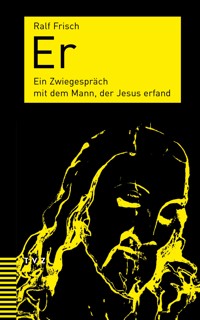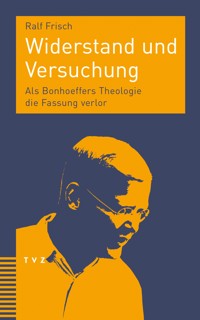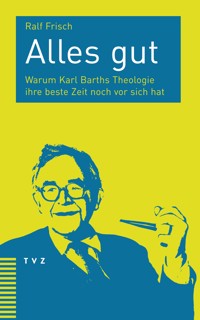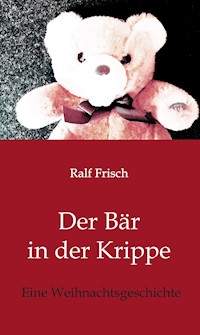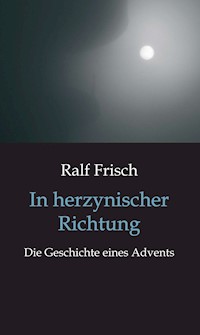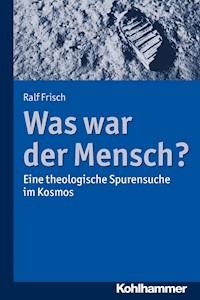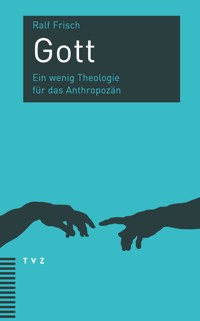
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist alles. Er ist Antwort auf alle Fragen. Er ist das Problem und die Lösung, der Schuldige und der Retter, der Teufel und der Heiland. Dass dem All kein höherer und kein tieferer Sinn innewohnt, gilt als ausgemacht. Undenkbar, dass Gott als Antwort infrage kommen, die Welt im Innersten und im Äussersten zusammenhalten und womöglich sogar retten könnte. Ralf Frisch vertritt die These, dass der Mensch mit sich und der Welt heillos überfordert ist. Den metaphysisch so hoffnungslosen wie überladenen Narrativen des Anthropozäns setzt er die majestätische Erzählung der Ungeheuerlichkeit eines schöpferischen und erlösenden Gottes entgegen. Eine fesselnde und mitunter tollkühne Auseinandersetzung mit den Grenzfragen des Menschseins. Ein Plädoyer für die verwegene Hoffnung, es könnte vielleicht doch wahr sein, dass es Gott gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Frisch
Gott
Ein wenig Theologie für das Anthropozän
Inhalt
Cover
Inhalt
Impressum
Glaubensfrage
Zuvor
Die Anderswelt und das Anthropozän
Ein Fremdkörper
Imagine there’s no heaven
Theologie ohne Gott
Eine nihilistische Erzählung
Die Ratte im Keller
Helden- und Heilandsgeschichten
Wir
Erosionen und Oxidationen
Die Aufgabe der Theologie
Vier grosse Fragen
Eine spanische Antwort
Einsteins Entsetzen
Elementarteilchen und Personen
Das Bewusstsein des Universums
Hirngespinste
Das Heilige
Die Verstofftierung Gottes
Schneeflocken und Blutröte
Das verbotene Lachen
Die letzte Häresie
Moralische Ungeheuer
Verwegenheit
Ein uralter Streit
Die Gretchenfrage
Trojanische Existenz heute
Sinn machen
Der brutalste Gotteskiller von allen
Die Logik von Reinigungskräften
Kinder des Theozän
Gottes Ebenbild in der Provinz
Always on God’s Mind
Singularität und Mythos
Geschichten statt Atome
Vielleicht ist es wahr
Bettler und Zeigefinger
Schuld und Sühne
Das allgegenwärtige Jüngste Gericht
Feste des Nichtwiedererkennens
Der letzte Mensch und der Himmel
Das Licht der Erlösung
Die Wiederkunft Gottes
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
UmschlaggestaltungSimone Ackermann, Zürich
Zitat Seite 5: Benjamín Labatut, The Maniac, New York 2023, 89
Druckgapp print, Wangen im Allgäu
ISBN 978-3-290-18662-3 (Print)ISBN 978-3-290-18663-0 (E-Book: PDF)ISBN 978-3-290-18791-0 (E-Book: EPUB)
2. leicht überarbeitete Auflage 2025©2024 Theologischer Verlag Zürichwww.tvz-verlag.ch
Alle Rechte vorbehalten
Hersteller:TVZ Theologischer Verlag Zürich AG, Schaffhauserstr. 316, CH-8050 Zü[email protected]
Verantwortlicher in der EU gemäss GPSR:Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, Kreidlerstr. 9, DE-70806 [email protected]
Weitere Informationen bezüglich Produktsicherheit finden Sie unter: www.tvz-verlag.ch/produktsicherheit
«Lost faith is worse than no faith at all,because it leaves behind a gaping hole,much like the hollow that the Spirit leftwhen it abandoned this accursed world.But by their very nature, those god-shaped voidsdemand to be filled with something as preciousas that which was lost.The choice of that something –if indeed it is a choice at all –rules the destiny of men.»
Benjamín Labatut
Zuvor
Dieses Buch spielt in zweiundvierzig Kapiteln mit dem Gedanken, dass nicht der Mensch, sondern Gott die Antwort ist. In der vom Menschen gezeichneten Epoche des Anthropozän ist dieser Gedanke entweder ungeheuerlich oder lächerlich. Trotzdem könnte er wahr sein. Und wahr könnte es auch sein, dass die Gottesfrage die Frage unserer Zeit ist – zumindest die Frage, an der die Zukunft der Theologie hängt.
Der zweite Gedanke, mit dem dieses Buch spielt, ist die Vorstellung, dass der Mensch zwar ethisch überschätzt wird, aber dennoch nicht bedeutungslos ist. Und zwar aufs Ganze gesehen. Genauer gesagt aufs Ganze des Alls. Wenn Geist und Bewusstsein in die Textur des Kosmos eingewoben, womöglich sogar die Signatur des Schöpfergeistes sind, dann hat es mit dem Homo sapiens vielleicht doch Erheblicheres auf sich. Dann ist der Mensch, so sehr er mit sich selbst und der Schöpfung überfordert ist, nichts Geringeres als Gottes Ebenbild. Dass er – Sternenstaub, der über die Sterne nachdenkt – nach den Sternen und darüber hinaus greift, kommt also nicht von ungefähr. Denn als Sternenkind ist er nicht nur Kind des Kosmos, sondern Kind Gottes. Er ist zu Höherem bestimmt und Höherem versprochen.
Der dritte Gedanke, der durch dieses Buch geistert, kann der Versuchung nicht widerstehen, den Heiland als Helden der kosmischen Geschichte am Werk zu sehen und der grossen Erzählung der Bibel mehr Glauben zu schenken als den illusionslosen oder illusionären Narrativen unseres so säkularen wie ersatzreligiösen Zeitalters. Sollte wirklich der rettende Gott es sein, der die Welt im Innersten und Äussersten zusammenhält, gegen das Chaos kämpft und seine Schöpfung der Vernichtung entreisst, dann wäre das zwar ungeheuerlich. Aber wovon sonst, wenn nicht von der Ungeheuerlichkeit Gottes sollte im christlichen Glauben, in der christlichen Theologie, in der christlichen Kirche und in einem christlichen Buch über Gott die Rede sein?
Dieses Buch ist also ein «frommes» Buch. Ich setze das besser in Anführungszeichen, um manche Leserinnen und Leser nicht schon mit dem Vorwort in die Flucht zu schlagen. Vielleicht könnte ich die Anführungszeichen aber auch weglassen. Denn es ist ja vielleicht doch denkbar, dass ein frommes Buch, wenn es nicht allzu aufdringlich daherkommt, in einer sinnsehnsüchtigen Epoche auf Neugierde stösst.
Dennoch bleibt es vermutlich dabei, dass eine Wiederentdeckung Gottes in Zeiten wie diesen nur eine ziemlich unzeitgemässe Betrachtung sein kann. Denn in der Welt, in der Theologie und in der Kirche des Anthropozän kommt Gott als Antwort immer weniger infrage. Gegen die Alternativlosigkeit der atheistischen Denkungsart schreibt dieses Buch an. Anachronistisch und leidenschaftlich. Wahrscheinlich vergeblich. Hoffentlich inspirierend. Und wer weiss – vielleicht ist es ja wahr. Vielleicht ist es wahr, dass am Ende nicht alles nichts ist, dass wir nicht mit uns und unserer Welt unter einem leeren Himmel allein sind und dass nicht wir die einzigen und letzten Helden sein müssen. Vielleicht ist es wahr, was Paul Gerhardt gedichtet hat – dass nämlich Gottes Held die Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch aus allem Jammer reisst.
Als ich dieses Buch schrieb, wurde ich auch einen anderen Gedanken nicht los. Den Gedanken, dass ich immer dann, wenn ich Theologie zu treiben beginne, nicht Herr meiner Sinne, sondern ein Getriebener bin. Wenn ich also zu Beginn dieses Vorworts sage, dieses Buch spiele mit dem Gedanken, dass nicht der Mensch, sondern Gott die Antwort sei, dann ist das eigentlich Unsinn. Wer die Theologie ernst und beim Wort nimmt, wird merken, dass ihr Gegenstand – Gott – immer schon ihr Herr ist. Wer also meint, den Gottesgedanken im Griff zu haben und mit ihm spielen zu können, könnte sich täuschen. Am Ende verhält es sich so, wie die Alten glaubten: dass nämlich Gott der Theologie die Feder führt und dass jede Theologie, die ihren Namen verdient, von vornherein die Kontrolle über ihren Gegenstand verloren hat. Wenn ich nicht von der Möglichkeit des Daseins Gottes überwältigt wäre, hätte mich jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit nicht die Idee heimgesucht, im Anthropozän ein Buch über Gott zu schreiben.
Ich danke Lisa Briner und Bigna Hauser von Herzen für die Lust und den Mumm, dieses Buch das Licht der Welt erblicken zu lassen. Ausserdem danke ich allen, denen sich dieses Buch verdankt, auch wenn sie es womöglich gar nicht wissen. Gewidmet ist dieses Buch dem, der nach den Sternen greift.
Und nun: Ein wenig Theologie für das Anthropozän!
Ralf Frisch
im Spätsommer 2024
Die Anderswelt und das Anthropozän
Das Wort Gott ist ein leichtes Wort. Vielleicht sogar das allerleichteste. Es ist ein Wort, das für Erleichterung sorgen könnte. Es zieht Menschen nicht hinunter, sondern hinauf. Es erdet sie nicht in der Welt. Es verankert sie in der Anderswelt. Wären wir wirklich Kinder Gottes, dann wären wir Kinder des Himmels, nicht nur Kinder der Erde. Wir wären nicht Biomasse, sondern Himmelskörper, Lichtgestalten gewissermassen. Man könnte auch den weisen Yoda aus «Star Wars» zitieren. Denn Mythenmund tut Wahrheit kund. Der sagt: «Luminous beings are we, not this crude matter.»
Auch das Wort Gott ist ein luminous being. Es ist ein leuchtendes Wort, das Augen zum Leuchten bringen könnte, weil in diesem Wort etwas zu sehen ist, was nirgendwo sonst auf Erden zu sehen ist. Oder besser gesagt: weil durch dieses Wort hindurch etwas zu sehen ist, was in keinem anderen Wort der Welt zur Welt und zum Vorschein kommt. Die Welt hinter der Welt. Die letzte Wirklichkeit. Die Anderswelt. Das Wort Gott ist durchsichtig für die Anderswelt, und es kann dünnhäutig für die Anderswelt machen. Wenn es diese Anderswelt gibt und wenn in ihr das Heil der Welt verborgen ist, dann ist das, was ist, nicht alles, und dann ist am Ende nicht alles nichts. Dann wird die Welt eines nahen oder fernen Tages zu einer anderen Welt werden, weil sie in einer anderen Welt aufgehoben ist. Und wenn die Welt in einer anderen Welt aufgehoben sein wird, dann wird sie gerettet sein. Und es wird auch dann, wenn alles verloren scheint, nicht alles zunichte. Mag sein, dass die Welt untergeht. Wenn es jedoch die Anderswelt gibt, dann geht die Anderswelt auf, wenn die Welt untergeht.
Das Wort, das die Kraft hat, zur Sprache zu bringen, dass am Ende kein Weltuntergang, sondern ein Weltaufgang steht, ist das mächtigste Wort der Welt. Das Machtwort schlechthin. Es hat die Macht und die Leichtigkeit, der Welt die Erdenschwere und das Gewicht zu nehmen, das sie selbst sich gibt und sich selbst aufbürdet. Das Gewicht, das zum Übergewicht zu werden und die Kraft des Menschen zu übersteigen droht. Zumal in einer Epoche, die seit einigen Jahren Anthropozän heisst, weil die Oberfläche der Erde immer sichtbarer die Züge des Menschen trägt.
Im Anthropozän macht sich der Mensch für alles verantwortlich, was das Antlitz der Erde versehrt und verstümmelt. Mitunter macht er sich sogar Vorhaltungen, wie er so unklug sein konnte, Gott zu erfinden und in dessen Namen noch mehr Gewalt auf der Erde zu säen.
Mag der Mensch im Anthropozän aber auch an allem schuld sein, so wird im Anthropozän doch allein dem Menschen auch die Heilung der Wunden der Welt zugetraut und zugemutet. Der Mensch ist die einzige Antwort, die im Anthropozän infrage kommt. Er spielt alle Rollen im Erddrama. Er spielt die Rolle des Schuldigen und des Richters, die Rolle des Verderbers und des Retters. Er spielt die Rolle des Teufels und die Rolle Gottes. Denn es ist der Mensch, der nicht nur den neuen Menschen erschaffen, sondern sich selbst zum Gott «upgraden»1, also Gott verkörpern muss. Weil sich der Mensch mit der Heilandsrolle aber heillos überfordert, ist das Anthropozän auch die Epoche des überschätzten Menschen.2 Und weil den Menschen genau dies dämmert, ist das Anthropozän auch eine Epoche der «melodramatischen […] Töne im Blick auf ein […] Ende, jenseits dessen keine Zukunft für die Menschen mehr vorstellbar ist»3.
Dass eine erdgeschichtliche Epoche den Namen Anthropozän trägt, signalisiert, dass Menschen mehr denn je glauben, der Mensch sei die Schicksalsmacht schlechthin und zu allem fähig – und zwar in jederlei Hinsicht. Schon vor zweieinhalb Jahrtausenden liess Sophokles den Chor seiner «Antigone» resümieren: «Ungeheuer ist viel und nichts / Ungeheurer als der Mensch.»4 Der bedeutendste Tragödiendichter der griechischen Antike wusste um die Grösse des Menschen und um das Grauen, das mit dem Menschen einhergeht. Er wusste, dass von allen Naturwesen allein die Menschen die Auslöschung ihrer selbst im Sinn haben und bewerkstelligen können – so sehr, dass man geradezu glauben muss, der Anfang der Kulturgeschichte sei der Anfang vom Ende aller Kultur. Angesichts der griechischen Tragödie scheint es, als stünde schon über der Wiege des Abendlands eine Sonne, deren Aufgang nicht von ihrem Untergang zu unterscheiden ist.5 Abendland, das heisst immer schon Untergang des Abendlands. Abendland, das heisst Dialektik der Aufklärung,6 des Humanismus und des technologischen Vernunftgebrauchs. Im Fortschreiten der Geschichte des Abendlands, namentlich im Anthropozän, wird offenbar, dass nichts «der absoluten weltlich-säkularen Selbsterhebung des Menschen deutlicher widersprechen [könnte] als eine Instanz, die seinen Möglichkeiten überlegen»7 ist. Doch wenn nichts und niemand den Menschen vor sich selbst und vor den Geistern, die er ruft, verschonen kann, dann stellt allein «der Mensch für den Menschen die höhere Gewalt»8 dar.
Das Wort Gott könnte den Menschen seiner Letztinstanzlichkeit entkleiden und ihm die Verantwortung für das eigene Schicksal von den Schultern nehmen. Es könnte sein Leben leichter machen. Ätherischer. Luminoser. Aber auch numinoser. Erstaunlicher. Es könnte dem Dasein nicht nur Leichtigkeit, sondern auch Gewicht geben. Ein Gewicht, das ihm kein anderes Wort der Welt geben kann. Das Wort Gott könnte die mit sich selbst überforderte Welt von sich selbst entlasten. Es könnte die entzauberte Welt wiederverzaubern und als geheimnisvolles Abenteuer erscheinen lassen. Als Gottesabenteuer.9
Leider ist das unmöglich. Denn das Wort Gott ist kein Wort des Anthropozän. Das Wort Gott hat im Anthropozän nicht die Kraft, die es eigentlich hat. Wenn, dann hat es nur noch negative, abstossende Kraft. Es ist keine höhere Gewalt mehr. Allenfalls eine niedere Gewalt. Die Idee von Rettung und Erhebung, die mit dem Wort Gott einst einherging, überlebt am ehesten noch in den Fiktionen der Populärkultur. Im schon erwähnten Weltraumepos «Star Wars» zum Beispiel, wo die göttliche Macht des Guten «Force» heisst. Die Segenssprüche dieser Fiktionenkannman auch im Anthropozän zitieren. Man kann auf T-Shirts drucken lassen: «Remember, the Force will be with you, always!» Man kann sich und andere daran erinnern, dass die Macht immer mit uns sein wird. Wenn man es aber tut, dann nicht ohne Augenzwinkern und Anführungszeichen, die gleichsam Vorsichtsmassnahmen gegen allzu unverhohlene metaphysische Gewissheiten und doch ihrerseits Ausdruck einer metaphysischen Gewissheit sind. Der Gewissheit nämlich, dass es nichts ist mit der Metaphysik und nichts mit der Anderswelt. In der aufgeklärten Welt herrscht die stillschweigende Übereinkunft, dass es die Macht, die immer mit uns ist, nur in illusionären Gegenwirklichkeiten, also nur scheinbar gibt. Aus Gründen der Psychohygiene und vielleicht auch aus Gründen der Sozialhygiene ist es gestattet, aus der säkularen Gesellschaft in diese Gegenwelten zu entrinnen, ohne sich um irgendeinen sozialen und gesellschaftlichen Relevanznachweis von Religion sorgen zu müssen. «Es gehört», so der Philosoph Peter Sloterdijk, «zu den Leistungen der Modernität, der Religion und den Religionen den Auszug in die virtuelle Asozialität zu gestatten».10 Die in die soziale Nutzlosigkeit des Imaginationsraums entlassene Religion ist frei. Aber diese Freiheit hat einen Preis. Der Auszug kann nur als ästhetischer, eben virtueller Auszug, als Exodus im Modus des Als-Ob11 für glaubwürdig gehalten werden. Die Überzeugung, dass es aus dieser Welt keinen Ausgang in eine heile oder heilende andere Welt gibt, ist mit der Textur dieser Zeit so verwoben, dass nichts und niemand ihr diese Überzeugung ausreden kann. Auch nicht Gott. Wer sie zu äussern wagt, erntet gewiss auch heimliche Bewunderung, häufiger jedoch verhohlenes oder unverhohlenes Mitleid. Die Gottsagerinnen und Gottsager müssen mit der spöttisch lächelnden Toleranz derjenigen leben, die es längst besser wissen und sich denken: «Wie kann man bloss noch an Gott glauben!»12
Das Wort Gott gehört je länger, je weniger zu den Worten, denen zugetraut wird, die Welt aufzuschliessen und die Anderswelt in diese Welt hereinscheinen zu lassen. Das Wort Gott ist ein kraftloses Wort geworden. Ein Wort ohne Erkenntnisgewinn. Allenfalls signalisiert es, wenn Menschen angesichts von Katastrophen hilflos nach ihm greifen, dass ihnen die Worte fehlen.
Wo es dagegen als Machtwort in Erscheinung tritt, steht es im Verdacht, Gewalt zu legitimieren. So wird es zum Synonym für die dunkle Seite des Menschen. Und so sinkt das Wort Gott ins Dunkel unserer Zeit wie der Eine Ring in J. R. R. Tolkiens Epos in den Fluss Anduin. «And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend, legend became myth.»13
Gott beginnt also der Vergangenheit anzugehören – insbesondere im vormals christlichen Abendland, das das Weltbild des Anthropozän zunehmend verinnerlicht. Vor allem dort fällt Gott allmählich aus der Zeit. Dass es Gott geben könnte, ist in einer säkularen Kultur eine geradezu ungeheuerliche Vorstellung. Weder der aufgeklärten Welt noch der aufgeklärten Theologie dieser Welt wäre Gottes Existenz geheuer. Weil aber vielen Bewohnern der aufgeklärten Welt diese Welt selbst nicht geheuer ist, lässt sich die Sehnsucht nach andersweltlicher Geborgenheit nicht ohne Weiteres ersticken. Und weil der Mensch im Anthropozän auch sich selbst nicht geheuer, sondern ein ebenso unheimlicher Ort ist wie die Welt ausserhalb seiner selbst, flackert und glimmt diese Sehnsucht unter der Oberfläche der entzauberten Welt weiter. Vielleicht sogar jenseits der Fiktion und der Fantasy – wenn man die Religion nicht unter Fiktion und Fantasy fallen lässt. Zuweilen, zumal bei Kerzenschein, etwa am Heiligen Abend, bringt Gott auch die Augen der aufgeklärten Weltkinder zum Leuchten und macht ein grosses Fehlen und ein grosses Verlangen sichtbar. Ein Verlangen, das durch die kleinen oder grösseren Fluchten des Alltags und vielleicht auch durch das intensivste Leben und durch die meditativste Selbstversenkung nicht zu befriedigen ist. Ein Verlangen nach Transzendenz – und zwar nach einer Transzendenz, die nicht aus uns selbst kommt. Ein Verlangen, dass vielleicht doch etwas oder jemand dahinter ist und dass es Orte und Zeiten gibt, durch die jenes ganz andere Licht hindurchschimmert. Ein Verlangen, dass sich inmitten der inneren Leere und der äusseren Gefahr das Rettende sehen lässt. Der Rettende. Der Heiland. Der Erlöser.
1So Yuval Noah Harari, Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, London 2015, 43.
2Siehe Lisz Hirn, Der überschätzte Mensch. Anthropologie der Verletzlichkeit, Wien 2023.
3So Hans Ulrich Gumbrecht, Das Ende von allem? Neun Betrachtungen und ein Essay, Stuttgart 2023, 18.
4Sophokles, Antigone, 2. Akt, übers. v. Kurt Steinmann, Stuttgart 2000, 18.
5Siehe dazu Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 2 Bde., Wien 1918 und München 1922.
6Siehe Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947.
7Gumbrecht, Das Ende von allem?, 17.
8Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, Frankfurt a. M. 1999, 45. Dagegen Sibylle Lewitscharoff, Von der Machbarkeit. Die wissenschaftliche Bestimmung über Geburt und Tod, Dresdner Reden 2014, online unter https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A79117/attachment/ATT-0/, dort 13, aufgerufen am 23. Dezember 2023.
9Siehe dazu Günter Thomas, Im Weltabenteuer Gottes leben. Impulse zur Verantwortung für die Kirche, Leipzig 2020. Vgl. auch Ralf Frisch, Was können wir glauben? Eine Erinnerung an Gott und den Menschen, Stuttgart, 2., überarbeitete Aufl. 2019, 15.
10So Peter Sloterdijk, Den Himmel zum Sprechen bringen, Berlin, 3. Aufl. 2020, 333.
11Siehe dazu Sebastian Kleinschmidt, Kleine Theologie des Als ob, München 2023.
12Martin Walser, Über Rechtfertigung. Eine Versuchung, Hamburg 2012, 33.
13Lady Galadriel in Peter Jacksons Verfilmung von «The Fellowship of the Ring», des ersten Teils von «The Lord of the Rings».
Ein Fremdkörper
Viel öfter jedoch löst das Wort Gott in unseren Tagen die Spannung der Welt nicht. Es beglückt nicht. Es entrückt nicht in die Anderswelt. Es führt nicht dazu, dass Herzen höher schlagen. Es löst vielmehr ungläubiges Kopfschütteln, Befremden und Scham aus – insbesondere dann, wenn es im nichtreligiösen Raum und bei nichtreligiösen Gelegenheiten ausgesprochen wird. Dann sorgt es nicht für Erleichterung, sondern für Verlegenheit. Gott ist peinlich. Ein Wort zum Fremdschämen. Ein Fremdkörper in unserer Sprache und unserer Welt. Ein Ding der Unmöglichkeit, mit dem nichts anzufangen ist, das irgendwie unnütz und sperrig herumliegt und dennoch kein Gewicht hat, sondern so leichtgewichtig, nichtssagend und weltfremd scheint, dass es inmitten der Worte der Welt wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Worte, die gegen Gott sprechen, sind dagegen spitz und scharf. Es ist ein Leichtes für sie, das Wort Gott zum Schweigen zu bringen und stumpf, lächerlich und alt aussehen zu lassen. Es ist ein Leichtes für sie, Gott zu töten und die Schwere dieser Tat nicht einmal zu bemerken. Den Worten der Welt scheint nichts zu fehlen, wenn das Wort Gott aus ihrer Mitte oder von ihren Rändern verschwunden ist. Sie sagen sich leichter, wenn ihnen das ungemütliche Wort Gott nicht mehr in die Quere kommt und keinen Unsinn mehr macht.
Aber obwohl das Wort Gott nicht mehr weltbewegend ist, lässt es sich nicht so leicht aus der Welt schaffen. Wie Tolkiens Ring scheint es wiedergefunden werden zu wollen. Obwohl sich insbesondere in den Narrativen des Anthropozän ein «Wille zur Ferne, zum Abwesen Gottes»14 eingenistet hat, geht das Wort Gott im Strom der Worte dieser Welt knapp nicht unter.15 Ja, Gott ist «durch». Und doch fällt das Wort Gott nicht unregistriert wie ein Neutrino durch den Boden der Tatsachen, sondern taucht und fällt immer wieder auf. Weil es so bizarr und andersweltlich anmutet, ist es unübersehbar und unüberhörbar. Ein Störenfried. Auch und erst recht Gott selbst wäre ein Störenfried. Er wäre ein diabolos, der alles durcheinanderwirft. Eine ungeheure Irritation, der man irgendwie Herr werden müsste. Ein Schlag ins Gesicht einer säkularen Zivilisation und deren unausgesprochener, unsichtbarer und allgegenwärtiger Übereinkunft, dass es Gott nicht gibt und dass dieses Wort auf niemanden ausserhalb dieses Wortes verweist. Es sei denn auf den, der es ausspricht. Und selbst, wenn es hinter dem Horizont aller Wahrscheinlichkeiten so etwas wie ein höheres Wesen gäbe, das man Gott nennen könnte, dann würde dieser Gott der Überzeugung einer postchristlichen Epoche nach nichts für uns tun. Jedenfalls nichts, was uns rettet. Sei es, weil wir dem Urgrund allen Seins, der uns hervorgebracht hat, gleichgültig sind. Sei es, weil dieser schöpferische Urgrund kein Wesen ist, dem irgendetwas oder irgendjemand am Herzen liegen könnte.
Der Dichter Alfred Lord Tennyson fasste in der Mitte des 19. Jahrhunderts das göttliche Desinteresse am Menschen so pathetisch wie lakonisch in Worte: «I found Him in the shining of the stars. I marked Him in the flowering of His fields. But in His ways with men I find Him not.»16 Baron Tennyson meinte Gott zwar in der nichtmenschlichen Natur wahrzunehmen, konnte aber nicht glauben, dass dieser Gott irgendetwas mit dem Menschen im Sinn habe. Albert Einstein, dessen Geist die Welt ein halbes Jahrhundert nach Tennyson zu einer anderen machte, war ähnlicher Auffassung. Dass sich in den Gesetzmässigkeiten des Alls ein Geist manifestiert, der dem menschlichen Geist ungeheuer überlegen ist, hielt er für unabweislich. Aber er vermochte sich beim besten Willen nicht vorzustellen, dass der schöpferische Geist des Kosmos etwa Gebete erhöre. Und so sah er sich ausserstande, auf die Frage einer Sechstklässlerin, ob Wissenschaftler beten, eine positive Antwort zu geben.17 Dass Gott eigensinnig in den Weltlauf eingreifen könnte, überstieg Einsteins Vorstellungsbereitschaft. Der Gott, der sich im naturgesetzlich gefügten All manifestiert, wirkt Einstein zufolge weder Wunder noch würfelt er. Er kann die Kausalitäten der Naturgesetze nicht willentlich ausser Kraft setzen, weil sie die Ausdrucksformen seines Wesens, also die Sprache sind, die er spricht. Aber er überlässt die Natur auch nicht dem unberechenbaren Chaos, das Einstein durch die Quantenphysik und deren Bestreitung berechenbarer Kausalität ins Innerste des Kosmos einbrechen sah.
14Hans-Georg Geyer, Anfänge zum Begriff der Versöhnung, in: Hans-Georg Geyer, Andenken. Theologische Aufsätze, hg. v. Hans Theodor Goebel, Dietrich Korsch u. a., Tübingen 2003, 208–226, dort 217.
15Diese Formulierung stammt von Anselm Kiefer. Siehe Anselm Kiefer im Gespräch mit Klaus Dermutz, Die Kunst geht knapp nicht unter, Berlin 2010.
16Alfred Lord Tennyson, The Two Voices, in: Thomas J. Collins und Vivienne J. Rundle (Hg.), The Broadview Anthology of Victorian Poetry and Poetic Theory, Toronto 2000, 120ff, dort 121.
17Albert Einstein, Letter to Phyllis Wright, in: The Human Side, ausgewählt und hg. v. Helen Dukas und Banesh Hoffman, Princeton 1979, 32f.
Imagine there’s no heaven
Das Gebet, zu dem Einstein eigener Auskunft nach nicht imstande war, ist der Lackmustest aller Gottesvorstellungen. Man könnte es wie folgt auf den Punkt bringen: «Sag mir, ob du betest, und ich sage dir, ob du an Gott glaubst.» Oder besser gesagt: «Sag mir, ob du betest, und ich sage dir, an was für einen Gott du glaubst.» Es ist letztlich sinnlos zu beten, wenn man davon überzeugt ist, dass kein göttliches Gegenüber dieses Gebet hört. Unter atheistischen Voraussetzungen sind Gebete Selbstgespräche und Selbstaufforderungen in leicht erhöhtem, feierlichem Ton. Nicht viel anders ist die Lage unter pantheistischen Voraussetzungen. Der eigentliche Adressat des Gebets kann in einer pantheistischen wie in einer atheistischen Welt allein der betende Mensch sein. Das Gebet steigert allenfalls die Achtsamkeit, die Resilienz und die Selbstwirksamkeit dieses Menschen. Vielleicht erlebt er sich betend anders, tiefer und weniger unruhig als zuvor.18 Vielleicht ist sein Gebet auch das spirituelle Äquivalent eines Toberaums. Also eine Art Ventil. Ein Ort, an dem er seiner Verzweiflung Luft machen kann. Aber auch der achtsamste, selbstvergessenste, spirituell exhibitionistischste Mensch ist und bleibt in der Echokammer seiner Gebete allein in sich selbst vertieft und gefangen, wenn der Himmel leer ist.
Genau das aber ist die Überzeugung des Anthropozän: dass der Himmel leer ist19 und dass es keinen Himmel Gottes, sondern nur einen meteorologischen Himmel gibt. Das Anthropozän kommt also John Lennons Aufforderung nach. Der sang bekanntlich: «Imagine there’s no heaven and above us only sky!»Ausserdem stimmt es ins Credo der «Internationale», dem verbreitetsten Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung ein: «Es rettet uns kein höh’res Wesen, / kein Gott, kein Kaiser noch Tribun / Uns aus dem Elend zu erlösen / können wir nur selber tun!» Kein höheres oder gar höchstes Wesen versetzt uns aus den Scheusslichkeiten der Vergänglichkeit in eine Sphäre der Unsterblichkeit. Das religiöse Vertrauen auf einen rettenden, jenseitigen Gott ist Schwachsinn. Vor allem aber macht es träge. Weil Religion aufs Jenseits vertröstet, ohne das Diesseits zu verändern, muss die Religion als Religion entsorgt und zur revolutionären Politik werden. Und nicht nur das. Weil Religion im Namen der Wahrheit ihrerseits immer wieder Scheusslichkeit, Mord, Totschlag und Terror gebiert, scheint es menschenfreundlicher, für eine Welt ohne Religion einzutreten. Und exakt dies ist die Pointe sowohl des Songs von John Lennon als auch des Kampflieds der Kommunisten: dass an die Stelle des unguten Glaubens an Gott der Glaube an das Gute im Menschen zu treten hat.
Wenn man der Religion im Anthropozän einen positiven Nutzen zuzubilligen bereit ist, dann offenbar nur unter der Voraussetzung, dass es sich dabei nicht nur um eine Religion jenseits der Religionen, sondern auch um eine Religion ohne Gott20 handelt. Um eine Religiosität, die weiss, dass sie mit sich allein ist und dass sie nur eine von vielen Weisen der Resilienzkräftigung, der Daseinsbewältigung und des Selbstmanagements darstellt. So und nur so scheint Religion Sinn zu «machen» – was ja eben heisst, dass die Menschen selbst es sind, die diesen Sinn in den spirituellen Fitnessstudios ihres Lebens herstellen müssen. Religion wäre dann eine Art Abhärtung gegen das Unvermeidliche. Sie wäre eine Gestalt des mystischen oder des stoischen Umgangs mit dem Unumgänglichen. Sie wäre einer unter vielen Versuchen dieses Ich, das Ich zu stärken. Zugleich wäre sie einer unter vielen Versuchen, dieses Ich loszuwerden. Sie wäre eine Narkose, eine Anästhesierung, die den Schmerz des Daseins betäubt. Also das, was Karl Marx in der Religion sah, aber anders als die Gelassenheitsberaterinnen und -berater unserer Zeit nicht gutheissen konnte: Opium des Volks.21
18So Hartmut von Sass, Unerhörte Gebete? Das Bittgebet als Herausforderung für ein nachmetaphysisches Gottesbild, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 2012, 39–65.
19Siehe dazu Thomas Grossbölting, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945, Göttingen 2013.
20Siehe dazu den gleichnamigen Titel von Ronald Dworkin, Religion Without God, Cambridge und London 2013.
21Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: Deutsch-französische Jahrbücher 1. und 2. Lieferung, Paris 1844, 71–85, dort 72.
Theologie ohne Gott
Es gibt aber nicht nur Religion ohne Gott. Es gibt auch Theologie ohne Gott. Es gibt sogar Theologie, die stolz darauf ist, Theologie ohne Gott zu sein, dessen Tod sie für theologisch unhintergehbar und normativ erklärt.22 Viele Theologinnen und Theologen der Gegenwart neigen in einer Art metaphysischer Ernüchterungstrunkenheit dazu, Gott als überweltlichem Gegenüber ebenso selbstverständlich den Laufpass zu geben, wie die nichttheologische aufgeklärte Welt dies längst getan hat. Im Kielwasser der Aufklärung hat auch die Theologie die Auffassung ins Repertoire ihrer Gottesvorstellungen übernommen, dass Gott nichts für uns tut, was nicht auch wir tun könnten und besser auch tun sollten. Wie der Theologenhasser Friedrich Nietzsche pflegt die aufgeklärte Theologie «die theistische Befriedigung mit tiefem Misstrauen»23 abzulehnen. Das Wort Theismus ist geradezu zu einem theologischen Schimpfwort geworden. Wer an Gott als machtvollem, überweltlich-personalem Gegenüber festhält und instinktiv spürt, dass Theologie ohne Theismus nicht zu retten ist, hat es gegenwärtig nicht leicht.24
Eine der beliebtesten theologischen Bewältigungsstrategien des Verdachts, dass Gott weder Adressat noch Akteur, sondern nicht existent oder zumindest ohnmächtig ist, besteht darin, Gott als anderes Wort für Zwischenmenschlichkeit und Mitmenschlichkeit zu interpretieren. Verfolgt man diese Strategie, dann bringen Transzendenzerfahrungen Menschen nicht mit einer Wirklichkeit in Berührung, die alle menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Transzendenzerfahrungen ereignen sich dann vielmehr dort, wo Menschen so sehr mit der Wirklichkeit anderer Menschen konfrontiert werden, dass sie bis zur Selbstaufgabe für andere da sind. Insbesondere in der Philosophie des französischen Poststrukturalismus kam es in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zur Heiligsprechung des – grossgeschriebenen – Anderen: des menschlichen Anderen, des Anderen des Selbst, des Anderen der Vernunft, des Anderen der abendländisch-kolonialistischen Zivilisation, des Anderen der als «normal» etikettierten und moralisch normierten Gesellschaft. Das Andere wird zum Versprechen einer grossen Befreiung, zum Versprechen wirklicher Humanität und geradezu zum Gottesersatz.25
Auch in der Theologie des 20. Jahrhunderts hatte das Andere Konjunktur. Der Schweizer Theologe Karl Barth entdeckte es in den Jahren des Ersten Weltkriegs wieder – als gewissermassen «vertikale» Andersheit Gottes.26 Dietrich Bonhoeffer kippte das vertikale ganz Andere Barths einen Weltkrieg später in die Horizontale. Er transformierte die göttliche Transzendenz zur Transzendenz des anderen Menschen. In seinen Gefängnisbriefen stellte Bonhoeffer unumwunden fest: Das «‹Für-andere-dasein› Jesu ist die Transzendenzerfahrung!»27 Nur konsequent ist es, dass dieser Jesus am Ende seinerseits die Hilfe eines anderen, nämlich der Menschen braucht. Für Bonhoeffer offenbart die Gestalt des Gekreuzigten, dass Gott ohnmächtig und schwach ist. Christinnen und Christen hoffen also vergeblich, wenn sie auf Gottes rettende Transzendenz hoffen. Transzendenz heisst vielmehr, dass sie sich auf andere Menschen hin transzendieren und am Ende auch «bei Gott in Seinen Leiden»28 stehen. Christenmenschen müssen also stärker als Christus sein. Vielleicht sogar übermenschlicher.
Im Kielwasser dieser superhumanistischen Transformation des Theismus wurde insbesondere die Theologin Dorothee Sölle nach Auschwitz nicht müde zu betonen, Christus habe keine anderen Hände als unsere Hände.29 Das entsprach ziemlich exakt der Verantwortungsethik des jüdischen Philosophen Hans Jonas.30 Für Sölles «Theologie nach dem Tode Gottes»31 heisst Religion also nicht mehr, sich für einen ganz anderen Gott zu öffnen und in der Gewissheit der Gegenwart dieses Gottes zu leben. Religion heisst, wie Christus für andere zu leben32 und letztlich auf Religion im Sinne einer Rückbindung an einen allmächtigen, ganz anderen Gott zu verzichten. Und natürlich heisst Religion auch, zum guten Hirten des nichtmenschlichen Anderen, also zum Bewahrer der Schöpfung zu werden.
Insbesondere vor dem Hintergrund der Erfahrung des Holocaust und des Bewusstseins für ökologische Krisenszenarien kommt es in der Theologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts also zu einem programmatischen Tausch der Eigenschaften Gottes und des Menschen. Man könnte auch von der anthropologischen Vollendung der altkirchlichen Lehre der communicatio idiomatum, also des Transfers der Eigenschaften zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur Jesu Christi sprechen. Und zwar insofern, als der Mensch ganz im Sinne der fortschrittsoptimistischen linkshegelianischen Religionskritik zum allmächtigen Gott wird, während der ehedem für allmächtig gehaltene Gott für ohnmächtig und letztlich für nichtexistent erklärt wird. Wenn die unrechtssensible Theologie im Lauf des blutigen 20. Jahrhunderts noch an Gott festhält, dann an einem Gott, der die Ohnmächtigen und die Opfer ohnmächtig liebt und der nicht Täter, sondern Opfer ist. Nur als Opfer scheint Gott nach Auschwitz zu retten. Andernfalls, so die Anwältinnen und Anwälte der Schwächung Gottes, wäre er ein Dämon, genauer gesagt ein Teufel. Denn ein allmächtiger Gott, der es zulässt, dass sein Volk vergast und seine Schöpfung zerstört wird, kann nur ein teuflisches Wesen sein. Ein Mephistopheles. Ein Joker. Wenn aber Gott als schwach deklariert wird, weil die Theologie keinem Teufel aufsitzen will, dann muss der Mensch stark sein. Wenn Gott seine Sache in die Hände der Menschen befiehlt, dann muss Gottes Allmacht dem Menschen zufallen. Denn nur ein Gott kann die Rolle Gottes übernehmen. Nur ein Gott kann für die Menschen, für die Schöpfung und für Gott sorgen. Die Rolle Gottes spielen zu müssen, der im Drama der Welt keine tragende Rolle mehr spielt, scheint also auch in der nachtheistischen Theologie das Schicksal des Menschen zu sein. In der menschlichen Macht zum Bösen wie zum Guten überlebt der theologische Theismus als theistische Anthropologie. Im Anthropozän ist nicht Gott, sondern der Mensch der Atlas, der unter einem leeren Himmel das Weltgebäude schultern muss.